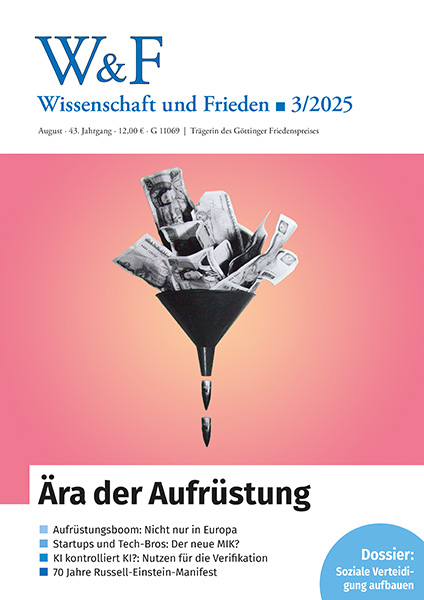BICC, IFSH, INEF, PRIF (Hrsg.) (2025): Frieden retten! Friedensgutachten 2025. Bielefeld: transcript, ISBN 978-3-8376-6939-8, 156 S., 15 € (print)/ Open Access (digital).
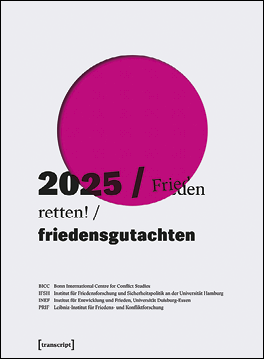
„Den Frieden retten!“ ist das Friedensgutachten 2025 überschrieben. Angesichts des jüngsten Anstiegs der Gewalt ist dieser Rettungsruf dringend nötig. Dem Trend zur Re-Etablierung des Rechts des Stärkeren in der Staatenwelt, wie auch innerhalb der Gesellschaften selbst ohne Rücksicht auf Verluste, muss auch wissenschaftlich entgegengetreten werden. Daher ist Friedenspolitik besonders darauf gerichtet, die nach 1945 gebildeten Institutionen und Regelwerke des Multilateralismus – UN, Völkerrecht, internationale Gerichtsbarkeit – zu verteidigen bzw. wiederherzustellen. Auch diese Botschaft des Gutachtens ist richtig.
Das Friedensgutachten setzt mit seinen Empfehlungen und in den Einzelbeiträgen hier deutliche Akzente. Nachvollziehbar wird dargelegt, wie die autoritäre Machtübernahme durch Trump in den USA funktioniert und welche Mechanismen dabei eingesetzt werden. Auch der Beitrag über „völkerrechtliche Mindeststandards als Gebot von Friedenspolitik“ ist höchst aktuell (ab S. 65). Die Empfehlungen des Gutachtens zur strikten Beachtung des Völkerrechts und humanitärer Gebote im Nahostkonflikt etwa sind eindeutig und klar.
Den gnadenlosen Rachefeldzug der ultrarechten Netanjahu-Regierung gegen die Palästinenser*innen und die Vertreibungspolitik anzuprangern reicht aber nicht. Die ausweglos erscheinende Situation in Gaza und der Westbank ist ohne das jahrzehntelange Versagen der westlichen Staatengemeinschaft, der USA und der EU, nicht zu erklären. Dies gilt gegenwärtig in besonderem Maße und die Friedensforschung sollte hier Klartext reden. Das Friedensgutachten stellt in diesem Zusammenhang zwar fest: „Deutschland bleibt nur glaubwürdig, wenn es nicht selbst Regeln verletzt“ (S. 9). Was aber nicht benannt wird: Die Bundesrepublik hat bereits einen großen Teil ihrer Glaubwürdigkeit nicht nur in der arabischen Welt und weit darüber hinaus verspielt, vor allem der demokratische Teil Israels fühlt sich im Stich gelassen. Wer die deutsche »Staatsräson«, den Staat Israel zu verteidigen, über die universell gültigen Rechtsnormen stellt, darf sich darüber nicht wundern. Auch die Bundesregierung sollte stattdessen die internationale Gerichtsbarkeit unterstützen, und mit Bündnispartnern den Druck auf die israelische Politik erhöhen, den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden frei zu machen. Es ist daher richtig, dass im Friedensgutachten 2025 gefordert wird, keine Waffen zu liefern, solange humanitäres Völkerrecht verletzt wird.
»Frieden retten« müsste auch bedeuten, sich Gedanken darüber zu machen, wie die laufenden Kriege beendet und die sich heftig drehende Aufrüstungsspirale aufgehalten werden können. Das Gutachten folgt hier leider der Logik der Zeitenwende. Um nicht missverstanden zu werden: Es ist legitim, Vorstellungen zu entwickeln, wie der Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression weiter unterstützt werden kann. Was kann überhaupt getan werden, um imperialistische Politiken zu stoppen? Auch darüber muss nachgedacht werden. Aber die fraglose Übernahme der These einer unabwendbaren Blockkonfrontation mit entsprechenden Aufrüstungszwängen, die in den hiesigen Medien allzu dominant ist, kann nicht das Profil der Friedensforschung bestimmen.
So muss das Gutachten auch im Kontext jüngster politischer Handlungen seiner Vertreter*innen gelesen werden. Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte die Mitzeichnung eines Appells zur drastischen Erhöhung der Militärausgaben durch die Leitungen zweier am Friedensgutachten beteiligter Institute für erhebliche Irritationen gesorgt. Initiiert von prominenten Vertreter*innen einer unausweichlichen Konfrontationspolitik wurde darin formuliert: „In dieser kritischen Phase deutscher und europäischer Sicherheit darf die Frage der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas kein Preisschild haben.“ (ZEIT 2025)
Ist es Aufgabe von Friedensforscher*innen, solche Ertüchtigungsappelle mitzutragen? Läuft ein Blankoscheck zur Aufrüstung ohne Preisschild nicht auf eine Selbstentmündigung der Friedenswissenschaft hinaus, die doch mittels wissenschaftlicher Analyse Prämissen der Kriegsführung und Konfliktbearbeitung kritisch prüfen und nachfragen sollte? Natürlich bedarf es dabei auch militärischer Expertise. Das Gutachten bleibt diesbezüglich aber eher lückenhaft. Dabei geht es um Analyse – welche Bedrohung liegt vor, welche »Fähigkeitslücken« sind real vorhanden – aber auch um normative Ansätze: Wie könnte ein vornehmlich defensiv ausgerichtetes Streitkräftedispositiv aussehen? Gerade mit Blick auf die gut organisierten Interessengruppen der Rüstungsindustrie und -befürworter*innen wäre eine kritische Distanz der Friedensforscher*innen zum allgegenwärtigen Alarmismus, der in maßloses Wettrüsten mündet, bitter nötig. Was sollte eigentlich mit der Befürwortung des Aufrüstungsappells bezweckt werden? Verspricht man sich von der größeren Anerkennung in der militärisch geprägten »Sicherheits«-Community mehr Aufmerksamkeit in den Medien und bei den politischen Entscheidungsträger*innen?
Dass es über diese Fragen in den Instituten der Friedensforschung recht unterschiedliche Auffassungen gibt, bleibt nicht aus. Erstmals wird im Gutachten auch ein solcher Dissens offengelegt (S. 6): Die eine Gruppe will an einer restriktiven Rüstungsexportpolitik festhalten, andere plädieren für die Lockerung der Regeln, um die europäische Kooperation im Zuge der EU-Aufrüstung zu stärken. Im Klartext: In bestimmten Fällen sollen geo- und wirtschaftspolitische Überlegungen über Menschenrechte und die Rüstungskontrolle gestellt werden können. Aber wohin soll es führen, wenn auch noch diese Tür aufgemacht wird?
Trotz kritischer Bewertung sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Herausgeber*innen ausdrücklich daran festhalten, dass Aufrüstung mit neuen Initiativen zur Rüstungskontrolle und mehr diplomatischen Initiativen verbunden werden müsse, Rüstung allein führe „in eine gefährliche Sackgasse“ (S. 12). Die „Perspektive auf eine europäische Friedensordnung und den Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung außer Acht zu lassen, wäre ein Fehler“, heißt es. (S. 8). Sehen wir davon ab, dass der inflationäre und nicht näher definierte Gebrauch der Wendung »regelbasierte Ordnung« dringend der Präzisierung bedarf, ist es durchaus verdienstvoll, eine längerfristige Friedensstrategie anzumahnen und Vorschläge zu machen, welche kurz- und mittelfristigen Schritte zu einer künftigen Friedensordnung führen können. Das sollte unbedingt aufgegriffen werden.
Reichlich Diskussionsstoff bieten die Überlegungen des Gutachtens zur sicherheitspolitischen Weiterentwicklung der Europäischen Union. Dort heißt es: „Die USA sind auf absehbare Zeit kein verlässlicher Partner. Alle Maßnahmen sollten daher auf ein strategisch autonomes Europa ausgerichtet werden, unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitserfordernisse“ (S. 88). Die volatile Weltlage und die immensen globalen Herausforderungen lassen Überlegungen über eine möglichst eigenständige, möglichst wirkmächtige EU als folgerichtig erscheinen. Aber was ist unter einer »strategischen Autonomie« Europas überhaupt zu verstehen? Und: Wie sollte eine EU-Außen- und Sicherheitspolitik aussehen, die eine Trendwende in den internationalen Beziehungen bewirken will? Hier scheint im diesjährigen Gutachten vieles nicht zu Ende gedacht zu sein. Schon die Idee, die europäische nukleare Abschreckung sollte vorangetrieben werden, macht stutzig. Hatte das letzte Gutachten nicht die Mythen nuklearer Abschreckung dekonstruiert und vor einer solchen Fehlentwicklung gewarnt? (vgl. BICC u.a. 2024, ab S. 94)
Eine ganze friedenspolitische Fragenbatterie mit Blick auf »strategische Autonomie« wäre noch abzuarbeiten, die im aktuellen Gutachten nicht oder nicht ausreichend behandelt worden ist. Um nur Beispiele zu nennen: Soll die EU die militärischen Fähigkeiten der USA-geführten NATO und die Instrumente verdoppeln? Zu welchem Preis? Gibt es überhaupt Kostensenkungspotenziale durch die Integration der Streitkräfte und eine Regulierung der Rüstungswirtschaft? Lautet der Auftrag der Euro-Streitmacht territoriale Verteidigung oder geht es auch um die Befähigung, weltweit mitmischen zu können? Werden Kriegsschiffe der EU demnächst im Indopazifik kreuzen? Wie will man dies verhindern, ist diese neue Rüstungsdynamik erst einmal losgetreten?
Aber nicht erst am Ende sollte die Frage stehen: Wäre es nicht allemal klüger, die besondere Befähigung der EU als Zivilmacht auszubauen? So könnte man der entzivilisierenden Politik Trumps und Putins entgegenwirken und so könnte man Allianzen mit den Schwellen- und Entwicklungsländern bilden, die keine neue Blockbildung wollen, die die multilateralen Strukturen und die UN stärken wollen, die die Politik doppelter moralischer Standards verurteilen und die mehr Hilfe bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele erwarten. So könnte die EU versuchen, die große Lücke auszugleichen, die der Trumpsche Kahlschlag bei den Ausgaben für Entwicklung und humanitäre Entwicklung hinterlässt.
Wie das gehen soll, wenn man zugleich die Rüstungslasten auf 5 % des Bruttoinlandsprodukts anheben will, müsste dann konkret beantwortet werden. Es wäre nützlich, wenn die friedenswissenschaftliche Politikberatung – spätestens im nächsten Gutachten der Friedensforschungsinstitute – genau dies einfordern würde.
Literatur
Die ZEIT (2025): Wissenschaftler fordern schnelle Einigung auf Verteidigungsausgaben. ZEIT online, 13.3.2025.
BICC, HSFK, IFSH, INEF (Hrsg.) (2024): Welt ohne Kompass. Friedensgutachten 2024. Bielefeld: transcript.
Paul Schäfer