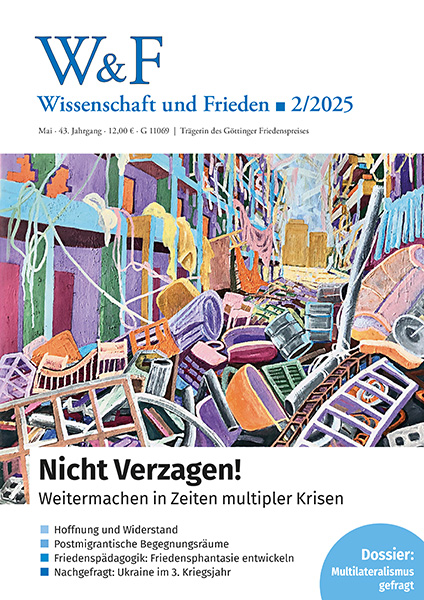Ärzte für den Krieg?
Ein Weckruf der IPPNW gegen die schleichende Militarisierung der Medizin
von Ute Rippel-Lau
Mit dem neuen »Operationsplan Deutschland« und der »Nationalen Sicherheitsstrategie« rückt das Gesundheitswesen zunehmend in den Fokus militärischer Planungen. Die IPPNW warnt vor der schleichenden Vereinnahmung ärztlicher Ethik durch Kriegslogik. Krankenhäuser, medizinisches Personal und Versorgungskapazitäten sollen auf Kriegsszenarien vorbereitet werden – eine gefährliche Entwicklung. Die IPPNW ruft das Gesundheitswesen zu einem klaren Nein zur Kriegsmedizin und einem Ja zur Kriegsprävention auf.
Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit trat am 1. Januar 2025 der »Operationsplan Deutschland« in Kraft (Bodemann 2025) – ein tausendseitiger Strategie-Plan, erarbeitet unter der Federführung der Bundeswehr. Er legt die verpflichtenden zivilen Unterstützungsleistungen für die Bundeswehr im Falle der Landes- und Bündnisverteidigung fest – Details unterliegen der Geheimhaltung. Dem vorausgegangen war die bereits im Juni 2023 von der Bundesregierung vorgestellte neue »Nationale Sicherheitsstrategie«. Diese markierte eine grundlegende und umfassende Neuorientierung der Sicherheitspolitik. Sie löste das Weißbuch der Bundeswehr von 2016 ab, welches sich noch allein auf die Verteidigungspolitik beschränkte. Im darauffolgenden Sommer 2024 verabschiedete der Bundestag die neuen »Rahmenrichtlinien Gesamtverteidigung« (RRGV), die die RRGV aus dem Jahr 1989 ablösten. Deutlich wird hier der Schritt von der Friedenslogik der 1980/90-er Jahre zur aktuellen Kriegslogik vollzogen. Während 1989 Kriegsverhütung, Entspannung, Dialog, gemeinsame Sicherheit und Abrüstung noch im Fokus standen, dominiert in den neuen Rahmenrichtlinien die »Kriegsertüchtigung«. Kriegsprävention wird nicht mehr als Ziel benannt. Gemäß der neuen geostrategischen Rolle Deutschlands als Drehscheibe für verbündete Streitkräfte bedürfe es einer umfassenden zivilen Unterstützung für die Bundeswehr, die jetzt auch auf verbündete Streitkräfte ausgeweitet werden müsse. Nun sollen alle Bereiche der Gesellschaft auf die Bedürfnisse des Militärs und die Erfordernisse der Kriegsführung ausgerichtet werden. Verteidigungsminister Pistorius formulierte es unmissverständlich: „Wir müssen kriegstüchtig werden“ und meint damit die Gesellschaft insgesamt.
Kriegstüchtigkeit als neue gesellschaftliche Leitlinie
In der »Nationalen Sicherheitsstrategie« taucht der Begriff der »Kriegstüchtigkeit«1 wiederholt auf und wird in den »Verteidigungspolitischen Richtlinien« zur Handlungsmaxime der Bundeswehr erklärt: „Soldatinnen und Soldaten, die unter bewusster Inkaufnahme der Gefahr für Leib und Leben das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“ So forderte der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer kürzlich in seiner Grundsatzrede auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2023, der ausgelobten »Zeitenwende« müsse ein Mentalitätswechsel in der Bundeswehr und insbesondere in der Gesellschaft folgen. Tatsächlich erfasst das Militärische inzwischen große Bereiche gesellschaftlichen Lebens: Universitäten, Schulen, Forschungseinrichtungen und findet sich auch in Kindersendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wie die vom ZDF produzierte Sendung »Unlogo« zeigt (Berger 2025). Auch der zivile Gesundheitssektor – der im Verteidigung- und Bündnisfall eine Schlüsselrolle einnimmt – rückt zunehmend in den Fokus.
Der Gesundheitssektor nimmt sich dieser Rolle an: In den ärztlichen Zeitschriften läuft die Diskussion über die Kriegsmedizin im Rahmen »zivil-militärischer Zusammenarbeit« auf Hochtouren, wobei Ärzt*innen der Bundeswehr viel Raum gegeben wird. Im Oktober 2024 organisierte die Bundesärztekammer eine Tagung mit dem Titel »Bedingt abwehrbereit? Die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten« (Gross; Lau 2024). Das Hessische Ärzteblatt zeigte in der Ausgabe vom November 2024 gar einen Bergungspanzer der Bundeswehr auf seinem Titelbild. Der ärztliche Direktor des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, Prof. Dr. med. B. Friemert, verschickte kürzlich bundesweit einen Artikel an Kliniken, um Chirurg*innen und Anästhesist*innen für die Landes- und Bündnisverteidigung zu sensibilisieren und auf mögliche Kriegsszenarios vorzubereiten (Friemert 2024).
Diese Dynamik ist hochbrisant. Eine enge Verzahnung von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen mit dem Militär ist ganz grundsätzlich sehr problematisch. In gegenwärtigen Kriegen werden Gesundheitseinrichtungen immer häufiger als scheinbar legitime militärische Ziele angesehen. Das zeigen die zunehmenden Angriffe auf Krankenhäuser in der Ukraine, Syrien und Gaza – eine grobe Verletzung der Genfer Konventionen. Die bewusste Verzahnung ziviler und militärischer Einrichtungen im Kriegsfall leistet dieser Entwicklung weiteren Vorschub (von Pilar; Redepenning 2015, Chamberlin 2015).
Medizinische Versorgung im Bündnis- und Verteidigungsfall
Wie sähen die Erwägungen für den Kriegsfall in der Praxis aus? Deutschland wäre im Bündnisfall sowohl das Aufmarschgebiet für NATO-Truppen, als auch die logistische Drehscheibe für verletzte Soldat*innen und Zivilist*innen. Die daraus resultierenden Patient*innenzahlen, die von unserem Gesundheitswesen versorgt werden müssten, übersteigen alles, was wir von bisherigen Katastrophen oder aus Pandemiezeiten kennen. Die Bundeswehr rechnet in groben Schätzungen mit bis zu 1.000 verletzten NATO-Soldat*innen täglich, möglicherweise über Jahre hinweg. Zudem wird eine massive Flüchtlingsbewegung von gegebenenfalls verletzten Zivilist*innen erwartet. Dem stehen fünf Bundeswehrkrankenhäuser mit insgesamt 1.800 Betten gegenüber – eine Kapazität, die in zwei Tagen allein durch akut verletzte Kombattant*innen erschöpft wäre (Tiesler 2024). Schon damit wäre unser Gesundheitswesen restlos überfordert. Hinzu kommt ein immenser Bedarf an langwieriger medizinischer Rehabilitation, beispielsweise für Amputierte.2 Ohnehin meist ohne Hilfe bleiben schon jetzt die vielen durch einen Krieg psychisch traumatisierten, sowohl die Soldat*innen als auch die Zivilist*innen.3 Kein Gesundheitssystem hat es bisher annähernd geschafft, dieses Problem zu bewältigen. Der Vietnamkrieg beispielsweise zeigt: 60.000 Vietnam-Veteranen nahmen sich bisher das Leben – mehr als im gesamten Krieg gefallen sind (Mayer 2010).
Im Verteidigungsfall, das heißt wenn das Staatsgebiet Deutschlands direkt angegriffen würde, wäre die Zahl der akut Verletzten noch wesentlich höher als in einem Bündnisfall, der nicht auf deutschem Staatsgebiet stattfinden würde. Es gäbe ein Vielfaches verletzter Zivilist*innen, deren Versorgung durch die Zerstörung von Infrastruktur und Krankenhäusern, sowie durch verletztes oder getötetes medizinisches Personal erschwert wäre. Auch könnte jeder Bündnisfall schnell zum Verteidigungsfall werden.
Für jeden dieser Fälle steht fest, dass das zivile Gesundheitssystem mit seinen räumlichen und personellen Ressourcen in erheblichem Maße und weit über die Versorgung der akut Verletzten hinaus einbezogen würde (Tiesler 2024). Uns fehlt medizinisches Personal schon in Friedenszeiten.
Grundrechte und Notstandsgesetzgebung
Ungeachtet der Infrastruktur bleibt unklar, wie allein der medizinische Personalbedarf gedeckt werden könnte. Das schon lange angekündigte Gesundheitssicherstellungsgesetz soll dies nun regeln. Aber: Alle Sicherstellungsgesetze gehen per Definition mit Grundrechtseinschränkungen einher. Sie sind sogenannte »Schubladengesetze«, die erst nach Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalles mit einer 2/3 Mehrheit des Bundestages »entsperrt« werden können. Erst dann könnten Grundrechte, wie Art. 12 auf Berufsfreiheit außer Kraft gesetzt und Art. 12a aktiviert werden, der zivile und militärische Dienstverpflichtungen vorsieht, sofern der Personalbedarf auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden kann. Im Dezember 2024 forderte der Expert*innenrat Gesundheit und Residenz der Bundesregierung eine gesetzliche Regelung, die schon in Friedenszeiten eine engere zivil-militärische Vernetzung im Gesundheitswesen ermöglicht (Bundesregierung 2024).
Die zu Grunde liegenden Notstandsgesetze wurden 1968 unter großen Protesten in die Verfassung aufgenommen (BPB 2018). „Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält“, sagte damals der Schriftsteller Heinrich Böll in seiner Rede anlässlich eines Protestmarsches im Mai 1968 in Bonn (Wiggershaus 2008).
Zwischen Medizin-Ethik und Kriegslogik
Ein Rollenkonflikt ist unvermeidlich, wenn ziviles medizinisches Personal in militärische Strukturen eingebunden wird. Während das Militär den eigenen Regeln einer Kriegslogik folgt, ist das zivile Gesundheitssystem den individuellen Patient*innen verpflichtet. Zwar unterscheidet sich die ärztliche Ethik nach der »Havanna Deklaration« der World Medical Association in Zeiten bewaffneter Konflikte nicht von der ärztlichen Ethik im Frieden (Messelken 2015) – „Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Behandlung“ regelt das Genfer Abkommen von 1949 in Art.12. Auch gilt nach der Genfer Konvention die grundsätzliche medizinische Gleichbehandlung von Zivilist*innen und Kombattant*innen, auch denen des Gegners (Fedlex 2014). Ob diese Regeln unter Kriegsbedingungen eingehalten würden, bleibt aber fraglich.
Der Begriff »Triage«, oder auch Sichtung genannt, kommt ursprünglich aus der Militärmedizin, wird aber heute hauptsächlich für die zivile Katastrophenmedizin verwendet. Er bezeichnet die Priorisierung knapper medizinischer Hilfeleistung, die z.B. bei großen Unfällen, Naturkatastrophen, Chemieunfällen etc. unumgänglich ist (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 2025a). In Kriegszeiten bekommt die Triage eine ganz andere Bedeutung. Geraten medizinische Ethik und militärische Logik in Konflikt, so ist das Militärische entscheidend. Nach dem Prinzip der »Reverse Triage« oder »umgekehrten Triage« hätte dann das geringverletzte militärische Personal Vorrang gegenüber den Schwerverletzten oder den Zivilist*innen, denn nach kurzer Behandlung könnten diese Soldatinnen und Soldaten wieder militärisch eingesetzt werden. Letztendlich ginge es im Krieg in erster Linie um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr.
Worst Case: Der Begriff Atomkrieg wird gemieden
Atomwaffen sind zwar Teil vieler Militärstrategien, doch das Wort »Atomkrieg« wird in fast allen Zivilschutzpapieren vermieden. Stattdessen ist von »größeren radioaktiven Zwischenfällen« oder »CBRN-Lagen« die Rede. Die frühere Bezeichnung »ABC-Schutz« (atomare, biologische und chemische Gefahren) wurde vor einigen Jahren durch die internationale Bezeichnung »CBRN-Schutz« (chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren) ersetzt (BBK 2025b).
Ebenso hilflos wie harmlos klingen die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission (SSK) für die Bevölkerung nach einem Atomwaffeneinsatz: Die Menschen sollen sich 24-48 Stunden in geschlossenen Räumen aufhalten und beim Verlassen FFP2 oder FFP3 Masken tragen (SSK 2023). Nach der Explosion einer Atombombe kann, ganz zu schweigen von den direkten Strahlenfolgen, schon die Zahl der Verbrennungsopfer nicht versorgt werden, wie die Erfahrungen von Hiroshima zeigten. Hier erlitten ca. 60.000 Menschen schwerste Verbrennungen. Die Zahl wäre bei den heutigen thermonuklearen Bomben noch sehr viel höher. Kein Gesundheitssystem der Welt könnte ein solches Szenario oder gar einen Atomkrieg bewältigen (Klemenz et al. 2024). Das fundamentale Paradoxon der nuklearen Abschreckung – Selbstzerstörung durch Verteidigung – wird allzu deutlich.
Nicht aufgelöst wird das Dilemma zwischen Selbstschutz der Retter*Innen und der Erstversorgung der Opfer in verstrahlten Gebieten. Die SSK empfiehlt: Lebensrettende Sofortmaßnahmen seien vorrangig durchzuführen. Andererseits seien längerdauernde Maßnahmen an Verletzten in einem hochverstrahlten Bereich zum Schutz der Einsatzkräfte und der Patient*innen zu unterlassen (SSK 2022). Es gibt aber durchaus lebensrettende Maßnahmen, die länger andauern. Während es keinen wirksamen Schutz der Zivilbevölkerung vor atomaren Gefahren gibt, forscht die Wehrmedizin an neuen Methoden wie der »Biodosimetrie«: Mittels einer Triage-App könnten aus einem Blutbild Rückschlüsse auf eine erhaltene Strahlendosis gezogen werden. Das würde dem Militär ermöglichen, auch bei noch nicht erkrankten Soldatinnen und Soldaten, die weiter Einsatzfähigen von den nicht mehr Einsatzfähigen zu unterscheiden (Klemenz et al. 2024). Hierbei geht es unter anderem um die Kriegsverwendungsfähigkeit.
„Wir werden euch nicht helfen können“
1981 plante schon einmal eine Bundesregierung ein Gesundheitssicherstellungsgesetz, das jedoch nach heftigen Protesten aus der Ärzt*innenschaft zurückgezogen wurde. Kernpunkt war die verpflichtende Fortbildung für alle Ärzt*innen, die Triage für den Kriegsfall zu erlernen – insbesondere die Sichtung und Priorisierung von Verletzten im Falle eines Atomkrieges. „Wir werden Euch nicht helfen können“ war damals die zentrale Aussage der IPPNW in ihrer Frankfurter Erklärung von 1982, die bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren hat.
In Anlehnung daran möchten wir als IPPNW mit einem überarbeiteten Text erneut eine bundesweite Kampagne starten, die sich an das Personal im Gesundheitswesen wendet. Über das Sammeln von individuellen Unterschriften für die Erklärung, die am Ende des Jahres den politischen Entscheidungsträgern übergeben werden, wollen wir als Beschäftigte im Gesundheitswesen unseren Widerstand öffentlich machen. Die katastrophalen Folgen eines Krieges für die Gesundheit im Auge, sehen wir unsere wichtigste medizinische Aufgabe in einer entschiedenen Kriegsprävention.
Folgende Erklärung soll auf der anstehenden Mitgliederversammlung der IPPNW im Mai 2025 diskutiert werden (Änderungen vorbehalten):
„Ich halte alle Maßnahmen und Vorkehrungen für gefährlich, die auf das Verhalten im Kriegsfall vorbereiten sollen. Nur kriegspräventive Maßnahmen kann ich vertreten. Ich lehne deshalb als Beschäftigte/Beschäftigter im Gesundheitswesen jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin ab und werde mich daran nicht beteiligen. Ich lehne weiterhin jede Maßnahme ab, die einer Kriegsmedizin den Vorrang vor der zivilen medizinischen Notfallversorgung gibt. Das ändert nichts an meiner Verpflichtung und Bereitschaft, in allen Notfällen medizinischer Art meine Hilfe zur Verfügung zu stellen und auch weiterhin meine Kenntnisse in der Notfallmedizin zu verbessern.“
Anmerkungen
1) Der Gebrauch des Wortes ist nicht neu: Im Juli 1944 lautete die Hauptüberschrift in der Nationalsozialistischen Wochenzeitung »Das Reich« angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Wehrmacht „Kriegstüchtig wie nur je“ (Shinwell 1944). In seiner Rede nach dem Attentat auf Hitler 1944 sagte Goebbels wörtlich: „… ich verspreche dem deutschen Volke, nichts unversucht zu lassen, um in wenigen Wochen die Heimat in jeder Beziehung kriegstüchtig zu machen“ (Internet Archive 2025). Zeitgemäßere und nicht historisch vorbelastete Alternativen wie z. B. »verteidigungsfähig« gäbe es durchaus.
2) „Zahlen aus der Ukraine deuten darauf hin, dass aktuell in der Ukraine ca. 100.000 Amputierte behandelt werden müssen.“ Sie alle müssen mit Prothesen versorgt werden und benötigen langwierige, aufwendige Rehabilitationen (Friemert 2024).
3) Von den »Kriegszitterern« des ersten Weltkrieges über die unzähligen Traumatisierten des zweiten Weltkrieges, den Vietnam-Veteranen mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom bis zu den gegenwärtig im Ukraine-Krieg, in Syrien und in Gaza psychisch traumatisierten Menschen führt eine lange Leidensgeschichte.
Literatur
Bodemann, A. (2025): Operationsplan Deutschland betrifft uns alle. Interview am 01.07.2025 in N-TV Nachrichten.
Berger, N. (2025): Ukraine-Kriegssatire im Kinderfernsehen: ZDF verteidigt sprechenden Taurus. Frankfurter Rundschau, 12.03.2025.
Gross, G.; Lau, G. (2024): Krisenresilienz – Das Gesundheitswesen in der Zeitenwende. Deutsches Ärzteblatt, 2024 (11).
Friemert, B. (2024): Chirurgische Herausforderungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung. Bundesverband der Deutschen Chirurgie e.V., 01.09.2024.
von Pilar, U.; Redepenning, B. (2015): Respekt und Distanz – Ärzte ohne Grenzen und das Militär. In: Bock (Hrsg.): Ethik und Militär. Hamburg: zebis, S. 56-62.
Chamberlin, M. (2015): Medizin als Waffe – die Ethik von Winning Hearts and Minds-Einsätzen. In: Bock (Hrsg.): Ethik und Militär. Hamburg: zebis, S. 12-20.
Tiesler, R. (2024): Resilienz des Gesundheitswesens in der Zivilen Verteidigung. Impulsvortrag Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 10.10.2024.
Mayer, T. (2010): Nachts, wenn die Toten zurückkommen. Der Spiegel, 05.04.2010.
Bundesregierung (2024): 7. Stellungnahme des ExpertInnenrats »Gesundheit und Resilienz«, 10.12.2024.
Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB) (2018): Notstandsgesetze: Testfall für die Demokratie. BPB, 29.05.2018.
Wiggershaus, R. (2008): Sternmarsch nach Bonn. Deutschlandfunk, 11.05.2008.
Messelken, D. (2015): Von Rollenkonflikten und Verpflichtungen – Militärärzte sind Ärzte. In: Bock (Hrsg.): Ethik und Militär, Hamburg: zebis, S. 50-55.
Fedlex (2014): Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde. Fedlex – Publikationsplattform des Bundesrechts, Stand 18.07.2014.
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) (2025a): Triage – Sichtung. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, abgerufen am 15.04.2025.
BBK (2025b): CBRN-Schutz. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, abgerufen am 16.04.2025.
Strahlenschutzkommission (SSK) (2022): Strahlennotfallmedizin Handbuch für die medizinische Versorgung und Ausbildung – Empfehlung der Strahlenschutzkommission, 28.08.2022.
SSK (2023): Schutzstrategien bei Nuklearwaffeneinsatz – Verwendung von Atemschutzmasken zum Schutz der Bevölkerung bei Explosion nuklearer Waffen. Revidierte Empfehlungen vom 12.09.2023.
Klemenz, B.; Backus, J.; Port, M (2024): Atomunfälle oder Terroranschläge: Medizinische Versorgung atomar verstrahlter Opfer. Deutsches Ärzteblatt, 2024 (07).
Internet Archive (2025): 1944-07-26 – Joseph Goebbels – Rede über den Anschlag auf Adolf Hitler (36:37-36:46).
Shinwell, E. (1944): Kriegstüchtig wie nur je. Das Reich – Deutsche Wochenzeitung 1944 (28), S. 1.
Ute Rippel-Lau ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Hamburg und Mitglied im Vorstand der IPPNW.