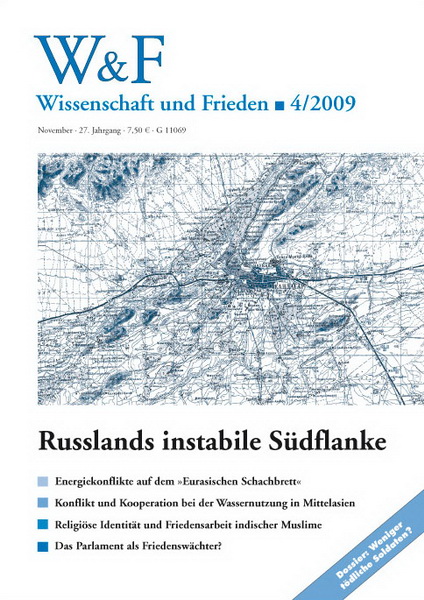Anhaltendes Nichtscheitern eines Krisenstaates
Pakistan tanzt weiterhin auf dem Vulkan
von Peer Bruch
Allen Unkenrufen zum Trotz weigert sich das oft als »failing state« bezeichnete Pakistan beharrlich zu scheitern. Stattdessen beweist das südasiatische Land, dass es angesichts zahlreicher Bedrohungsfaktoren durchaus Krisen bewältigt, wenn bisweilen auch mit eher zweifelhaften Erfolgen. Der Kampf gegen die »Talibanisierung« spielt dabei eine zunehmend wichtiger Rolle, wird jedoch von einem Geflecht aus Partikularinteressen konterkariert.
Pakistan durchlebte in den über 60 Jahren seit seiner Unabhängigkeit viele Krisen und Spannungen, von denen etliche sich in den letzten Jahren zuspitzten. In der westlichen Wahrnehmung dominiert heutzutage der Nexus von Talibanisierung, Anti-Terrorkampf und der Drohkulisse eines implodierenden Staates mit vagabundierenden Atomwaffen. Beim genaueren Betrachten erschließen sich sowohl positive als auch negative Entwicklungen. Auf der einen Seite stehen ein politischer Neuanfang mit der Rückkehr einer demokratisch legitimierten Regierung, ein zeitweilig ansehnliches Wirtschaftswachstum und das Erstarken zivilgesellschaftlicher Strukturen. Diesen Erfolgen stehen ein drohender Staatsbankrott, Korruption, massive Sicherheits- und Versorgungsprobleme, mangelhafte Rechtspflege und eine Vielzahl an Binnenkonflikten entgegen.
In der pakistanischen Politik hat man es mit sehr stark ausgeprägten klientelpolitischen Strukturen zu tun. Parteien werden meist von einflussreichen Familien geführt. In den Städten entscheidet oft die Zugehörigkeit zu Bevölkerungsgruppen und Konfessionen über die Stimmabgabe. Im ländlichen Raum definieren die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von Grundbesitzern und traditionelle Regeln, ein Gemisch aus »Volksislam« und Stammesgebräuchen, den Alltag.
Nepotismus ist an der Tagesordnung. Familienangehörige tauchen in verschiedensten Positionen auf und Töchter dienen der Heiratspolitik. Die einflussreichen Familien befinden sich im stetigen Wettbewerb miteinander und teilen das Land, die Macht und die Ressourcen unter sich auf. Dieses Modell beschränkt sich nicht auf die Oberschicht, denn die Mittelschicht adaptiert es fleißig.
Pakistans Armee ist ein Staat im Staate. Das Militär besitzt die größten und wichtigsten Fabriken, im Finanz- und im Dienstleistungssektor, aber auch im Immobilienmarkt und bei der Stadtentwicklung mischen die Offiziere kräftig mit. Größter Arbeitgeber Pakistans ist zweifelsohne der sogenannte Sicherheitsapparat. Damit nicht genug: Nahezu jede Universität und Fachhochschule wird von ehemaligen Offizieren geleitet und insbesondere in den Städten soll ein dichtes Informantennetz des militärischen Geheimdienstes Inter-Services Intelligence (ISI) existieren.
Neuanfang unter alten Vorzeichen
Mit der Abdankung des Präsidenten Pervez Musharraf im August 2008 endete eine fast neunjährige, durch gefälschte Plebiszite nachträglich legitimierte Militärdiktatur. Diese führte zu einer taktischen Allianz der beiden größten, einst verfeindeten Parteien des Landes, der Pakistan Peoples Party (PPP) mit Asif Ali Zardari, Witwer der 2007 ermordeten Benazir Bhutto, an der Spitze, und der Pakistan Muslim League (PML-N) des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif. Unterstützung erfuhren sie dabei durch die oppositionelle Juristenbewegung um den im November 2007 im Zuge der Verhängung des Notstands von Musharraf abgesetzten Obersten Richter des Landes Iftikhar Chaudhry. Andere zivilgesellschaftliche Akteure wie Menschenrechtsorganisationen und Journalistenverbände beteiligten sich am Protest gegen das Notstandsregime – sofern man aufgrund der vorherrschenden Klientel- und Interessensnetzwerken von einer pakistanischen »Zivilgesellschaft« sprechen möchte.
Schrittweise gingen auch wichtige internationale Verbündete und Geldgeber, allen voran die USA und Saudi-Arabien, auf Distanz zum Präsidenten und intensivierten ihre Vermittlungsbemühungen zwischen Regierung und Opposition. Einen weiteren wichtigen Anteil am Ende des Notstands und der Durchführung der Wahlen im Februar 2008 dürfte die schwindende Unterstützung Musharrafs seitens der Armee gespielt haben. Nach und nach hatten immer mehr pensionierte, aber noch einflussreiche Militärs Kritik geäußert und den massiven Ansehensverlust des Militärs beklagt.
Das politische Zweckbündnis zwischen PPP und PML-N fand erwartungsgemäß mit dem Rücktritt des General a.D. Musharraf sein Ende. Zardari wurde im September 2008 Präsident. Sharif dagegen blieb bis zur Wiedereinsetzung des Obersten Richters Chaudhry durch Premierminister Yousaf Gilani (PPP) im März 2009 jede offizielle politische Betätigung verwehrt. Zuvor hatte die PML-N landesweite eine massive Unterstützungskampagne für Chaudhry gestartet. Einer der Gründe für die ein Jahr währende Verzögerung der richterlichen Wiedereinsetzung seitens der PPP-Regierung dürfte die Befürchtung sein, dass dieser eine vom Musharraf-Regime erlassene Amnestie anfechten könnte, die wie maßgeschneidert für Zardari erscheint, der sich in früheren Positionen der Korruption sehr zugeneigt gezeigt hatte. Die konkurrierenden politischen Lager scheinen die Justiz vor allem als Instrument zur Schwächung der Gegenseite zu betrachten. Welchen Verlauf das Hochverrats-Verfahren gegen den im saudi-arabischen Exil lebenden Musharraf nimmt, erscheint unklar – sicher ist, dass Sharif mit ihm eine tiefe Feindschaft verbindet, schließlich hatte der General 1999 erfolgreich gegen ihn geputscht.
Während die zwei einflussreichsten politischen Lager um die Macht streiten, konnten die islamistischen Kräfte ihren Einfluss von der pakistanisch-afghanischen Grenze ins Landesinnere ausbreiten. Bis zum Mai diesen Jahres versuchte die Regierung in Islamabad Teile der Gotteskrieger mit Zugeständnissen ruhig zu halten, scheiterte damit jedoch kläglich. Erst als islamistische Milizen weniger als 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ihre Macht festigten, beschlossen PPP und PML-N angesichts dieser Bedrohung ihre Streitigkeiten aufzuschieben. Das Parlament stimmte im Mai mit großer Mehrheit der Militäroffensive mit dem vieldeutigen Namen »Der rechtschaffene Weg« zu; lediglich die Abgeordneten der islamistischen Jamiat-e-Ulema Islami (JUI) widersetzten sich.
Gefährlich oder gefährdet?
Häufig divergieren Außen- und Innenwahrnehmung von Konflikten vehement; im Falle Pakistans ist dies nicht anders. So stößt der seit einem Jahr im Kreise von US-Strategen kursierende und von den Medien mittlerweile bereitwillig übernommene Neologismus »AfPak« – er soll verdeutlichen, dass Entwicklungen in Afghanistan und Pakistan in Verbindung stehen – in der Region auf starke Ablehnung. Von außen stehen die suboptimalen militärischen Erfolge im Antiterrorkampf in den Rückzugsräumen von al-Kaida und den mit ihnen verbündeten Taliban- und Stammesmilizen in den Grenzgebieten zu Afghanistan in der Kritik. In Pakistan selbst stellt dieser Konflikt ein umstrittenes Thema dar, schließlich wird dabei größtenteils gegen die eigenen Landsleute vorgegangen. Wiederholte US-Kommandoaktionen und Raketenangriffe diesseits der afghanisch-pakistanische Grenze, teils mit, teils ohne Wissen und Duldung der pakistanischen Sicherheitskräfte, werden von vielen Pakistanis als Affront gegen die staatliche Souveränität wahrgenommen. Außerdem sterben dabei oft Familienangehörige der Zielpersonen und andere Unbeteiligte.
Zwar ist Pakistan nach Bekunden der US-Administration der wichtigste Verbündete in der Region, gleichwohl bezeichnen viele westliche Analysten den Staat auch gerne als das gefährlichste Land der Welt. Mit letzterer Aussage macht man sich jedoch keine Freunde in Pakistan – dort empfindet man sich eher als das »gefährdetste« Land. Wobei die Ursachen vorrangig im Ausland verortet werden, sei es beim verfeindeten Bruderstaat Indien oder im »Westen«, allen voran den USA. In der Vergangenheit gab es immer wieder Wege, sich mit den Djihadisten zu arrangieren und diese für eigene Interessen zu instrumentalisieren. Lange Zeit setzten Strategen der pakistanischen Armee, des ISI und des politischen Establishments auf die Gotteskrieger, um beispielsweise den indischen Teil Kaschmirs zu destabilisieren oder in Afghanistan Einfluss zu gewinnen.
Ein Teil der heutigen Führungsriegen in den islamistischen Terrorgruppen der Region wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten von Vertretern der Sicherheitsdienste geschult und ihre Organisationen finanziell unterstützt, wobei diese oft auch in mildtätigen Bereichen aktiv wurden und sowohl ein Netz aus Koranschulen als auch Hospitälern aufbauten. Während der Staat nun gegen die militanten Zweige dieser Netzwerke kämpft, leisten deren Hilfswerke dringend benötigte Arbeit. Die Falah-i-Insaniat-Foundation, Nachfolgerin der Wohltätigkeitsorganisation Jamaat-ud-Dawa, aus deren Umfeld Attentäter der Mumbai-Anschläge von 2008 stammen sollen, zeigte bei den Kämpfen ums Swat-Tal im Mai diesen Jahres, wie schon nach dem Erdbeben in Kaschmir 2005, ihr organisatorisches Talent und errichtete in kürzester Zeit drei große Flüchtlingslager.
Innerhalb der Armee scheint die Begeisterung für einen intensiveren Kampf gegen die in Guerilla-Taktik agierenden Djihadisten und Stammesmilizen ebenfalls begrenzt zu sein. Das Militär ist dafür bislang unzureichend geschult und ausgerüstet, der Blutzoll ist verhältnismäßig hoch. Die größeren Offensiven der letzten Monate haben nicht die erwünschte Wirkung gezeigt, bis zu 2,5 Mio. Flüchtlinge erzeugt und das Ansehen der Armee vor Ort aufgrund massiver, oft nicht zielgerichteter Bombardements geschädigt.
Fortdauernde Rivalität mit Indien
Bis heute wird Indien in Pakistan als eine Bedrohung wahrgenommen. Wiederholt unternahm Zardari im ersten Jahr seit seiner Amteinführung kleine Schritte in Richtung des großen Bruderstaates Indiens, mit dem sich sein Land in den 62 Jahren seit der Teilung im Zuge der Unabhängigkeit von Britisch-Indien dreimal auf dem Schlachtfeld gemessen und kein Mal dabei gewonnen hatte. Zardari und seinen Mitstreitern ist nicht entgangen, dass sich die USA und Indien seit 2001 immer mehr annähern, so dass Pakistan anscheinend ins Hintertreffen gerät.
Das Trauma der blutigen Teilung ist in den Köpfen präsent und wird weiterhin tradiert. Über 16 Mio. Menschen wurden seinerzeit zur Flucht gezwungen, bis zu 1 Mio. Opfer hatte der Ausbruch der Gewaltwelle beiderseits der neuen Grenzen gefordert. Viele Politiker beider Staaten stammen aus Familien der Vertriebenen, die Traumata warten noch immer auf eine offene Aufarbeitung. Neben dem geteilten Kashmir mit seiner muslimischen Bevölkerungsmehrheit wurden andere Regionen ebenfalls zerrissen, darunter das Fünfstromland (Punjab), die bevölkerungsreichste Provinz Pakistans. Die Ansätze zur Versöhnung zwischen beiden Staaten wurden regelmäßig von Konflikteskalationen seitens des pakistanischen Militärs sowie Extremisten auf beiden Seiten torpediert.
Gerade der Dauerkonflikt mit Indien prägte die Entwicklung Pakistans und führte zu jener Entwicklung, welche die Armee zum Staat im Staate werden ließ. Um im Wettrüsten mitzuhalten und die enormen finanziellen Folgen halsbrecherischer Prestigeprojekte wie der atomaren Aufrüstung und der waffenstarrenden Frontlinie in Kaschmirs Hochgebirgsregion abzusichern, wurden und werden andere Bereiche fatal vernachlässigt.
Trotzdem nähern sich beide Staaten vorsichtig an. Die von pakistanischem Gebiet aus koordinierten Terroranschläge im November 2008 führten zwar zu verbalem Schlagabtausch, aber nicht zu einer militärischen Eskalation. Hinter den Kulissen scheint einiges in Bewegung geraten zu sein; so nahm in diesem September der ISI-Chef Ahmad Shuja Pasha an einem vom indischen Hochkommissar gegebenen Festmahl anlässlich des Fastenbrechens im Ramadan teil.
Der Afghanistan-Faktor
Der anhaltende Konflikt in Afghanistan wirkt sich einerseits destabilisierend auf Pakistan aus, andererseits profitieren Teile des politischen Establishments und das Militär davon, schließlich werden sie als Verbündete gebraucht und hofiert. Gemäß der Fersenhalterstrategie (angelehnt an das Arthashastra des »indischen Machiavelli« Kautilya, 300 v.u.Z.) konkurrieren Indien und Pakistan um Einfluss in Afghanistan. Die Regierung von Präsident Karzai verfügt über gute Beziehungen zu Neu-Delhi und kritisiert deutlich die fortdauernde Existenz von Rückzugsgebieten der Taliban auf pakistanischem Staatsgebiet. Der verheerende Anschlag auf die indische Botschaft im Juli 2008 zeigt nach Ansicht Kabuls eine Verstrickung pakistanischer Sicherheitsdienste.
Außerdem verdienen, teils seit Jahrzehnten, viele Menschen in Pakistan an der Situation in Afghanistan: Sowohl der Großteil des Nachschubs für die Nato/ISAF-Truppen als auch ihrer Widersacher läuft über Pakistan. Hinzu kommt der alltägliche Schmuggel. Das Schutzgeld-Geschäft scheint so erträglich, dass es des Öfteren zu Kämpfen zwischen konkurrierenden Milizen kommt.
Die über Jahrzehnte gewachsenen grenzübergreifenden Vernetzungen zwischen den Djihadistengruppen bereiten auch außerhalb der Stammesgebiete (FATA) Probleme, wie es die Entwicklungen in der Nordwest-Grenzprovinz (NWFP) und in der Millionenstadt Peschawar zeigen, wo Nachschubdepots der Nato wiederholt angegriffen wurden und die einen wichtigen Knotenpunkt für terroristische Netzwerke darstellt. Angesichts dieser Bedrohung versuchen Afghanistan und Pakistan enger zu kooperieren, beispielsweise im Bereich der militärischen Aufklärung im gemeinsamen Grenzgebiet. Die US-Regierung hat zwar die Forderung der pakistanischen Verbündeten auf Überlassung von raketenbestückten Aufklärungsdrohnen abgelehnt, indessen eine engere Zusammenarbeit bei deren Nutzung angeboten. US-Amerikaner, Pakistanis und Afghanen arbeiten gemeinsam in einem lokalen Koordinationszentrum, in dem Aufklärungserkenntnisse ausgewertet werden. Allerdings ereignen sich trotz aller Kooperationsabsichten weiterhin kleinere militärische Zwischenfälle zwischen den Truppen der Beteiligten entlang der bis heute umstrittenen Grenzlinie.
Verhandlungen und Anti-Terrorkampf
In den letzten Jahren entwickelte sich die Nordwest-Grenzprovinz zu einem bedeutenden Nebenschauplatz im Kampf gegen islamistische Milizen. Im Februar 2009 unterzeichneten Vertreter der eher säkular-paschtunischen Awami National Party (ANP) geführten Provinzregierung und Maulana Sufi Mohammad, geistiger Führer der Scharia-Bewegung Tehrik-i-Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM), ein Friedensabkommen. Im Gegenzug wurde in den Distrikten Swat und Malakand sowie in angrenzenden Gebieten die Einführung des islamischen Rechts bei Zivil- und Strafrechtsfällen erlaubt. So hoffte man die Islamisten in einen »Friedensprozess« einzubinden. De facto war dies eine Anerkennung der bestehenden Situation, da die TNSM in den von ihnen dominierten Gebieten schon längst die Scharia gemäß ihrer eigenen Interpretation praktizierte. Im Gegenzug verpflichteten sich die Milizen, ihre Waffen abzugeben und die Exekutivgewalt wieder in die Hände der Polizei zu geben.
Die Befürworter des Abkommens betonten, dass durch die Einbindung des zentralen Scharia-Bundesgerichtshofs, der seit 1979 darüber wacht, dass die nationalen Gesetze der Islamischen Republik Pakistan nicht dem Koran widersprechen, eine Vereinheitlichung des Rechts gewährleistet wäre und etwaigen Exzessen vorgebeugt würde. Dadurch sei ein Konstrukt geschaffen worden, dass das Rechtsmonopol des Staates aufrechterhalte. Die Kritiker wiederum sahen darin eine signifikante Bedrohung und den Anfang vom Ende des pakistanischen Rechtstaates, dessen reguläre Gesetze nun für einen Teil der Bevölkerung nicht mehr gelten sollen.
Allerdings wurde bei dieser Diskussion verdrängt, warum gerade die islamische Rechtsprechung so eine Strahlkraft entwickeln konnte. Das bestehende Rechtssystem funktioniert vielerorts mehr schlecht als recht. Verfahren werden in die Länge gezogen, weshalb bei den zukünftigen Scharia-Gerichten eine Prozessdauer von höchstens sechs Monaten angestrebt wurde. Mittellose konnten sich bislang selten vor Gericht durchsetzen – einflussreiche Menschen erkauften sich ihren Sieg oder ihren Freispruch. Diese Missstände trugen neben Armut und dem Mangel an Entwicklungsperspektiven in dieser von der Zentralregierung vernachlässigten Region zur Unterstützung der TNSM bei.
Präsident Zardari stimmte diesem umstrittenen Abkommen persönlich zu. In den folgenden Wochen zeigte sich jedoch, dass die Jihadisten sich durch das Einknicken des Staates eher zu weiteren Aktionen ermutigt fühlten. Weder ließen sie die versprochene Wiederherstellung der staatlichen Ordnung in ihrem Gebiet zu noch gaben sie ihre Waffen ab. Als sie sahen, dass Politik und Militär sie weiterhin gewähren ließen, rückten sie in den Nachbardistrikt Buner vor – bis sie nur noch rund 80 Kilometer von der Hauptstadt Islamabad trennten. Erst jetzt stießen sie auf Widerstand. Derweil festigten sie ausgehend von Mingora, der größten Stadt im Swat-Distrikt, ihre Macht, zwangen der Bevölkerung ihre Regeln auf und rekrutierten neue Kämpfer. Beide Seiten schienen auf Zeit zu spielen, doch allmählich wurden die Entwicklungen dem politischen Etablissement und der Sicherheitsdienste zu unheimlich und zu kostspielig – im April begannen die Gotteskrieger lokale Bankfilialen und Firmen zu plündern.
Das Verhalten der Jihadisten kam der PPP-geführten Regierung zugute und sorgte so für Ablenkung von den latenten Machtkämpfen mit der oppositionellen PML-N. Während Präsident Zardari in der ersten Maiwoche dieses Jahres beim Washingtoner Dreiergipfel mit seinen Amtskollegen aus den USA und Afghanistan zusammentraf, erging daheim der Marschbefehl, um verlorenes Terrain zurückzuerobern. Nun sollte die Armee das Versagen der Politik richten.
Trotz der weitverbreiteten Vogel-Strauß-Politik und der beliebten Verschwörungstheorien, meist einhergehend mit einem latenten Anti-Amerikanismus, wuchs in der pakistanischen Gesellschaft offenbar die Erkenntnis, dass die bisherige Beschwichtigungspolitik nicht fruchtete. In der pakistanischen Presse fanden sich zunehmend selbstkritische Töne, wie die von Tariq Rahman, Direktor des Nationalinstituts für Pakistanstudien der Quaid-I-Azam Universität, der in einem Leitartikel der Tageszeitung Dawn deutlich aussprach, dass man selbst und nicht das Ausland seine eigenen »Frankensteins« kreiert hätte (Dawn, 14. Mai 2009).
Folgen der Armeeoffensiven
Es folgte eine militärische Eskalation, die in ihrer Intensität bisherige, oft eher halbherzige Aktionen in den Schatten stellte. Das Militär zählte rund 2.000 getötete Kämpfer – über zivile Opferzahlen schwieg es sich aus. Hunderttausende Menschen flohen aus der Region und verschärften das Binnenflüchtlingsproblem vehement. Landesweit wird von rund 2,5 Mio. Menschen ausgegangen, die größte Anzahl seit dem Drama der indisch-pakistanischen Teilung im Jahr 1947. Die Bewohner der Swat-Region werden auch nach dem Ende der Kampfhandlungen noch lange auf Hilfe angewiesen sein, da mindestens für diese Saison die Ernte ausfällt, Viehbestände dezimiert sind und die Infrastruktur zerstört ist.
Infolge der Offensive intensivierten islamistische Terrorgruppen landesweit ihre Aktionen, wobei sie auch in den Metropolen der bislang eher ruhigen östlichen Punjab-Provinz zuschlugen. Zwar rückte das Militär nun ebenfalls in den Stammesgebieten vor, konnte bislang jedoch nur kleinere Erfolge erzielen, weil die dortigen Milizen im Angesicht der Bedrohung enger zu kooperieren scheinen. Ob die gezielte Tötung des Anführers der Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) durch einen US-Raketenangriff im August eine mittelfristige Schwächung der Gegenseite bewirkt hat, ist zum jetzigen Zeit schwer einzuschätzen. Zumindest zeigte sich anhand der Meinungsverschiedenheiten über die zukünftige Strategien, dass es sich noch um Zweckbündnisse heterogener Akteure handelt.
Angesichts dessen und der bislang begrenzten militärischen Erfolge ist zu erwarten, dass wieder jene Fraktion aus Geheimdienst und Militär Aufwind erfährt, welche die abwartende Taktik des Ausspielens einzelner Gruppierungen gegeneinander einer Fortführung der Militäroffensive mit ebenfalls ungewissem Ausgang vorzieht. Eine wirkliche Strategie zur Befriedung der Stammesgebiete ist derzeit nicht erkennbar, zumal hier ein nahezu unvereinbares Interessengeflecht von internationalen, regionalen, nationalen und lokalen Akteuren mit konträren Ideologien und Partikularinteressen involviert ist. Falls sich dies in Zukunft ändern sollte, wären Werkzeuge einer Konfliktbearbeitung hilfreich, die auf traditionelle, lokale Verfahren setzen, insbesondere auf Stammesversammlungen (jirgas). Doch unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen scheint dies kaum umsetzbar.
Der Krisenstaat Pakistan wird noch lange nicht zur Ruhe kommen. Weite Teile des politischen Establishments, der Geheimdienste und des Militärs sind die Säulen dieses oligarchischen Systems, das gesellschaftliche Demokratisierung und gerechte Entwicklung nicht zulässt – für zu Viele lässt es sich mit dem Tanz auf dem Vulkan gut leben.
Literatur
Pfeffer, Georg (2008): Der Problemfall Pakistan. Verdrängung als Politik, suedasien.info, 08. September 2008, http://www.suedasien.info/analysen/2556 [download 28. September 2009].
Rashid, Ahmed (2009): Descent into Chaos. Pakistan, Afghanistan and the Threat to Global Security. London: Penguin Books.
Rahman, Tariq (2009): A Cobweb of Myths, Dawn, 14. Mai 2009, http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/11-a-cobweb-of-myths-04 [download 28. September 2009].
Siddiqa, Ayesha (2007): Military Inc. Inside Pakistan’s Military Economy. London: Pluto Press.
Peer Bruch ist Geschäftsführer des Südasien-Informationsnetz e.V. in Berlin und Redaktionsmitglied bei suedasien.info; er hat Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin studiert.