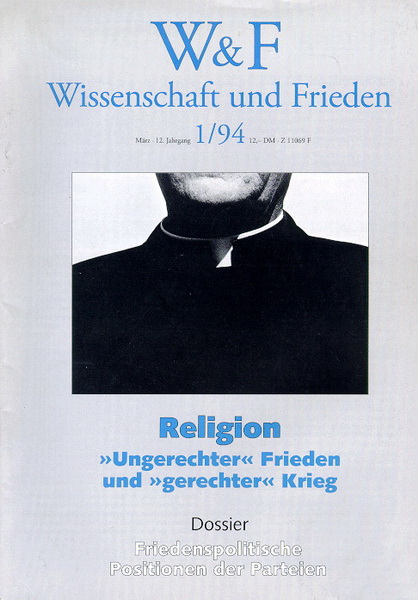Bundeswehr in Somalia
Meilenstein neuer deutscher Machtpolitik
von Volker Böge
Nun sind sie wieder zu Hause, die Helden von Belet Huen. Mit Glück sind sie ohne deutsche Verluste zurückgekehrt. In der Heimat werden sie jetzt vom Verteidigungsminister und der Bundeswehrführung in markigen Reden gefeiert. Und unsere Regierung wird ihren Einsatz den Bürgerinnen und Bürgern als »vollen Erfolg« verkaufen. Doch was sind die Maßstäbe einer solchen Erfolgsmeldung?!
T<>rotz allen »humanitären« Geredes, trotz aller vollmundig bekundeten Sorge um das Wohlergehen der Menschen und um die Wiederherstellung des Friedens in Somalia liegt der tatsächliche »Erfolg« dieser Mission darin, daß es der Bundesregierung gelungen ist, Deutschland als Militärmacht auf der Bühne internationaler Politik zurückzumelden: Wir sind wieder wer – auch militärisch. Das ist die Botschaft des Somalia-Einsatzes nach außen. Und innenpolitisch ist ein weiterer Schritt getan, die deutsche Öffentlichkeit an weltweite Einsätze der Bundeswehr zu gewöhnen, Akzeptanz und Legitimation für deutsche Streitkräfte zu beschaffen, die sich jenseits des ursprünglichen Auftrags der Landesverteidigung völlig neuen Aufgaben zuwenden. In einer Zeit der Weichenstellung, in der es um die künftige Gestalt des neuen vereinigten Deutschland und um seine Rolle in der Welt geht, ist mit dem Bundeswehr-Einsatz in Somalia ein falsches Signal gesetzt worden. »Somalia« war ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Militarisierung der deutschen Außenpolitik.
Damit reiht sich diese Mission als bisher umfassendster Auslandseinsatz der Bundeswehr ein in die Kette jener Einsätze, mit denen gemäß einer »Salamitaktik« die bisherigen Beschränkungen der Verwendung deutschen Militärs nach und nach überwunden werden sollen.
Somalia ist aber nur die vorerst letzte – und bedeutendste – Station in diesem Prozeß. Die vorausgegangenen Stationen seien an dieser Stelle kurz in Erinnerung gerufen.
Golfkrieg II
Der Startschuß zur »salamitaktischen« Ausweitung des Operationsradius der Bundeswehr fiel im Zusammenhang mit dem Golfkrieg II. Zwar sah sich etablierte Politik damals noch an das verfassungsmäßige Verbot von Einsätzen »out-of-area« gebunden, doch eröffnete sich jetzt die Chance, unter Verweis auf die Forderungen der Bündnispartner, die die deutsche militärische Zurückhaltung kritisierten, die Grenzen für Bundeswehr-Einsätze hinauszuschieben.
Faktisch erweiterte man den Handlungsraum der Bundeswehr, interpretierte die Bundeswehr-Einsätze aber nach wie vor restriktiv, um behaupten zu können, es handle sich nicht um (verfassungsmäßig als verboten geltende) Einsätze »out-of-area«. Im einzelnen ergriff man folgende Maßnahmen:
- Einheiten der Bundesmarine wurden im August 1990 ins östliche Mittelmeer verlegt, wo sie Aufgaben von US-Kriegsschiffen übernahmen, die im Rahmen des Aufmarsches gegen den Irak in den Persischen Golf abgezogen worden waren (also ein Einsatz »in area«, aber in klarem Zusammenhang mit dem Golfkrieg »out-of-area«);
- im Rahmen der »Allied Mobile Force« der NATO wurden im Januar 1991 Luftabwehr- und Luftwaffeneinheiten (18 Alpha Jets) in den Südosten der Türkei verlegt, um der Türkei bei einem etwaigen Angriff des Irak beizustehen (»in area«, aber noch klarer im Zusammenhang mit dem Krieg »out-of-area«: von türkischen Basen aus starteten Kampfflugzeuge der Alliierten zu Angriffen auf den Irak, indirekt waren deutsche Soldaten mithin an Kampfhandlungen beteiligt);
- während des Krieges gegen den Irak beteiligten sich im Rahmen des Einsatzes von AWACS-Radarflugzeugen der NATO auch Bundeswehrsoldaten an der Luftraumüberwachung und Feuerleitplanung im Luftkrieg gegen den Irak (eindeutig »out-of-area«, wurde daher auch der deutschen Öffentlichkeit verheimlicht und kam erst im Januar 1993 an den Tag);
- zur Versorgung von kurdischen Flüchtlingen aus dem Irak im Iran wurden Bundeswehr-Transporthubschrauber eingesetzt (begründet als »humanitärer Einsatz«, aber im Zusammenhang mit den Kriegshandlungen);
- unmittelbar nach Beendigung der Kampfhandlungen beteiligten sich Einheiten der Bundesmarine von März bis Juli 1991 am Minensuchen und -räumen im Persischen Golf (eindeutig »out-of-area«, aber als »humanitäre Hilfe« deklariert);
- zur Unterstützung von UN-Inspektionen im Irak nach dessen Niederlage wurden (und werden noch) seit dem Oktober 1991 Heeresflieger der Bundeswehr eingesetzt (eindeutig »out-of-area«, doch wurden die Soldaten kurzerhand zu »experts on mission« erklärt und bekamen damit als Sachverständige der UN mit »abrüstungsspezifischen« Aufgaben einen Sonder-Status).
Kambodscha
Die nächste Station war Kambodscha. Von Mai 1992 bis November 1993 waren 150 Bundeswehr-Sanitätssoldaten im Rahmen der UN-Mission UNTAC in Kambodscha eingesetzt (ein Vorauskommando schon seit November 1991). Und obgleich sie in Zusammenarbeit mit den Blauhelmen anderer Staaten tätig waren, für deren sanitätsdienstliche Versorgung sie zuständig waren, traten sie nicht als UN-Blauhelme auf – waren also auch nicht dem UN-Kommando im Lande unterstellt – sondern agierten wiederum unter dem Etikett »humanitärer Einsatz«. In Kambodscha kam am 14.10.1993 der erste Bundeswehr-Soldat, der Sanitätsfeldwebel Alexander Arndt, »out-of-area« gewaltsam zu Tode. Verteidigungsminister Rühe hatte den Einsatz im Sommer 1992 nicht nur als Vorstufe für »generelle Blauhelm-Missionen« der Bundeswehr bezeichnet und eingeräumt, daß er mit der Kambodscha-Entscheidung an die Grenze der Verfassung gegangen sei, sondern auch klargestellt, daß sich die deutsche Öffentlichkeit an tote deutsche Soldaten gewöhnen müsse. Der Tod eines Soldaten gehöre zur „Normalität“, auf die er die BundesbürgerInnen Schritt für Schritt vorbereiten müsse (Die Zeit, 10.7.1992).
Jugoslawien
Seit Juli 1992 beteiligt sich die Bundeswehr zur Unterstützung der UN an Hilfsflügen nach Sarajewo (begründet als »humanitäre« Aktion) und an der Überwachung des über Serbien und Montenegro verhängten Embargos durch Marineeinheiten der NATO und der WEU in der Adria. Letzteres wurde als noch gerade verfassungskonform dargestellt, weil die Schiffe der Bundesmarine nur »überwachen« sollen, nicht aber – wie die Schiffe der anderen beteiligten Staaten – Embargobrecher auch mit Gewalt aufbringen sollen. Seit Oktober 1992 schließlich sind auch deutsche Soldaten in den AWACS-Flugzeugen der NATO dabei, die das von den UN über Bosnien-Herzegowina verhängte Flugverbot überwachen sollen. Im März 1993 wurde dieser Auftrag ausgeweitet: seither geht es nicht mehr nur um die Überwachung, sondern auch um die militärische Durchsetzung des Flugverbots. Die AWACS-Maschinen sind nun nicht mehr allein zur Beobachtung da, sondern wenn nötig auch zur Feuerleitung (wie im Krieg gegen den Irak). Das deutsche Bodenpersonal und die deutschen Soldaten an Bord der Maschinen können also direkt an Kampfeinsätzen beteiligt sein.
Selbst der FDP kamen jetzt verfassungsmäßige Bedenken. Politisch war sie zwar für diesen Einsatz, wollte aber eine rechtliche Klarstellung. Daher reichte sie – ebenso wie die SPD – Klage beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ein und beantragte eine einstweilige Verfügung gegen die deutsche Beteiligung am AWACS-Einsatz. Das Gericht lehnte am 8.4.1993 den Antrag auf einstweilige Verfügung ab und verwies auf eine spätere Entscheidung in der Hauptsache. Bei der Begründung folgte es im wesentlichen den Argumenten der Bundesregierung: Ohne die deutsche Beteiligung sei die Einsatzfähigkeit der AWACS und damit die Durchsetzung des Flugverbots gefährdet. Das wiederum würde zu einem Vertrauensverlust bei den Bündnispartnern in bezug auf die deutsche Zuverlässigkeit führen und somit erheblichen außenpolitischen Schaden verursachen (siehe hierzu das Bundesverfassungsgerichtsurteil in W&F, 3/93, Dossier 14).
Somalia
Derart vom Verfassungsgericht bestärkt, ging die Bundesregierung in das bisher größte »out-of-area"–Abenteuer: den Einsatz von 1700 Bundeswehrsoldaten in Somalia seit Juli 1993 (ein Vorauskommando war schon im Mai in Belet Huen eingetroffen). Auch hier hat die Bundeswehr angeblich wieder eine »humanitäre Aufgabe« und keinen »militärischen Einsatz« auszuführen; allerdings sind die Soldaten zum »Selbstschutz« bewaffnet, und die ausschließlich zum »Selbstschutz« vorgesehenen Einheiten des Kontingents machen einen erheblichen Teil der Truppe aus. Solche bewaffneten »humanitären« Einsätze haben nichts mehr zu tun mit dem, was früher unter »humanitärem Einsatz« verstanden wurde: Hilfe bei Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen usw. Der Übergang zum Kampfeinsatz – verharmlosend als »humanitäre Intervention« bezeichnet – verschwimmt.
Fast genau 50 Jahre nach der Vertreibung des hitlerdeutschen Afrika-Korps aus Nordafrika durch die alliierten Truppen stand also erstmals wieder ein größeres Kontingent von deutschen Soldaten in Afrika. Sie beteiligen sich an einem UN-Einsatz, der zwar begonnen wurde mit dem Argument, der notleidenden somalischen Bevölkerung Hilfe leisten zu wollen, der sich aber mittlerweile zum Kriegseinsatz entwickelt hat. UN-Soldaten haben in Somalia Hunderte von Menschen getötet – und wurden zu Dutzenden getötet. Die somalische Bevölkerung steht mittlerweile der UN-Präsenz größtenteils ablehnend gegenüber. Denn UN-Einheiten führen sich auf wie Besatzer aus Kolonialtagen. Überhebliches Auftreten, Repressionen und Schikanen gegen die Zivilbevölkerung, ja sogar Folterungen von Zivilisten, militärische Racheakte und Vergeltungsschläge sowie massive militärische Parteinahme im Bürgerkrieg – so haben sich die Somalis die »humanitäre Hilfe« nicht vorgestellt. „Die UNO-Streitmacht ist zur Besatzungsmacht geworden, die auch vor Massakern nicht zurückschreckt – und so die Rebellion erst recht schürt“ schrieb der Spiegel am 20.9.1993.
In diesem Zusammenhang hat auch der Bundeswehr-Einsatz in Somalia keinen humanitären Charakter. Mit ihrer Beteiligung an der UN-Mission hat die Bundeswehr vielmehr erstmals in großem Maßstab die Grenze zu Kampfeinsätzen »out-of-area« faktisch überschritten – trotz aller anderslautenden Erklärungen aus den Reihen der Regierung. Sollte doch die wesentliche Aufgabe des deutschen Kontingents die Versorgung anderer Blauhelm-Einheiten sein, die für die »Befriedung« weiterer somalischer Landesteile eingesetzt werden sollten. Die deutschen Truppen sollten also direkt kampfunterstützend tätig werden. Ironie der Geschichte: Jenes Kontingent von 4500 indischen Blauhelm-Soldaten, welches die 1700 Deutschen unterstützen sollten, kam gar nicht. Es kamen ganze drei Inder anstelle der erwarteten indischen Brigade (siehe hierzu W&F, 3/93, Dossier 14). Folge: die deutschen Soldaten mußten nutz- und sinnlos monatelang die Zeit in ihrem Camp totschlagen. Daß sie zusätzlich auch gewisse Hilfsleistungen für die Bevölkerung vor Ort erbrachten, geschah eher zufällig, weil ihr eigentlicher Auftrag entfallen war. Und schließlich haben auch deutsche Soldaten auf Somalis geschossen – und getötet.
Daß es nicht um »humanitäre Hilfe« ging, wird auch an folgendem deutlich: Die UNO hatte im Vorfeld des Einsatzes der Bundesregierung vorgeschlagen, die Bundeswehr solle im Hafen von Mogadischu die Verladung von Gütern und Ausrüstungen übernehmen. Das lehnte Verteidigungsminister Rühe mit dem Argument ab, seine Soldaten seien keine Schauerleute. Für einen so unattraktiven und wenig öffentlichkeitswirksamen Einsatz stehe man nicht zur Verfügung. Stattdessen wurde vom BMVg ein umfassenderer und öffentlich wirksamer Einsatz der Bundeswehr gefordert – woraufhin die 1700 deutschen Soldaten nach Belet Huen kamen.
Das Argument der Hilfe für notleidende Menschen muß also als vorgeschoben bewertet werden. Wäre es tatsächlich um Hilfe gegangen, dann wäre anderes vonnöten gewesen als die Entsendung von Soldaten. Unter dem Aspekt der Hilfe ist deren Anwesenheit in Somalia sinnlos – und Geldverschwendung dazu. Ginge es doch darum, die Infrastruktur des Landes wiederaufzubauen, um die materiellen Grundlagen für einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Dazu würden zivile Experten benötigt, dazu bräuchte es finanzielle Unterstützung und dazu bedürfte es der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Die 360 Mio. DM, die der Bundeswehr-Einsatz in Somalia bisher gekostet hat, hätten sehr viel sinnvoller für zivile Zwecke eingesetzt werden können. Die humanitären Nebenprodukte der militärischen Somalia-Mission sind sehr teuer bezahlt, zivile Hilfsorganisationen hätten sehr viel besser und billiger gearbeitet. Es ist beschämend, daß erst mit der Entscheidung für den Abzug der Bundeswehr aus Somalia vom Dezember 1993 auch beschlossen wurde, einen kleinen Bruchteil der für das militärische Abenteuer verausgabten Gelder nun auch für zivile Hilfe bereitzustellen – gewissermaßen als »Nachschlag« zum militärischen Einsatz – , wo doch schon lange vor der Entsendung der Bundeswehr nach Somalia von Oppositionspolitikern und zivilen Hilfsorganisationen humanitäre Hilfe für Somalia gefordert worden war – vergeblich. Die Bundesregierung hatte diese Ansinnen immer wieder zurückgewiesen, ebenso wie sie die z.T. massive Kritik der Hilfsorganisationen am Militäreinsatz ignorierte.
Doch um wirksame Hilfe ging es nicht. Es ging darum, die Öffentlichkeit im eigenen Land an den Anblick deutscher Soldaten in diversen Weltgegenden zu gewöhnen und dafür Akzeptanz zu schaffen. Und es ging darum, der Weltöffentlichkeit zu demonstrieren, daß die Deutschen »wieder da« und bereit und in der Lage sind, auch militärisch wieder mitzumischen. (Das heißt aber auch: Es ging auch nicht um deutsche »imperialistische« Interessen in Somalia selbst; vielmehr waren es innen- und bündnispolitische Interessen).
Das BVerfG hat auch im Fall Somalia wieder mitgespielt. Eine Klage der SPD-Fraktion gegen den Somalia-Einsatz und ihr Antrag auf einstweilige Anordnung wurden im Juni 1993 abgelehnt. Lediglich einen Beschluß des Bundestages für den Somalia-Einsatz verlangten die Verfassungsrichter. Dieser Beschluß kam am 2. Juli 1993 mit den Stimmen der Regierungsmehrheit zustande. Zwar steht noch eine endgültige Entscheidung des BVerfG über die Somalia-, AWACS- und Adria-Klagen (die zu einem Verfahren zusammengefaßt werden) aus, doch muß nach dem bisherigen Verhalten des Gerichts befürchtet werden, daß diese im Sinne der Regierung ausfallen wird.
Der Streit ums Grundgesetz
Jedenfalls zeigten sich Regierung und Bundeswehr-Führung mit den bisherigen Verfassungsgerichtsentscheidungen hochzufrieden und feierten sie öffentlich als politischen Sieg. Gleichwohl streben die Regierungsparteien nach wie vor eine Änderung des GG an, um im eigenen Sinne Klarheit zu schaffen. Man will nicht noch lange Zeit weiter wie bisher »herumeiern« müssen und immer wieder die Begründung »humanitärer Einsatz« strapazieren müssen, wenn man die Bundeswehr in die weite Welt hinausschickt. Sondern man möchte klar sagen dürfen, was man tut und was man will: Mitkämpfen. Eine »klarstellende Ergänzung« des GG wird daher gewünscht.
Das erscheint notwendig, weil die Selbstbeschränkung deutscher Macht in der alten Bundesrepublik auch im GG ihren Niederschlag gefunden hatte. Erinnert sei nur an die GG-Artikel 26 (Verbot des Angriffskriegs), 24 (Einbindung in ein System kollektiver Sicherheit), 87a (Aufstellung von Streitkräften ausschließlich zur Verteidigung) und 115a (Feststellung des Verteidigungsfalles bei Angriff auf das Bundesgebiet mit Zweidrittelmehrheit des Bundestages). Die herrschende Meinung in Recht und Politik legte jahrzehntelang diese Artikel so aus, daß die Bundeswehr lediglich im Bündnisfall zur Verteidigung in dem sog. NATO-Vertragsgebiet (Europa, Nordamerika und Nordatlantik bis zum Wendekreis des Krebses) eingesetzt werden dürfe. Außerhalb dieses NATO-Vertragsgebiets – »out-of-area« – sei ein militärischer Einsatz der Bundeswehr verfassungsrechtlich nicht statthaft. Diese Position wurde in einem Beschluß des Bundessicherheitsrats vom 3.11.1982 eindeutig fixiert und in der Folge von den Bundesregierungen und allen großen Parteien als bindend bestätigt. Immer wieder erklärten bis Anfang der 90er Jahre deutsche Regierungen den Bündnispartnern und der eigenen Öffentlichkeit mit Verweis auf diese GG-Interpretation, daß eine Teilnahme deutscher Streitkräfte an Einsätzen »out-of-area« nicht möglich sei.
Allerdings muß man hier einschränkend klar unterscheiden zwischen militärischem »Einsatz« und sonstigen »Verwendungen« von Bundeswehrsoldaten in aller Welt. „Einsatz bedeutet Verwendung der Streitkräfte als Mittel der vollziehenden Gewalt … Eine gewaltneutrale Verwendung ist kein Einsatz i.S. des Art. 87a Abs. 2 GG. Verwendungen der Streitkräfte ausschließlich im Rahmen logistischer Operationen, Unterstützung öffentlicher Dienste, allgemeiner Katastrophenhilfe oder humanitärer Einsätze unterliegen nicht dem verfassungsrechtlichen Vorbehalt“ (so eine Studie aus dem Bundesverteidigungsministerium vom 16.10.1987). In „Verwendung“ befanden und befinden sich deutsche Soldaten im Rahmen deutscher Ausstattungs- und Ausbildungshilfe in zahlreichen Ländern der sog. Dritten Welt, auch in diversen diktatorisch regierten und/oder sich im (Bürger-)Krieg befindlichen: Sudan, Marokko, Burundi, Mali, Kolumbien, … usw.. Sie sind dort als Ausbilder, beim Straßenbau, in der KFZ-Instandsetzung und der sanitätsdienstlichen Versorgung usw. tätig. Ebenso üblich war es schon seit den 60er Jahren, daß die Bundeswehr bei Erdbeben oder anderen Naturkatastrophen in der sog. Dritten Welt half, was als »humanitärer Einsatz« galt (Beispiele: Hochwasserkatastrophe in Algerien und Tunesien 1970, Hungerkatastrophe im Sudan 1985, Erdbeben in Armenien 1988).
Jetzt, da es für Deutschland um den Einstieg in eine neue Phase weltweiter Machtpolitik geht und Einschränkungen militärischer Möglichkeiten fallen sollen, ist die alte GG-Interpretation selbstverständlich ein gewichtiger Klotz am Bein. Daher die Bestrebungen der Parteien der Regierungskoalition, das GG bzw. die herrschende Interpretation des GG zu ändern.
Am 13. Januar 1993 legte die Regierungskoalition einen Antrag vor, wonach die Bundeswehr künftig sowohl im Rahmen der UNO bei »friedenserhaltenden« und »friedensherstellenden« Maßnahmen als auch unabhängig von der UNO „im Rahmen von regionalen Abmachungen“ oder „gemeinsam mit anderen Staaten“ »out-of-area« eingesetzt werden dürfen soll. Letztlich sollen mithin alle Einsatzformen erlaubt sein, wenn sie nur »multinational« sind, d.h.: lediglich deutsche Alleingänge »out-of-area« sollen ausgeschlossen bleiben.
Die FDP-Position war bis zu diesem Zeitpunkt etwas moderater gewesen. Sie wollte nur Aktivitäten »out-of-area« im Rahmen der UNO erlauben (»friedenserhaltende« und »friedensherstellende« Maßnahmen). Damit berührte sich ihre Position mit der einer Minderheit in der SPD, die ebenfalls bereits seit 1988 für die Beteiligung der Bundeswehr an friedenserhaltenden und friedensschaffenden UN-Maßnahmen eintritt. Diese Position ist aber bis heute in der SPD (noch) nicht mehrheitsfähig, obgleich so exponierte SPD-Politiker wie Klose, Voigt, Gansel, Bahr sie vertreten. Noch auf dem SPD-Parteitag in Münster 1988 hatte sich die Mehrheit gegen jegliche »out-of-area"–Einsätze ausgesprochen. Auf dem Parteitag in Bremen 1991 war die Mehrheit schon für Einsätze lediglich im Rahmen sehr eng definierter Blauhelm-Aufgaben. Seit dem Parteitag 1992 will sie allerdings den Aufgabenbereich von Blauhelmen umfassender verstanden wissen. Dazu sollen nun auch gehören: Die Sicherung von Hilfskonvois und der Schutz von UNO-Mandatsgebieten sowie die Durchsetzung von Embargo- und Blockademaßnahmen – Aufgaben, deren Bewältigung den fließenden Übergang zu Kampfhandlungen beinhalten kann. Dieses Votum für eine Beteiligung an weitgefaßten Blauhelm-Einsätzen ist gegenwärtig offizielle Position der SPD. Den Parteien der Regierungskoalition ist das immer noch zu wenig. Sie lehnen eine »Nur-Blauhelm«-Änderung des GG ab, weil deutscher Politik damit die Hände gebunden würden.
Da für eine GG-Änderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, die Regierungsparteien sich also mit der SPD einigen müssen, kommt das Unternehmen GG-Änderung solange nicht voran, wie die SPD auf dieser Position verharrt. Umgekehrt argumentiert die SPD, man könne in der out-of-area-Frage einen großen Schritt weiter kommen, wenn die Regierungsparteien von ihren Maximalpositionen abgehen würden und sich auf die Position der SPD einließen. Bündnis 90/Die Grünen und die PDS lehnen jegliche GG-Änderung zur Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr ohnehin ab (allerdings hat die BT-Gruppe von Bündnis 90 im Bundestag einen Antrag eingebracht, der die Beteiligung der Bundeswehr an Blauhelm-Einsätzen möglich machen soll).
Das immer wieder von der Regierungsseite angeführte Argument übrigens, als UN-Mitglied müsse Deutschland neben den Rechten auch »alle Pflichten« einer Mitgliedschaft tragen (sich also auch an Militäraktionen der UNO beteiligen), ist fadenscheinig: „Es gibt eine Vielzahl von Staaten, die keine militärischen Beiträge liefern können oder wollen. Es gibt Staaten, die können das gar nicht, weil sie finanziell nicht dazu in der Lage sind. Es gibt Staaten, die haben gar keine Soldaten. Es gibt Staaten, denen verbietet das die Verfassung“ (D. Deiseroth, zit.n.: Bundeswehr in alle Welt? Eine Argumentationshilfe. 2.überarbeitete Auflage, hg.v. Netzwerk Friedenskooperative. Bonn o.J., S. 7). Auch Deutschland könnte von den UN nicht gezwungen werden, gegen seine eigene Verfassung zu verstoßen.
Blauhelme – harmlos?
Gerade in jüngster Zeit hat sich gezeigt, daß selbst die auf den ersten Blick »harmloseste« Einsatzform, nämlich das peace keeping durch Blauhelme, friedenspolitisch bedenkliche Seiten hat. Zweifellos: Blauhelme bei UN-Friedensmissionen, die ausdrücklich nicht für militärische Aufgaben im Sinne kriegerischer Aktionen vorgesehen waren, haben vielfach einen wichtigen Beitrag zur Friedenssicherung geleistet. Gegenwärtig verwischt sich jedoch die Rolle der Blauhelme, die in der Charta der UN ohnehin nicht festgelegt ist. So wünschenswert der deeskalierende Einsatz von Blauhelmen zur Überwachung von Waffenstillständen usw. auch sein mag, so groß ist doch auch die Gefahr des fließenden Übergangs von derartigen »friedenserhaltenden« Aktivitäten zu Kampfeinsätzen. Gerade die jüngste Diskussion über Kampfeinsätze von Blauhelmen in Bosnien und die realen Kämpfe in Somalia weisen darauf hin, wie leicht sich Blauhelme in Weltpolizisten verwandeln können. Schon einmal, Anfang der 60er Jahre im damaligen Kongo, hat sich das, was als Blauhelm-Einsatz begann, zu einem umfassenden Krieg unter Beteiligung der UN-Truppen auf der Seite einer der Kriegsparteien ausgewachsen. Eben dieses geschieht heute wieder in Somalia. Auch hier sind die Blauhelme wieder zur Kriegspartei geworden. Statt systematisch den dortigen Konflikt zu dämpfen, wurde er ständig in seiner Gewalthaftigkeit gesteigert.
Interessenpolitik
Diese Gefahr einer Eskalation von anfangs »harmlosen« Blauhelm-Einsätzen zu Kriegseinsätzen ist immer dann besonders groß, wenn sich Streitkräfte militärisch starker und weltpolitisch bedeutender Staaten an den friedenserhaltenden Aktionen beteiligen. Denn diese Staaten verfolgen i.d.R. eigene Interessen, und vor allem: sie sind militärisch zur Eskalation fähig (und sehen sich dazu manchmal »gezwungen«, z.B. wenn Mißerfolge der eigenen Truppen zum Anlaß genommen werden, »Stärke« zu demonstrieren und »richtig« zuzuschlagen). Deswegen stellten früher auch bevorzugt kleine, neutrale Staaten (Österreich, Finnland, Fidschi, Nepal,…) Blauhelm-Kontingente. In jüngster Zeit aber besteht die Tendenz – siehe Somalia oder ehemaliges Jugoslawien – großer Mächte, Streitkräfte zu den friedenserhaltenden Aktionen abzustellen und sie damit auch zu dominieren. Blauhelme werden gegenwärtig immer mehr zur Interventionstruppe der G7 (der Gruppe der sieben reichsten Staaten), die weitgehend die Politik des Sicherheitsrates der UN bestimmen. Wer also die Erhaltung deeskalierender Blauhelme wünscht, muß die Großmächte heraushalten.
Auch Deutschland ist eine Großmacht, auch für eine Bundeswehr-Beteiligung an den Blauhelmen gelten also die obigen Einwände – einmal ganz davon abgesehen, daß deutsche Soldaten in weiten Teilen der Welt aus historischen Gründen ohnehin kaum als Friedensstifter begrüßt werden würden. Die angemessene Hilfe von Staaten wie Deutschland bestünde in zivilen, also in finanziellen und diplomatischen Beiträgen für die Friedensaktionen der UN. Die Blauhelme brauchen keine Bundeswehr-Kontingente. (Hier geht es wohlgemerkt um die direkte Beteiligung von Bundeswehr-Einheiten an Blauhelm-Einsätzen, nicht um finanzielle oder logistische Unterstützung. Die hat die Bundeswehr für »peace-keeping-operations« schon mehrfach geleistet, z.B. hat sie 1974 ghanesische und senegalesische Blauhelm-Soldaten nach Kairo transportiert, 1978 norwegische Soldaten nach Tel Aviv gebracht sowie dem nepalesischen Blauhelm-Kontingent Bundeswehr-LKWs usw. geliefert und sogar fachliche Einweisung durch deutsche Soldaten vor Ort durchgeführt).
Was aus einem friedenspolitischen Blickwinkel als große Gefahr erscheint – der fließende Übergang von friedenserhaltenden Maßnahmen zu Kampfeinsätzen –, das wird von der Regierungspolitik gerade gewollt und als Argument gegen eine »künstliche Trennung« beider Einsatzformen angeführt: Die Erfahrung habe gezeigt, daß man »peace-keeping« und »peace-enforcing« oft nicht trennen könne. Deswegen mache es auch keinen Sinn, die Beteiligung der Bundeswehr nur auf »peace-keeping« zu beschränken wie es die SPD fordere. Die SPD ihrerseits hält zwar an der Unterscheidung fest, kommt obiger Argumentation aber entgegen, indem sie den Aufgabenbereich der Blauhelme immer umfassender verstanden wissen will (s.o.). »Robustes peace keeping« ist die verharmlosende Bezeichnung für den Übergang von den alten Blauhelm-Einsätzen zu den qualitativ neuen, die sich von Kampfeinsätzen, also Kriegführung, nicht mehr unterscheiden.
Die Friedensbewegung tut also gut daran, eine Beteiligung der Bundeswehr an Blauhelm-Aktionen abzulehnen.
Eine deutsche Beteiligung an den Blauhelmen stellt ohnehin lediglich den Türöffner für weitergehende Einsatzformen dar. Denn wenn man einmal die Notwendigkeit der Übernahme militärischer »Verantwortung« akzeptiert hat, ist die Begründung für die Verweigerung des nächsten Schrittes schwer zu vermitteln. Daraus resultiert die große politische Bedeutung des eher klein anmutenden Schrittes einer Zustimmung zu Blauhelm-Einsätzen der Bundeswehr.
Keine Illusionen über die UNO
Von jenen Kräften, die eine Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr betreiben, wird die Blauhelm-Option so stark betont, weil man auf den guten Ruf der UNO als »Friedensmacht« in der Öffentlichkeit spekuliert. Doch sollte man sich keine Illusionen über den gegenwärtigen Charakter der UNO machen. Die UNO ist von den Interessen und Entscheidungen der großen nordwestlichen Mächte, der G7, abhängig. Ob die UN in einen Konflikt militärisch »friedenschaffend« oder »-erzwingend« eingreift oder nicht, hängt von den G7 ab. Nur sie – und hier insbesondere die USA – können die finanziellen und militärischen Mittel für ein solches Eingreifen bereitstellen, und andererseits können sie mit ihrem Veto im Sicherheitsrat ein solches Eingreifen verhindern, wenn es nicht in ihrem Interesse liegt. Sie werden sich der UNO mithin von Fall zu Fall bedienen, sich aber für den Fall, daß das einmal nicht möglich sein sollte, auch die Möglichkeit offenhalten, an der UNO vorbei militärisch aktiv zu werden.
Daß sich in absehbarer Zeit an der beherrschenden Stellung der G7 im UN-System etwas ändern ließe, ist nicht absehbar. Deswegen sind die UN auch nicht als Garant einer neuen gerechten und friedlichen Weltordnung für etablierte Politik in Deutschland interessant, sondern als Institution traditioneller Machtpolitik (neben anderen wie NATO, WEU und EU). Weil man auf der Bühne der Weltpolitik stärker präsent sein will und sie stärker mitgestalten will, drängt man auch auf verstärktes Engagement in den UN. Die Rede von der UNO im heutigen Deutschland muß also in den Zusammenhang der Rede über militärisch abgestützte deutsche Machtpolitik gestellt werden. Es geht herrschender Politik nicht um die Stärkung der UNO als alternative Weltfriedensorganisation an sich, sondern um deutsches Ausgreifen in die Weltpolitik – und erst in diesem Zusammenhang wird die UNO für herrschende Politik interessant: zur innenpolitischen Legitimation eigener Ambitionen (Militärinterventionen im Namen der UNO lassen sich den eigenen Bürgerinnen und Bürgern wegen des hohen Ansehens der UNO leichter verkaufen) und als Handlungsrahmen für eigene Machtentfaltung. Der Somalia-Einsatz der Bundeswehr und andere »out-of-area« – Aktivitäten sind nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß Deutschland Anspruch auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat anmeldet. Die offizielle Bewerbung um einen solchen Sitz gab die Bundesregierung übrigens einen Tag nach der Entscheidung über den Somalia-Einsatz im Juni 1993 im UN-Hauptquartier in New York ab! Damit will Deutschland auch offiziell (wieder) in den Kreis der Weltmächte aufgenommen werden. Der Spiegel sprach es aus: „Der schöne Traum von der Rückkehr Deutschlands in die Weltpolitik (ist) der eigentliche Grund des Somalia-Einsatzes“ (19.7.1993, S. 21) – wobei es sich eher um einen Alptraum denn um einen »schönen Traum« handelt.
Worum es etablierter Politik in Deutschland heute letztlich geht, ist: künftig weltweite Machtpolitik auch militärisch abstützen zu können. In den Verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundesregierung vom 26. November 1992 wird militärischer Macht u.a. die Aufgabe zugewiesen: „Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung.“ Das sind Töne, die man durchaus als imperialistisch bezeichnen kann.
Militarisierung der deutschen Außenpolitik
Der Trend zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik ist unverkennbar (und mit dem Schäuble-Vorstoß vom Jahresende 1993, der auf die Zuweisung zusätzlicher Aufgaben für die Bundeswehr im Inneren abzielt, ist darüber hinaus die Perspektive einer Militarisierung auch der Innenpolitik eröffnet). Zwar ist die BRD in den letzten Jahrzehnten recht erfolgreich gewesen mit einer Politik der nicht militärisch, sondern vor allem wirtschaftlich abgestützten Einflußnahme und Interessendurchsetzung (was ihr im Vergleich zu den USA oder den alten europäischen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien den Ruf einer »zivilen« Macht beschert hat). Und auch künftig wird Deutschland wohl überwiegend weiter so verfahren wollen. Doch derart weitgehende militärische Zurückhaltung wie bisher scheint nicht mehr angemessen. In die kommenden Auseinandersetzungen um die Machtverteilung in der neuen Welt(un)ordnung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts will herrschende deutsche Politik ohne die alten militärischen (Selbst-)Beschränkungen hineingehen. In der Konkurrenz innerhalb Westeuropas um Rang, Einfluß und Positionen in der neuen Großmacht »Europäische Union« wären diese Beschränkungen ebenso eine lästige Fessel wie in der Konkurrenz dieser Großmacht Westeuropa mit den USA und Japan im Weltmaßstab.
Im Rahmen einer Weltmilitärmacht Europäische Union sollen die deutschen Streitkräfte eine maßgebliche Rolle spielen. Daher zum einen die Bereitschaft der Bundesregierung zur »multinationalen« Einbindung deutscher »out-of-area«-Aktionen, und zum anderen die Forderung nach »Europafähigkeit«. Wer »ja« zur Europäischen Union sage, der müsse auch »ja« sagen zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Militärpolitik inklusive »out-of-area«-Einsätzen.
Bei der Verfolgung dieses machtpolitischen Kurses befindet sich die Bundesregierung in der komfortablen Lage, die eigenen Ansprüche hinter den Anforderungen der Anderen, der »Freunde und Partner« verbergen zu können. Denn diese rufen ja in der letzten Zeit immer wieder danach, daß die Deutschen endlich mehr »Verantwortung« in der Weltpolitik übernehmen sollten – wobei unter »Verantwortung« vornehmlich militärische Interventionsbereitschaft verstanden wird.
Umrüstung statt Abrüstung bei der Bundeswehr
Der Bundeswehr hilft diese Entwicklung aus der Akzeptanz- und Legitimationskrise heraus, in die sie nach dem Ende des Ost-West-Konflikts geraten war. Hatte sie früher ihre Daseinsberechtigung wesentlich aus der »Bedrohung aus dem Osten« gezogen, so mußten nach dem offensichtlichen Wegfall dieser Bedrohung neue Rechtfertigungen für ihren Erhalt gefunden werden. Hier traten angebliche neue »Bedrohungen aus dem Süden« auf den Plan: islamischer Fundamentalismus, Terrorismus, Süd-Nord-Migration, »verrückte Diktatoren«. Der Bundeswehr-Generalinspekteur Naumann liebt es, in diesem Zusammenhang vom „Krisenbogen von Marokko zum Indischen Ozean“ zu sprechen (so zuletzt in seiner Rede auf der 34. Kommandeurtagung der Bundeswehr am 5.10.1993 in Mainz). Und hier trat die Anforderung auf den Plan, in diversen Krisen- und Kriegsgebieten der Welt gemeinsam mit anderen Staaten militärisch »humanitär« zu intervenieren und »Frieden zu stiften« (oder zu »schaffen«, »herzustellen«, »erhalten«, »erzwingen« usw.).
Mit dieser neuen Aufgabenbestimmung liegen die deutschen Streitkräfte voll im NATO-Trend. Die NATO hat sich auf der Gipfelkonferenz ihrer Mitgliedstaaten im November 1991 ein „neues strategisches Konzept“ verpaßt, welches sie von der Fixierung auf den (abhanden gekommenen) Gegner im Osten befreit und ihr neue Betätigungsfelder in der Welt nach Ende der Ost-West-Konfrontation zuweist. Sie wendet sich seither angeblichen neuen Sicherheitsrisiken zu, die „ihrer Natur nach vielgestaltig (sind) und … aus vielen Richtungen“ kommen. Die NATO versteht sich seit Verabschiedung ihres neuen strategischen Konzepts im November 1991 als militärische Ordnungsmacht für Europa und die angrenzenden Regionen, auf ihren Frühjahrs- bzw. Herbsttagungen 1992 hat sie ihre Bereitschaft erklärt, der KSZE bzw. den UN bei Friedenserhaltung, -schaffung usw. beiseite zu stehen. Auf dem NATO-Gipfel im Januar 1994 ist die out-of-area-Orientierung mit Annahme des Dokuments MC 327 offiziell abgesegnet worden.
Zur Bewältigung dieser neuen Aufgaben müssen die NATO-Truppen im allgemeinen und die deutschen Streitkräfte im besonderen umorganisiert und umgerüstet werden. Hohe Mobilität und hohe Flexibilität sind die Schlagworte, die dabei die Richtung angeben. Deutsche Truppen sollen für vielfältige Eventualfälle in weit entfernten Regionen verwendbar sein. Es bedarf also mobiler Streitkräfte, die rasch an Krisenherde transportiert werden können. Die Bundeswehr bereitet sich auf „exterritoriale Einsätze“ oder – wie es in den Verteidigungspolitischen Richtlinien in schönstem Beamtendeutsch heißt: auf „politisches und militärisches Krisen- und Konfliktmanagement im erweiterten geographischen Umfeld“ vor. Dazu wird die Bundeswehr zur Zeit umgerüstet (statt abgerüstet). Das geht von der Ausstattung des einzelnen Soldaten mit tropentauglicher Bekleidung bis zur Verbesserung der Lufttransportkapazitäten, um Truppen schnell über große Entfernungen verlegen zu können.
Mit den im Aufbau befindlichen Krisenreaktionskräften (KRK) der Bundeswehr schmiedet sich deutsche Politik das Instrument für Militärinterventionen – auch »out-of-area«. Verteidigungsminister Rühe auf der Kommandeurstagung der Bundeswehr im Oktober 1993 in Mainz: „Der Aufbau der Krisenreaktionskräfte hat Priorität … Schlüsselbedeutung haben Mobilität, Aufklärungs-, Führungs- und Transportfähigkeit.“ Die KRK – die Rede ist von mindestens 40.000, eher 80.000 Mann – sollen sich sowohl an Aktionen der Schnellen Eingreiftruppen der NATO (Rapid Reaction Forces) oder »out-of-area« – Abenteuern der WEU als auch an UN-Einsätzen (seien das nun »friedenserhaltende« Blauhelm- oder »friedenschaffende« Kampfeinsätze oder ein Mittelding) beteiligen können. Dabei ist der Anteil der für klassische Blauhelm-Einsätze vorgesehenen Einheiten nur gering: 2-4 Bataillone, insgesamt rund 2000 Mann. Das Schwergewicht liegt auf jenen schwerbewaffneten hochbeweglichen KRK, die für Blauhelm-Einsätze nicht, sehr wohl aber für Militärinterventionen geeignet sind.
Das heißt: Schon vor der verfassungsmäßigen Klärung werden vom Militär im Bereich Rüstung und Streitkräftestrukturen Fakten geschaffen.
Es geht um Weichenstellung
Etablierte Politik setzt gegenwärtig alles daran, die Weichen in die falsche Richtung zu stellen: Statt Abrüstung Umrüstung, statt Selbstbeschränkung »Ausgreifen in die Weltpolitik«, statt Entfaltung ziviler Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten Vorbereitung auf militärische Konfliktlösung. Wo doch offensichtlich ist, daß die wirklichen Probleme des Friedens, der Umwelt und der Überwindung von Armut militärisch nicht gelöst werden können.
Die Friedensbewegung und mit ihr ein großer Teil der deutschen Gesellschaft setzen auf die Entwicklung ziviler, nicht-militärischer Konfliktbearbeitung, in der es um Vorbeugung und die Lösung der großen Menschheitsprobleme im konkret einzelnen Fall geht. Nur wenn wir uns den Aufgaben der Zeit stellen, sie nicht länger militärisch abschotten und verschieben, haben wir eine Chance, mit ihnen fertig zu werden. Diese Weichenstellung vollzieht sich nicht durch einen großen einmaligen Akt, sondern über viele Schritte: Helfen wir Flüchtlingen und Asylsuchenden oder machen wir die Grenzen dicht? Reagieren wir auf Konflikte wie in Bosnien oder Somalia mit Waffengewalt oder durch humanitäre Hilfe und positive Sanktionen, was heißt: Verständigung, Aufbau einer menschenrechtlichen Politik werden politisch und wirtschaftlich unterstützt, Kriegstreiberei wird durch Boykott und Embargo beantwortet? Entscheiden wir uns für Demokratisierungs- oder Entdemokratisierungstendenzen in der EG-Integration? Richten wir unsere Gesellschaft und unser Leben weiterhin auf die Spaltungen der Gesellschaften in arm und reich aus oder entscheiden wir uns für eine solidarische Welt?
Die Friedensbewegung ist zur Zeit dabei, ihre Orientierung und ihre neuen Aufgaben nach dem Ende des Ost-West-Konflikts auszuarbeiten. Dabei besteht große Übereinstimmung, die Durchsetzung von Menschenrechten und die Bewältigung der großen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Probleme durch Strategien der zivilen Konfliktbearbeitung anzugehen. Gleichzeitig wird die Friedensbewegung daran arbeiten, die Möglichkeiten grenzüberschreitender Friedensarbeit auszubauen und einen europäischen Kooperationsrahmen dafür zu schaffen. Dabei wird davon ausgegangen, daß die angewandten Mittel der Konfliktbewältigung in hohem Maße die erreichbaren Ziele bestimmen und daß die Tendenz zu anhaltender Militarisierung der Weltpolitik nur beendet werden kann, wenn alternative Formen der Konfliktbearbeitung eingeführt werden. In der Friedensbewegung werden dementsprechend gegenwärtig drei große Aufgabenfelder gesehen: 1. Für Abrüstung einzutreten mit dem Ziel einer Bundesrepublik ohne Armee; 2. Die Entfaltung ziviler Konfliktbearbeitung voranzutreiben; 3. Möglichkeiten grenzüberschreitender Friedensarbeit zu entwickeln.
Ausweitung des Operationsgebiets der Bundeswehr »out-of-area« und Entwicklung einer militärinterventionistischen Politik einerseits oder beharrliche Arbeit für die Entmilitarisierung und Zivilisierung der eigenen Gesellschaft sowie für zivile Konfliktbearbeitungsformen international – das ist zugleich eine Entscheidung der Weichenstellung für unsere Zukunft und für die nachfolgender Generationen.
Volker Böge ist Historiker und arbeitet an der Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung in einem internationalen Forschungsprojekt über Ökologie und Konflikt (ENCOP).