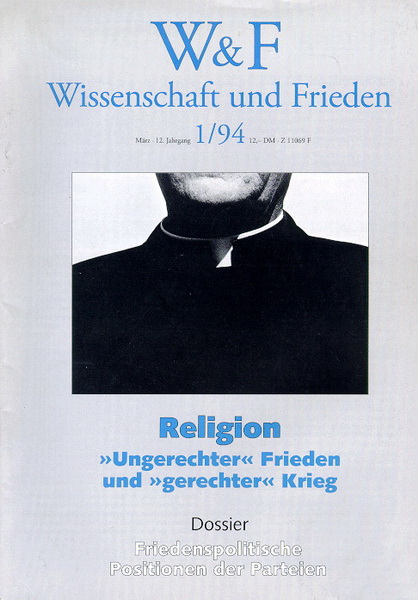Christliche Religiosität und Militarismus
Die sozialwissenschaftliche Sicht
von Christian Zwingmann • Christoph Diringer • Randolph Ochsmann
Das Verhältnis von christlicher Religiosität und der Einstellung zu militärischer Gewalt bildet das Thema des vorliegenden Überblicks. Als Grundlage werden jedoch nicht historische Analysen herangezogen, sondern empirische Befunde und theoretische Ansätze aus den Sozialwissenschaften dieses Jahrhunderts, vor allem aus der Religions- und Sozialpsychologie, aber auch aus der Religionssoziologie. Einige Beobachtungen zum Stand der friedensethischen Diskussion in den christlichen Großkirchen Deutschlands runden die Darstellung ab.
Vielfach ist – vor allem von religionskritischen Autoren – auf den auffälligen Widerspruch zwischen der christlichen Ethik der Liebe und Friedfertigkeit und den gewalttätigen Erscheinungsformen des Christentums im Laufe der Geschichte hingewiesen worden (Deschner, 1970). Seitens der Kirche wurden nicht nur der »gerechte Krieg« zur Verteidigung des Gemeinwohls, sondern auch solche aggressiven Unternehmungen wie die Inquisition und die Kreuzzüge legitimiert. Als weitere Beispiele für die gewalt- und kriegsfördernde Kraft des Christentums können die protestantisch-katholischen Religionskriege und die mit kirchlich-missionarischem Sendungsbewußtsein verbundene »Conquista« der Neuen Welt angeführt werden. Selbst in unserem Jahrhundert finden sich Anzeichen für das Verstricktsein der Kirchen in militärische Gewalt (Huber, 1974; Mettner, 1984).
Forschungsdefizite
Begonnen werden muß der vorliegende Überblick allerdings damit, in dreifacher Hinsicht Defizite in der Forschungslage zu konstatieren: Erstens fällt schon die empirische Beschäftigung mit Religion und Religiosität innerhalb der Sozialwissenschaften trotz ermutigender Ansätze immer noch in den randständigen Forschungsbereich. Dies gilt – zweitens – ganz besonders für den deutschsprachigen Raum: Empirisch-religionspsychologische Forschung ist hierzulande nur in ersten Ansätzen erkennbar (Grom, 1992, 21.9.); in der deutschen Soziologie sind die Defizite zwar weniger ausgeprägt, gleichwohl besteht eine Marginalisierung religionsbezogener Forschung auch hier (Buggle, 1992, S. 377ff.). Drittens ist in nur sehr wenigen, zumeist älteren Untersuchungen explizit nach dem Verhältnis von Religiosität und der Einstellung zu militärischer Gewalt gefragt worden.
Als Gründe für den Mangel an religionsbezogener Forschung innerhalb der empirischen Sozialwissenschaften sind neben wissenschaftshistorischen Argumenten vor allem die zumeist geringe persönliche Religiosität vieler Sozialwissenschaftler sowie Berührungsängste mit theologischen und geisteswissenschaftlichen Denktraditionen diskutiert worden (Gorsuch, 1988). Der gegenwärtige Mangel an religionsbezogenen Fragestellungen sowohl innerhalb der Psychologie und Soziologie als auch der Friedens- und Konfliktforschung mag außerdem mit der weit verbreiteten, aber umstrittenen Auffassung zusammenhängen, daß im fortschreitenden Prozeß der Moderne die Handlungsrelevanz religiöser Einstellungen abnimmt (Terwey, 1993). Die Frage, warum die Großkirchen wenig Interesse an empirischer Forschung gerade zum Verhältnis von christlicher Religiosität und der Einstellung zu militärischer Gewalt zeigen, läßt sich – zumindest für den Bereich des deutschen Katholizismus bis in die 70er Jahre – möglicherweise darauf zurückführen, daß eine kritische Hinterfragung des Christentums aufgrund der Geschlossenheit des kirchlichen Milieus kaum Chancen auf innerkirchliche Rezeption oder Förderung hatte. Ein Diskurs über die gesellschaftlichen und politischen Anfragen der Moderne wurde innerhalb der katholischen Kirche bis zum II. Vatikanischen Konzil 1962-1965 mit der Begründung abgelehnt, die Kirche verstehe sich als „societas perfecta“ (Kaufmann, 1984, S. 69ff.).
Die Ergebnisse der Russell-Studie
Angesichts der sehr unzulänglichen Befundlage muß als zentraler Ausgangspunkt dieses Überblicks eine mehr als 20 Jahre alte, inzwischen schon als »klassisch« zu bezeichnende Zusammenfassung der Forschungslage herangezogen werden, nämlich die von dem Friedens- und Konfliktforscher Elbert W. Russell (1971/1974) in den Veröffentlichungen des Canadian Peace Research Institute vorgelegte sog. Russell-Studie. In dieser Studie wurde zunächst auf der Grundlage von rund 20 soziologischen Untersuchungen, die zwischen 1940 und 1970 in Nordamerika durchgeführt worden waren, unmittelbar dem empirischen Zusammenhang zwischen christlicher Religiosität und »Militarismus« nachgegangen (S. 38ff.).
Zur Erfassung der Religiosität wurden nicht nur die Kirchgangshäufigkeit und eine – in der heutigen Forschung nicht mehr übliche – a priori-Einordnung der jeweiligen Konfession in ein Orthodoxie-Agnostizismus-Kontinuum verwendet, sondern auch verschiedene Fragebögen zur Messung religiöser Anschauungen. Einen besonderen Stellenwert nahm dabei die Bestimmung der »religiösen Orthodoxie« ein: Unter »religiöser Orthodoxie« (orthos=richtig; doxa=Glaube) wurde eine Haltung verstanden, die vor allem in Form der Übernahme und Verteidigung eines geschlossenen religiösen Einstellungssystems rigide an dem richtigen Glauben festhält.
»Militarismus« wurde aufgefaßt als individuelle Einstellung, die sich auf ein bestimmtes Problemlösungsverhalten im Rahmen der internationalen Politik bezieht, nämlich auf „die bereitwillige Anerkennung oder Bevorzugung von Krieg als Mittel zur Lösung von Weltproblemen“ (Russell, 1974, S. 25). Die militaristische Einstellung konnte mit Hilfe von eigens entwickelten Fragebögen zuverlässig erfaßt werden. Darüber hinaus wurden Hinweise auf eine niedrige oder fehlende militaristische Einstellung auf der Verhaltensebene ermittelt, indem z.B. die Höhe der Geldspenden zum Zwecke der Friedensforschung und die Teilnahme an aktiven Friedensdiensten erfaßt wurden.
Als nun die derart erhobenen Indikatoren für christliche Religiosität und Militarismus statistisch miteinander in Beziehung gesetzt wurden, zeigte sich als relativ homogenes Ergebnis über die verschiedenen Stichproben aller Untersuchungen hinweg ein moderater bis starker Zusammenhang folgender Art: Je religiöser eine Person oder Gruppe und vor allem je orthodoxer deren religiöse Einstellung war, desto eher oder stärker wurden militaristische Einstellungen geäußert (Russell, 1974, S. 48). Allerdings konnte – dies sei hier besonders hervorgehoben – auch festgestellt werden, daß ein kleiner Teil der befragten Christen betont pazifistische Einstellungen vertrat (S. 51).
Unter Berücksichtigung einer Vielzahl weiterer empirischer Untersuchungen konnte Russell (1974, S. 55ff.) darüber hinaus belegen, daß religiöse bzw. religiös-orthodoxe Haltungen nicht nur mit militaristischen Einstellungen, sondern außerdem häufig mit einer Reihe weiterer Anschauungen einhergingen und mit diesen gemeinsam ein sog. »autoritär-punitives« Syndrom bildeten. Bei den zusätzlichen Einstellungen handelte es sich um eine besondere Abhängigkeit von Autoritäten (Autoritarismus), ein Befürworten harter Strafen für Gesetzesbrecher (Punitivität), eine hohe Bereitschaft zu Antisemitismus, Ethnozentrismus und anderen Vorurteilen, eine geringe Ausprägung humanitärer, prosozialer Einstellungen sowie um politisch konservative bis reaktionäre Anschauungen wie Nationalismus, Antikommunismus, Anti-Wohlfahrtsstaatlichkeit und Befürworten einer Zensur.
Ergebnisse der religions- und sozialpsychologischen Forschung
Wenn auch innerhalb der Religions- und Sozialpsychologie die Einstellung zu militärischer Gewalt bisher vernachlässigt wurde, so liegen jedoch zahlreiche empirische Studien über das Verhältnis von christlicher Religiosität und einigen zentralen Komponenten des von Russell (1974) beschriebenen »autoritär-punitiven« Syndroms vor. Diese Untersuchungen, namentlich aus der Forschung zu Vorurteilen und zur Prosozialität, koinzidieren in ihren Durchschnittsergebnissen mit der von Russell festgestellten »Paradoxie« (S. 66), daß „die Früchte des Christentums … offenbar das genaue Gegenteil seines Ideals der Liebe“ (S. 67) sind. Für Teilgruppen der untersuchten Christen zeigten sich allerdings auch hier „Ausnahmen von der allgemeinen Regel“ (S. 50).
Bereits die in den 40er Jahren in den USA durchgeführte, groß angelegte Studie von Theodor W. Adorno (1950/1973) und seinen Mitarbeitern über »The authoritarian personality« zeigte neben anderen Ergebnissen einen insgesamt positiven Zusammenhang zwischen Kirchenmitgliedschaft und Voreingenommenheit gegenüber nationalen Minderheiten – obwohl „ein Widerspruch zwischen dem Vorurteil und der christlichen Lehre von der allumfassenden Liebe“ (S. 281) besteht. Der Befund, daß eine stärkere christliche Religiosität bzw. religiöse Orthodoxie im allgemeinen auch mit stärkeren Vorurteilen und erhöhter Intoleranz einhergeht, konnte seitdem – zumindest für Christen der weißen Mittelschicht in den USA der 60er und 70er Jahre – unter Einsatz verschiedenster Meßmethoden in einer Vielzahl von religions- und sozialpsychologischen Untersuchungen repliziert werden (Batson & Ventis, 1982, S. 258ff.; Gorsuch & Aleshire, 1974). Allerdings stellte bereits Adorno (1973) einschränkend fest, daß zumindest eine Minderheit der Gläubigen über ausgeprägte persönliche Glaubenserfahrungen verfügte, und daß diese „Personen oder Gruppen, die Religion in einer verinnerlichten Weise »ernst n[a]hmen«, den Ethnozentrismus eher ablehn[t]en“ (S. 285). Auch Gorsuch & Aleshire (1974) schlußfolgerten in ihrem Review, daß eine Teilgruppe der Kirchenmitglieder, nämlich häufige Kirchgänger mit intensiver Glaubenspraxis, weniger Vorurteile zeigten. Das Verhältnis von christlicher Religiosität und Voreingenommenheit ist offenbar ein zweifaches: „There is something about religion that makes for prejudice, and something about it that unmakes prejudice“ (Allport, 1966, S. 447).
Betrachtet man die Ergebnisse aus der Prosozialitätsforschung, so zeigt sich zwar einerseits, daß religiöse Menschen im Vergleich zu nichtreligiösen engere moralische Standards vertreten und über eine etwas höhere persönliche Hilfsbereitschaft berichten (Batson & Ventis, 1982, S. 284ff.), andererseits scheinen diese Selbstbeschreibungen dem tatsächlichen Verhalten nur unvollkommen zu entsprechen: So ergaben sich in Untersuchungen, in denen die tatsächliche Hilfsbereitschaft ermittelt wurde, keine Beziehungen zwischen – unterschiedlich erfaßter – Religiosität und der aktuellen Bereitschaft nachzusehen, ob eine im Nachbarraum umgefallene Leiter eine Frau verletzt hat, für eine liegengebliebene Autofahrerin den Abschleppdienst zu rufen oder für geistig behinderte Kinder einen freiwilligen, ehrenamtlichen Einsatz zu leisten (Batson & Ventis, 1982, S. 287f.). Allerdings konnten in mehreren nachfolgenden Experimenten wiederum – je nach situativer Anforderung – verschiedene Teilgruppen christlicher Teilnehmer identifiziert werden, die Personen in einer Notlage zuverlässig und angemessen halfen (Batson & Ventis, 1982, S. 290ff.; Wulff, 1991, S. 194ff.).
Zumindest für einen bestimmten zeitlichen und kulturellen Kontext zeigen die Ergebnisse der Russell-Studie und der zusätzlichen religions- und sozialpsychologischen Forschung somit, daß christliche Religiosität zwar einerseits häufig mit militaristischen und »autoritär-punitiven« Einstellungen sowie mit geringem Hilfeverhalten einhergeht, andererseits aber auch mit pazifistischen Einstellungen, wenig Vorurteilen sowie mit zuverlässigem und angemessenem Hilfeverhalten verbunden sein kann. Zur Erklärung dieser zweifachen Befundlage wurde vorgeschlagen, christliche Religiosität differenzierter zu betrachten.
Motivational-funktionale Unterschiede
Für eine solche differenziertere Betrachtungsweise wurden mehrere religionspsychologische Konzepte entwickelt, welche jeweils betonen, daß es verschiedene »religiöse Orientierungen«, d.h. verschiedene motivationale Zugänge zum christlichen Glauben gibt. Derartige Konzepte sind funktional, weil sie von dem spezifischen Inhalt des religiösen Glaubens absehen.
Die in der religionspsychologischen Forschung bisher wohl einflußreichste, auch von Russell (1974, S. 68f.) diskutierte »Unterscheidung der Geister« stammt von dem Persönlichkeitstheoretiker und Sozialpsychologen Gordon W. Allport (1966). Er differenzierte zwei verschiedene, bei einigen Personen auch gemeinsam vorliegende motivationale Zugänge zum christlichen Glauben: Die extrinsische religiöse (E-)Orientierung stellt eine nur instrumentelle, zweckgebundene Gläubigkeit zur Befriedigung persönlicher oder sozialer Bedürfnisse dar. Bei der intrinsischen religiösen (I-)Orientierung hingegen handelt es sich um eine verinnerlichte Gläubigkeit als Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mit religiösen Werten (Zwingmann, 1991, S. 34ff.). Zur empirischen Erfassung der beiden religiösen Orientierungen E und I wurden – mehrfach weiterentwickelte – Fragebögen erstellt, die inzwischen auch in deutscher Sprache vorliegen (Rumpf, 1993; Zwingmann, Hellmeister & Ochsmann, 1993). Religionspsychologische Untersuchungen mit Hilfe dieser Fragebögen ergaben wiederholt, daß nur die E-Orientierung, nicht hingegen die I-Orientierung mit Voreingenommenheit zusammenhängt (Donahue, 1985, S. 405f.). Darüber hinaus konnte bei weißen Methodisten in den USA gezeigt werden, daß Personen mit einer hohen I-Orientierung zumindest eine positivere Bewertung von Hilfsbereitschaft, Liebe und Verantwortung vornehmen als andere Gläubige (Tate & Miller, 1971). Diese Forschungsergebnisse lassen vermuten, daß auch militaristische Einstellungen nicht mit christlicher Religiosität allgemein, sondern speziell nur mit der E-Orientierung einhergehen. Mit der I-Orientierung, bei der das Gebot der Nächstenliebe ernst genommen wird (Allport, 1966, S. 455), hängen militaristische Einstellungen vermutlich nicht systematisch zusammen.
Als wichtige Ergänzung des Allportschen Ansatzes wurde von dem Theologen und Religionspsychologen C. Daniel Batson (Batson & Ventis, 1982, S. 149ff.) eine zusätzliche religiöse Orientierung abgegrenzt, bei der selbstkritische Hinterfragung und kontinuierliche Zweifel an endgültigen Antworten auf existentielle Fragen als positive Werte im Vordergrund stehen. Diese sog. Quest-(Q-)Orientierung (quest=Suche) bildet somit einen deutlichen Gegenpol zu einem starren Festhalten an vorgegebenen Glaubenslehrsätzen, wie es für die von Russell (1974) beschriebene, mit militaristischen Einstellungen verbundene orthodoxe Glaubenshaltung charakteristisch ist. Auch für die Q-Orientierung wurde ein – inzwischen ins Deutsche übertragener (Hellmeister, 1993) – Fragebogen entwickelt. Sein Einsatz in der religionspsychologischen Forschung ergab, daß die Q-Orientierung mit einer deutlichen Ablehnung rassischer Diskriminierung und sehr toleranten Einstellungen im sozialen und politischen Bereich zusammenhängt sowie mit einem Hilfeverhalten einhergeht, das nicht von sozialer Anerkennung abhängig ist und den tatsächlichen Bedürfnissen des Notleidenden in hohem Maße gerecht wird (Batson & Ventis, 1982, S. 290ff.; Wulff, 1991, S. 241). Auf dem Hintergrund dieser Befunde erscheint es nicht unplausibel, die Q-Orientierung als motivationalen »Königsweg« zu einer mit betont pazifistischen Einstellungen verbundenen christlichen Religiosität in Erwägung zu ziehen.
Als beeindruckendes Beispiel für den engen Zusammenhang zwischen dem motivationalen Zugang zum religiösen Glauben und politischen Einstellungen soll schließlich die Untersuchung von Benson & Williams (1982) angeführt werden: Bei einer Befragung von 80 Mitgliedern des amerikanischen Kongresses wurde festgestellt, daß ein starkes Militär sowie ferner freie Marktwirtschaft und Privateigentum vor allem von denjenigen Politikern befürwortet wurden, die in orthodoxer bzw. extrinsischer Weise ein großes Gewicht auf die Regeln, Richtlinien und Begrenzungen sowie auf den Zweck des religiösen Glaubens legten. Für Entwicklungs- und Hungerhilfe hingegen votierten in erster Linie solche Politiker, die in intrinsischer Weise die Bedeutung des Glaubens für das alltägliche Handeln betonten.
Unterschiede in den Glaubensinhalten
Eine differenzierte Betrachtungsweise christlicher Religiosität darf sich nicht auf die motivationale Ebene beschränken, sondern muß auch Unterschiede in den Glaubensinhalten berücksichtigen (Schaefer & Gorsuch, 1991). Als eine wesentliche Komponente des Glaubensinhaltes wurden innerhalb der Religionspsychologie mit Hilfe von Adjektiv- oder Substantivlisten mehrfach die persönlichen Gottesvorstellungen der Gläubigen ermittelt. Als für christliche Stichproben besonders relevant ergaben sich die Vorstellungen eines liebenden/unterstützenden, eines strengen/richtenden/strafenden und eines fernen/unerreichbaren/deistischen Gottes (Petersen, 1993, S. 14ff.). In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß Voreingenommenheit und konservative politische Anschauungen – beides Komponenten des von Russell (1974) beschriebenen »autoritär-punitiven« Syndroms – in unterschiedlicher Weise mit diesen Gottesvorstellungen verbunden sind.
So fanden Spilka & Reynolds (1965), daß Vorurteile in erster Linie von solchen Gläubigen geäußert wurden, die Gott als fern, unpersönlich und passiv charakterisierten. In dieser deistischen Perspektive kann christliche Religiosität offenbar nur wenig Handlungsrelevanz entfalten. In Übereinstimmung mit dieser Interpretation stellten Schaefer & Gorsuch (1991) fest, daß eine deistische Gottesvorstellung zumeist mit einer zweckgebundenen E-Orientierung zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse einhergeht.
Wenig voreingenommene Gläubige beschrieben in der Untersuchung von Spilka & Reynolds (1965) einen nahen, persönlichen und aktiven Gott, den sie entweder als warm und liebend oder aber als kontrollierend und strafend erlebten. Während hier also sowohl die liebende als auch die strafende Gottesvorstellung – wenn auch vermutlich aus verschiedenen Gründen – mit wenig Vorurteilen einhergingen, zeigten sich bei der bereits erwähnten Befragung amerikanischer Kongreßmitglieder (Benson & Williams, 1982) Unterschiede zwischen diesen beiden Vorstellungen: Politiker, die Gott als liebend und unterstützend beschrieben, äußerten liberale Einstellungen, Politiker mit einer omnipotenten und strengen Gottesvorstellung hingegen konservative Anschauungen.
In einer weiteren, an einer US-repräsentativen Stichprobe durchgeführten Untersuchung wurde ein anderer Zugang zur Klassifizierung der Glaubensinhalte gewählt: Piazza & Glock (1979) unterschieden danach, ob die Gläubigen an einen Einfluß Gottes auf das persönliche Leben und/oder auf soziale Bedingungen glaubten. Konservative politische Einstellungen, eine Ablehnung liberaler Rassenpolitik und eine geringe persönliche Hilfsbereitschaft wurden bei denjenigen Personen festgestellt, die Gott einen Einfluß auf die soziale Ordnung zusprachen. Gegensätzliche Auffassungen, nämlich liberale politische Einstellungen, eine Befürwortung liberaler Rassenpolitik und eine hohe persönliche Hilfsbereitschaft gaben jene Personen an, die einen Einfluß Gottes nur für ihr persönliches Leben annahmen. Personen, die als eher deistische Vorstellung überhaupt keinen Einfluß Gottes wahrnahmen, lagen zwischen diesen beiden Extremen.
Diese – etwas uneinheitlichen – Ergebnisse hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Glaubensinhalt und einigen Komponenten des »autoritär-punitiven« Syndroms lassen zumindest vermuten, daß die Vorstellung eines liebenden Gottes, der Einfluß nur auf das persönliche Leben, nicht hingegen auf die soziale Ordnung nimmt, mit militaristischen Einstellungen inkompatibel ist. Für deistische oder strafende Gottesvorstellungen und besonders für den Glauben an den Einfluß Gottes auf soziale Bedingungen kann hingegen eher ein Zusammenhang mit Militarismus vermutet werden.
Ambiguität der christlichen Lehre?
Unsere differenziertere Betrachtungsweise hat gezeigt, daß sowohl hinsichtlich des motivationalen Zuganges als auch des Glaubensinhaltes verschiedene Formen christlicher Religiosität abgrenzbar sind. Einige dieser Formen sind offenbar bevorzugt mit militaristischen und »autoritär-punitiven« Einstellungen verbunden. Im Hinblick auf die zugrundeliegenden Untersuchungen muß allerdings betont werden, daß es sich lediglich um Zusammenhänge, nicht um kausale Wirkverhältnisse handelt. Es kann also nicht behauptet werden, daß bestimmte religiöse Formen militaristische Einstellungen bewirken oder hervorbringen. Es könnte z.B. auch gerade umgekehrt sein, nämlich daß Menschen mit militaristischen und »autoritär-punitiven« Einstellungen solche religiösen Formen und Kontexte wählen, die zu ihren Einstellungen passen. Dennoch muß auch unter Berücksichtigung dieser eingeschränkten Interpretierbarkeit betont werden, daß es offenbar Formen christlicher Religiosität gibt, die – trotz der christlichen Ethik der Liebe und Friedfertigkeit – mit militaristischen und »autoritär-punitiven« Einstellungen nicht in Widerspruch geraten. Kann dies auf eine Ambiguität der christlichen Lehre zurückgeführt werden?
Russell (1974, S. 74ff.) hat dies im Hinblick auf die biblischen Texte zu zeigen versucht. Nach seiner Analyse unterstützt ein fundamentalistisches (= literales, wörtliches) Verständnis der Bibel kaum humanitär-liebevolle Einstellungen, sondern vor allem militaristische Anschauungen, da vielfach ein autoritärer und unnachsichtig strenger Gott beschrieben wird, der seine Liebe an Bedingungen knüpft. In einem ähnlichen, aber von Zenger (1992, 1.5.) sehr überzeugend kritisierten Argumentationsgang bewertete kürzlich der deutsche Psychologe Franz Buggle (1992) die Bibel als „zutiefst gewalttätig-inhumanes Buch“ (S. 21). Wir wollen auf eine Nachzeichnung dieser Diskussion nicht nur deshalb verzichten, weil sie den sozialwissenschaftlichen Bereich verläßt, sondern auch deshalb, weil eine Analyse der Bibel am Kern der Sache vorbeigeht: Die in den oben dargestellten empirischen Untersuchungen aufgewiesenen, mit militaristischen und »autoritär-punitiven« Einstellungen einhergehenden Formen christlicher Religiosität sind nämlich nicht notwendigerweise mit einem fundamentalistischen Verständnis der Bibel verbunden.
Wichtig erscheint uns hingegen, auf die Ambiguität christlicher Glaubensvermittlung vor allem im Rahmen religiöser Erziehung hinzuweisen: Vielfach wird zwar durch Vermittlung inhaltlicher Begründungen und Anregung zum eigenen Erleben und Reflektieren ein intrinsischer (I) bzw. suchender (Q) Zugang zum religiösen Glauben ermöglicht. Andererseits wird nicht selten durch die Beschreibung Gottes als Erfüller selbstbezogener Bedürfnisse sowie durch die Darstellung von Kirche primär als Ort sozialer Kontakte ein extrinsischer und durch die Betonung vorgegebener Pflichten ein starrer, orthodoxer Zugang zum religiösen Glauben gefördert (Grom, 1992). Diese Mehrdeutigkeit zeigt sich auch hinsichtlich der vermittelten Gottesvorstellungen: Sowohl autobiographische Texte (Scherf, 1984) als auch psychotherapeutische Beobachtungen (Hark, 1990) belegen, daß Gott nicht nur als Quelle von Geborgenheit und Hoffnung, sondern auch von Angst und Zwang erfahren wird.
Religiöse Erziehung scheint also beides zu ermöglichen: sowohl solche Glaubensformen, die – wie die oben dargestellten Untersuchungen gezeigt haben – mit militaristischen und »autoritär-punitiven« Einstellungen einhergehen, als auch solche, die empirisch nicht mit diesen Einstellungen zusammenhängen. Läßt sich hinsichtlich der direkten Verlautbarungen zu militärischer Gewalt auf der Ebene institutioneller Religiosität eine ähnliche Ambiguität feststellen? Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir abschließend eine Analyse der friedensethischen Diskussion im 20. Jahrhundert vor, wie sie sich auch und vor allem in den christlichen Großkirchen Deutschlands darstellt. Angesichts der defizitären empirischen Forschungslage hierzulande können die oben dargestellten, vornehmlich auf dem nordamerikanischen Kontinent durchgeführten Untersuchungen nur mit Hilfe dieser Analyse um eine auch auf Deutschland gerichtete Perspektive ergänzt werden.
Friedensethische Diskussion in den christlichen Großkirchen
Für eine Analyse werden im folgenden neuere Dokumente der christlichen Großkirchen zur Friedensethik exemplarisch skizziert. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf der lehramtlichen Position der römisch-katholischen Kirche; wo Bezüge zur evangelischen Kirche angebracht erscheinen, werden diese benannt. Die zugrundegelegten Dokumente können dabei als gesellschaftliche Objektivationen religiösen Bewußtseins zu einem im gesellschaftlichen Diskurs auftauchenden relevanten Thema betrachtet werden. Bezogen auf das Verhältnis von christlicher Religiosität und militärischer Gewalt sind sie Ausdruck kirchlich-ideologischer Reflexion einer innergesellschaftlichen und politischen Debatte um verschiedene sicherheitspolitische Optionen, die in einen sich verändernden weltpolitischen Bedingungsrahmen eingebunden sind. Dies impliziert, daß solche kirchlichen Verlautbarungen immer schon politisch wirken, ja sogar für politische Zwecke – sei es im Interesse der Kirche oder der Politik – funktionalisiert werden können. Sie zielen auf den Zusammenhang von religiösem Bewußtsein und politisch-militärischem Handeln und sind deshalb für unser Thema relevant.
Die Entwicklungslinie katholischer Friedensethik im 20. Jahrhundert auf der Ebene der römisch-katholischen Weltkirche führte von der auf den Verteidigungskrieg reduzierten Tradition der »Lehre vom gerechten Krieg« (Papst Pius XII.) zu einer grundsätzlichen Neuorientierung in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils 1962-1965 (Mettner, 1984). Diese bilden im Kontext einer weltweiten atomaren Abschreckungspolitik mit der Rezeption zentraler Thesen und Begriffe neuzeitlicher Friedens- und Konfliktforschung die Grundlage einer abschreckungskritischen Position innerhalb der katholischen Friedensethik. Die Qualität einer abschreckungsgegnerischen, antimilitaristischen Position besitzen sie allerdings keineswegs.
Konnte in Deutschland die »Lehre vom gerechten Krieg« zur Legitimierung westlicher atomarer Drohpolitik politisch funktionalisiert (Mettner, 1984, S. 429ff.) und die ethische Option der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen bis in die 70er Jahre als „irrige Gewissensentscheidung“ auch innerkirchlich diskreditiert werden (Diringer, 1989), so ist die friedensethische Neuorientierung des II. Vatikanischen Konzils charakterisiert durch die Ablösung der »Lehre vom gerechten Krieg« durch die Lehre vom »gerechten Frieden«, der inhaltlich als soziale Entwicklung begriffen wird, sowie durch die zunehmende Tendenz, angesichts der atomaren Bedrohung den Rüstungswettlauf rückhaltlos zu verurteilen.
Jedoch wird in den neueren friedensethischen Dokumenten der katholischen Kirche bis heute eine strukturelle Schwäche sichtbar: Kontroverse friedenspolitische Positionen werden in Kompromißformeln entschärft, und die politische Forderung nach militärischer Abrüstung und Entwicklung sozialen Friedens bleibt einem idealistisch-appellativen Charakter verhaftet, indem sie sich an den »guten Willen« der politisch Verantwortlichen in internationalen Gremien richtet (Mettner, 1984, S. 427f.).
Der Kompromißcharakter weltkirchlicher Friedensethik und ihrer Rezeption in der deutschen Ortskirche zeigt sich vor allem in der Tendenz, eine eindeutige politische Operationalisierung ihrer Ethik zu vermeiden. Ein pointiertes Beispiel für diese Behauptung ist die ambivalente Haltung zur Frage der »Dienste für den Frieden«, die im Konzilsdokument »Gaudium et spes« (Sekretariat der DBK, 1982) zum Ausdruck kommt: Sowohl der Wehr- bzw. Kriegsdienst der Soldaten als auch die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen werden als gleichwertige sittliche Entscheidungen beurteilt, allerdings mit Ausnahme der »situationsbedingten Kriegsdienstverweigerung« und der »Totalverweigerung«. Damit rücken die Konzilsaussagen zur Kriegsdienstverweigerung und zum Wehr- bzw. Kriegsdienst in die Nähe der sog. »Komplementaritätsthese«, die Ende der 60er Jahre innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland formuliert wurde, um den innerkirchlichen Konflikt um die Atombewaffnung der Bundeswehr zu entschärfen (Krölls, 1980, S. 61ff.). Diese Kompromißformel versucht, die verschiedenen individualethischen Optionen von Soldaten und Kriegsdienstverweigerern als komplementäres Handeln zu verstehen. Auf dem Evangelischen Kirchentag 1967 wurde erstmals die Formel vom „Friedensdienst mit und ohne Waffen“ geprägt; spätestens in den 70er Jahren wurde die Gleichrangigkeit von Wehr- und Zivildienst auch von der katholischen Kirche in Deutschland übernommen (Bertsch et al., 1976, S. 445ff.).
Offensichtlich wird die an diesem Beispiel deutlich werdende Ambiguität beider christlichen Großkirchen in Fragen der Friedensethik bzw. des Friedenshandelns auch von der Bevölkerung wahrgenommen – wie es sich am Beispiel einer repräsentativen Umfrage in der Schweiz zeigt: Auf die Frage „Können Sie sich vorstellen, wie es … wäre, wenn es die reformierte und die katholische Kirche nicht mehr gäbe?“, stimmten 48% der Antwort „(Es) würde weniger für den Frieden getan“ zu, gleichzeitig lehnten jedoch 40% diese Aussage ab (Bovay, 1993, S. 195). Warum, so läßt sich angesichts dieses Befundes fragen, favorisieren die christlichen Großkirchen eine neutrale, mehrdeutige Position in einer zentralen Frage ihrer Friedensethik?
Primär scheint dies, so soll unsere soziologische These lauten, in einer spezifischen Form von strukturkonservativem bzw. systemstabilisierendem »Krisen-Management« der Großkirchen angesichts der zunehmenden Erosion des traditionell-kirchlichen Milieus begründet zu sein.
War es innerhalb der ideologischen wie institutionellen Geschlossenheit des deutschen Katholizismus der Nachkriegszeit – im Gegensatz zur evangelischen Kirche (Vogel, 1978) – ohne größeren Widerstand aus den Reihen der Mitglieder und unter starker politischer Einflußnahme der deutschen Bischöfe möglich, frühzeitig eine eindeutige und offensive Option für die deutsche Wiederaufrüstungspolitik der Ära Adenauer zu organisieren (Doering-Manteuffel, 1981), so hat sich die Situation seit den 70er Jahren grundlegend verändert: Christliche Basisgruppen entwickeln als Gegenüber zu dem amtlichen politischen Profil der Großkirchen eine eigene politische Präsenz und transformieren – durch ihre Teilnahme an gesellschaftlichen Emanzipationsprozessen innerhalb der »Neuen sozialen Bewegungen« (Friedens-, Ökologie-, Frauen-, Solidaritäts-Bewegung) – gesellschaftskritische Impulse als kirchenkritische Impulse in die strukturkonservativen Institutionen der Großkirchen hinein (Steinkamp, 1992). Aber auch die ideologische Geschlossenheit der 50er und 60er Jahre in der katholischen Kirche ist zerbrochen: Die wachsende Zahl aktueller innerkirchlicher Konflikte ist ein deutlicher Indikator für den „Wandel des Religiösen“ (Gabriel, 1993) und den wachsenden kircheninternen Pluralismus (Hengsbach, 1988), der sich amtskirchlich nicht mehr wie früher steuern oder ausgrenzen läßt.
Dieses konfliktive Spannungsfeld ist letztlich Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Differenzierungs- und Modernisierungsprozesses, der die bisher »dominierende« christliche Religiosität zu einer »dominierten« Religion transformiert (Bourdieu, 1992, S. 237). Der Versuch der christlichen Großkirchen, dieser Herausforderung innerhalb des modernen Differenzierungsprozesses mit einer innovationshemmenden Strategie der Identitätssicherung zu begegnen, indem sie versucht, eine mittlere Position zwischen Extremen einzunehmen, zeigt sich in ihrer Uninteressiertheit bis Feindseligkeit gegenüber konfessionellen, ökumenischen und außerkirchlichen Friedensbewegungen dieses Jahrhunderts. Gleichzeitig, so kann man vermuten, werden durch diese Ambiguität orthodox-dogmatische Gruppen dazu ermutigt, innerkirchliche, aber auch gesellschaftspolitische Räume mit ihrer Einflußnahme zu besetzen.
Resümee
Der vorliegende sozialwissenschaftliche Überblick hat gezeigt, daß christliche Religiosität und eine Einstellung, die militärische Gewalt als Mittel zur Lösung von Weltproblemen gutheißt, nicht selten miteinander verbunden sind. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen eindeutigen Zusammenhang; vielmehr ist eine differenzierte Betrachtungsweise erforderlich: Gestützt auf empirische Untersuchungen vor allem aus den USA hat sich auf der individuellen Ebene ergeben, daß nicht christliche Religiosität allgemein, sondern nur bestimmte Glaubensformen – nämlich motivationale Zugänge extrinsischer oder dogmatisch-orthodoxer Art sowie Vorstellungen eines deistischen, strafenden oder auf soziale Bedingungen Einfluß nehmenden Gottes – bevorzugt mit militaristischen und anderen, der christlichen Ethik der Liebe und Friedfertigkeit widersprechenden Einstellungen einhergehen.
Allerdings können diese Glaubensformen nicht einfach als Mißverständnisse der christlichen Lehre angesehen werden – vielmehr scheint eine Ambiguität christlicher Glaubensvermittlung vor allem im Rahmen religiöser Erziehung solche Glaubensformen nicht unmaßgeblich zu fördern. Wie eine Analyse der neueren friedensethischen Diskussion auf der Ebene institutioneller Religiosität gezeigt hat, ist hinsichtlich amtskirchlicher Verlautbarungen der christlichen Großkirchen Deutschlands zu militärischer Gewalt ebenfalls eine mehrdeutige Haltung festzustellen. Diese Position, welche die Ausbildung pazifistischer Einstellungen unter den Gläubigen keineswegs begünstigt, resultiert vermutlich aus dem Bemühen der Großkirchen, angesichts des wachsenden kircheninternen Pluralismus eine neutrale Haltung zwischen Extremen einzunehmen.
Die innewohnende Gefahr, daß christliche Religion zu einem erheblichen gesellschaftlichen Faktor des Unfriedens werden kann, sollte jedoch sowohl den einzelnen Christen als auch die christlichen Kirchen dazu bewegen, die Reflexion über die Friedensfähigkeit ihres Glaubens als zentrales Thema ihrer Friedensethik zu behandeln. Eine Verweigerung dieser Auseinandersetzung ist wohl nur um den Preis der eigenen Glaubwürdigkeit durchzuhalten.
Literatur
Adorno, Th.W. (1973). Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt: Suhrkamp. (Original erschienen 1950)
Allport, G.W. (1966). The religious context of prejudice. Journal for the Scientific Study of Religion, 5, 447-457.
Argyle, M. & Beit-Hallahmi, B. (1975). The social psychology of religion. London: Routledge & Kegan Paul.
Batson, C.D. & Ventis, W.L. (1982). The religious experience. New York: Oxford University Press.
Benson, P.L. & Williams, D.L. (1982). Religion on Capitol Hill. New York: Harper & Row.
Bertsch, L., Boonen, P.H., Hammerschmidt, R., Homeyer, J., Kronenberg, S. & Lehmann, K. (Hrsg.). (1976). Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (6. Aufl.). Freiburg: Herder.
Bourdieu, P. (1992). Rede und Antwort. Frankfurt: Suhrkamp.
Bovay, C. (1993). Religion und Gesellschaft in der Schweiz. In A. Dubach & R.J. Campiche (Hrsg.), Jede(r) ein Sonderfall? (S. 173-211). Zürich/Basel: NZN/Reinhardt.
Buggle, F. (1992). Denn sie wissen nicht, was sie glauben. Reinbek: Rowohlt.
Deschner, K. (Hrsg.). (1970). Kirche und Krieg. Stuttgart: Günther.
Diringer, Ch. (1989). Kriegsdienstverweigerung und katholische Kirche. Uetersen: Internationaler Versöhnungsbund.
Doering-Manteuffel, A. (1981). Katholizismus und Wiederbewaffnung. Mainz: Grünewald.
Donahue, M.J. (1985). Intrinsic and Extrinsic religiousness. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 400-419.
Gabriel, K. (1993). Wandel des Religiösen. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, 3-4, 28-36.
Gorsuch, R.L. (1988). Psychology of religion. Annual Review of Psychology, 39, 201-221.
Gorsuch, R.L. & Aleshire, D. (1974). Christian faith and ethnic prejudice. Journal for the Scientific Study of Religion, 13, 281-307.
Grom, B. (1992). Religionspsychologie. München/Göttingen: Kösel/Vandenhoeck & Ruprecht.
Grom, B. (1992, 21.9.). Religiosität – von der Psychologie verdrängt? Frankfurter Allgemeine Zeitung, S. 11.
Hark, H. (1990). Religiöse Neurosen (3. Aufl.). Stuttgart: Kreuz.
Hellmeister, G. (1993). Religiosität als Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen. Unveröff. Dipl.Arbeit, Universität Mainz.
Hengsbach, F. (1988). Verdirbt politische Pluralität den Katholizismus? Herder-Korrespondenz, 7, 335-340.
Huber, W. (1974). Kirche und Militarismus. In W. Huber & G. Liedke (Hrsg.), Christentum und Militarismus (S. 158-184). Stuttgart/München: Klett/Kösel.
Kaufmann, F.-X. (1984). Gesellschaft/Kirche. In P. Eicher (Hrsg.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe (Bd. 2, S. 65-80). München: Kösel.
Krölls, A. (1980. Kirche und Wiederbewaffnung. Mainz: Grünewald.
Mettner, M. (1984). Frieden. In P. Eicher (Hrsg.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe (Bd. 1, S. 404-431). München: Kösel.
Ochsmann, R. (1993). Angst vor Tod und Sterben. Göttingen: Hogrefe.
Petersen, K. (1993). Persönliche Gottesvorstellungen. Ammersbek: Lottbek Jensen.
Piazza, T. & Glock, Ch.Y. (1979). Images of God and their social meanings. In R. Wuthnow (Ed.), The religious dimension (pp. 69-91). New York: Academic Press.
Rumpf, M. (1993). Extrinsische und intrinsische religiöse Orientierung und ihre Beziehung zu Glaubensinhalten. Unveröff. Dipl.Arbeit, Universität Frankfurt.
Russell, E.W. (1974). Christentum und Militarismus. In W. Huber & G. Liedke (Hrsg.), Christentum und Militarismus (S. 21-109). Stuttgart/München: Klett/Kösel. (Original erschienen 1971)
Schaefer, Ch.A. & Gorsuch, R.L. (1991). Psychological adjustment and religiousness. Journal for the Scientific Study of Religion, 30, 448-461.
Scherf, D. (Hrsg.). (1984). Der liebe Gott sieht alles. Frankfurt: Fischer.
Sekretariat der DBK (Hrsg.). (1982). Dienste am Frieden (2. Aufl.). Bonn: Autor.
Spilka, B. & Reynolds, J.F. (1965). Religion and prejudice. Review of Religious Research, 6, 163-168.
Steinkamp, H. (1992). Kirchliche Basisgruppen. Gruppendynamik, 23, 121-131.
Tate, E.D. & Miller, G.R. (1971). Differences in value systems of persons with varying religious orientations. Journal for the Scientific Study of Religion, 10, 357-365.
Terwey, M. (1993). Sind Kirche und Religion auf der Verliererstraße? ZA-Information, 32, 95-112.
Vogel, J. (1980). Kriegsdienstverweigerung. Frankfurt: Europ. Verlagsanstalt.
Wulff, D.M. (1991). Psychology of religion. New York: John Wiley & Sons.
Zenger, E. (1992, 1.5.). Gott und die tödlichen Netze der Gewalt. Publik-Forum, S. 18-19.
Zwingmann, Ch. (1991). Religiosität und Lebenszufriedenheit. Regensburg: Roderer.
Zwingmann, Ch., Hellmeister, G. & Ochsmann, R. (1993). Intrinsische und extrinsische religiöse Orientierung: Fragebogenskalen (Beiträge zur Sozialpsychologie 1/1993). Universität Mainz, Psychologisches Institut.
Dipl.-Psych. Christian Zwingmann ist außeruniversitär im Bereich der statistischen Datenanalyse beschäftigt und arbeitet zur Zeit an seiner Doktorarbeit über ein Thema an der Schnittstelle zwischen Sozial- und Religionspsychologie. Dipl.-Theol. Dipl.-Päd. Christoph Diringer ist pastoraler Mitarbeiter in der Krankenthausseelsorge. Er ist Mitglied der katholischen Friedensbewegung Pax Christi und war 1989-1991 für die ökumenische Kampagne »Rüstungsexporte stoppen – Produzieren für das Leben« in Idstein tätig. Prof. Dr. Randolph Ochsmann ist Professor für Sozialpsychologie im Psychologischen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.