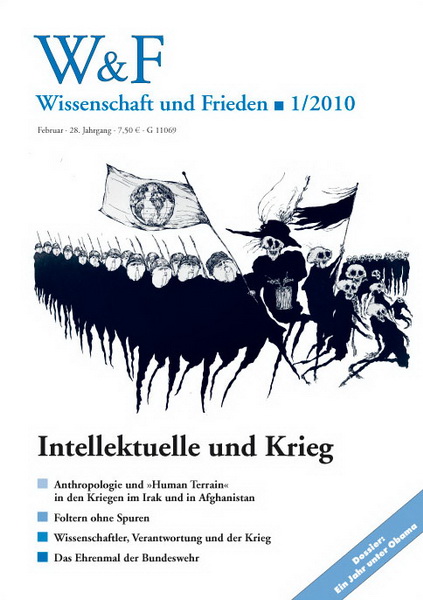Das Ehrenmal der Bundeswehr
von Eugen Januschke
Das Ehrenmal ist sowohl Ort als auch Ausdruck eines Gedenkkults um den Soldatentod, dessen Zweck darin besteht, Trost, Sinn, Legitimation und Motivation zu stiften. Damit zielt dieser Gedenkkult schlussendlich auf einen Erhalt bzw. eine Steigerung der Kriegsführungsfähigkeit der Bundeswehr ab. Bestimmt man diesen Gedenkkult zunächst ausschließlich über seinen Zweck, so drängt sich der Eindruck auf, dass dieser einfach dem Gedenkkult im preußisch-deutschen Militarismus entspricht. Oder sind doch Veränderungen in der Funktion des Gedenkkultes auszumachen? Wie im Folgenden gezeigt wird, können Zweck und Ziel des Gedenkkults um den Soldatentod als relativ konstant betrachtet werden, zumindest für die letzten zweihundert Jahre. Aber für die Erfüllung seines Zwecks muss dieser Gedenkkult eine Wirkung auf die Gesellschaft entfalten können. Konkret bedeutet das als Fragestellung: der Gedenkkult um den Soldatentod hat zwar einen konstanten Zweck, aber er muss vielleicht anders funktionieren, wenn sich die Gesellschaft wandelt.
Über den gesellschaftlichen Wandel existieren unterschiedliche Vorstellungen. Folgt man der Analyse Herfried Münklers, der sich konstruktiv mit der Rolle der Bundeswehr auseinandersetzt, so kann Erhellendes über die Ängste und Befürchtungen der Befürworter des Ehrenmals herausgefunden werden. Deren Kenntnis ist wichtig für die Analyse der Funktion des Ehrenmals.
Herfried Münkler, als Politikwissenschaftler Professor an der Humboldt-Universität Berlin, ist Mitglied im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Der zentrale analytische Begriff bei Münkler bezüglich der jetzigen, westlichen Gesellschaft ist »postheroisch«. Einfacher als mit dem Versuch einer Definition dieses Begriffes zu beginnen, ist es, dem Verweis der Vorsilbe »post« nachzugehen. Die Vorsilbe legt nahe, dass die Gesellschaft zuvor heroisch war. Die umfassende Mobilisierung des Volkes für die Kriegsführung bringt das berühmte »Dekret zur allgemeinen Volksbewaffnung« des französischen Konvents vom 23. August 1793 unmissverständlich zum Ausdruck: „Artikel 1. Von jetzt an bis zu dem Tage, an dem die Feinde vom Gebiet der Republik vertrieben sind, unterliegen alle Franzosen der ständigen Heeresdienstpflicht. Die jungen Männer ziehen in den Kampf, die verheirateten schmieden Waffen und befördern Verpflegung; die Frauen fertigen Zelte und Uniformen und leisten in den Lazaretten Dienst; die Kinder zupfen altes Leinenzeug zu Scharpie, die Alten lassen sich auf öffentliche Plätze tragen, um in den Kriegern Mut und Hass gegen die Könige anzustacheln und ihnen die Einheit der Republik ans Herz zu legen“.1
Dieses Dekret ist die Geburtsurkunde der heroischen Gesellschaft, zu der auch diejenige des preußisch-deutscher Militarismus gehört. Münkler bezieht sich auf Carl von Clausewitz, einen der Theoretiker der zugehörigen Kriegsführung der heroischen Gesellschaft. Mit diesem möchte Münkler (2002) den Unterschied zwischen der Kriegsführung von heroischen und postheroischen Gesellschaften verdeutlichen. Für Clausewitz ist Krieg ein Messen der physischen und moralischen Kräfte. Unter physischen Ressourcen sind die Soldaten und das militärische Material wie beispielsweise Waffen zu verstehen. Die moralischen Ressourcen beziehen sich auf die Motivation und Opferbereitschaft der Soldaten und Bevölkerung. Für die heroische Gesellschaft gilt eine relative Knappheit an den physischen Ressourcen im Vergleich zu den moralischen Ressourcen. Wo, wie im Frankreich des revolutionären Konventsdekrets, tendenziell die ganze Gesellschaft zu den Waffen greift, werden die Gewehre knapp. Die Moral hingegen steht wie ein Fels und kann getrost den nicht mehr wehrdienstfähigen Alten überlassen werden.
Das Manko der postheroischen Gesellschaften
Anders verhält sich diese Gewichtung in den postheroischen Gesellschaften der heutigen westlichen Welt. Die physischen Ressourcen sind groß, besonders im Vergleich zu den als knapp empfundenen moralischen Ressourcen. Die physischen Ressourcen der postheroischen Gesellschaften sind aber auch groß im Vergleich zu den physischen Ressourcen der Gegner der Kriege der letzten Jahre. Diese heutigen Gegner der postheroischen Gesellschaften werden als noch heroische Gesellschaften oder Gruppierungen imaginiert (vgl. Küpeli 2007, S.19). Deren physische Ressourcen sind vergleichsweise gering, aber ihre Kämpfer verfügen über eine meist ideologisch oder religiös interpretierte hohe Motivation und Opferbereitschaft.
Nun wäre der asymmetrische Krieg für die postheroischen Gesellschaften des Westens kein Problem, wenn sich der Krieg weiterhin mit Clausewitz als der physische Verbrauch der Kräfte in der Schlacht zur Erschütterung der moralischen Faktoren darstellen würde: Durch die möglichst hohe physische Abnutzung der Kräfte des Gegners bis zu deren Erschöpfung konnte schlussendlich eine moralische Erschöpfung des Gegners erreicht werden. Doch hier bieten die postheroischen Staaten ihren Gegnern eine andere Angriffsfläche, die diese Gegner geschickt zu nutzen gelernt haben: Denn bereits durch kleine physische Verluste in Form des Todes weniger eigener Soldaten befinden sich postheroische Gesellschaften in einer Stresssituation, weil sie sowieso nur über mangelnde moralische Ressourcen verfügen (vgl. Münkler 2002, S.192).
Münklers Heroismus-Empfehlung
Münklers generelle Empfehlung für die Bevölkerung der postheroischen Gesellschaften: heroische Gelassenheit. Während diese Forderung unkonkret und wenig praktikabel erscheint, hat er explizite Empfehlungen zu den Soldaten: „Heroismus ist unverzichtbar [...]. Der Held ist dann gefordert, wenn postheroische Gesellschaften in Stresssituationen geraten [...]. Die Gesellschaft belohnt diese Vorbilder, indem sie ihnen zuspricht, was mit Geld nicht zu haben ist - eben den Status eines Heroen. Dieser wird geehrt als einer, der für die Werte einer Gesellschaft bis zum Äußersten einsteht. Ihm wird für seine Tat eine Form der Unsterblichkeit zugebilligt, die darin besteht, dass die als Helden Ausgezeichneten öffentlich geehrt werden und ihrer feierlich gedacht wird. Das ist eine Form auch der zivilgesellschaftlichen Währung, die mit der marktwirtschaftlichen Währung konkurriert.“ (Münkler 2002a)
Damit deutet sich an, wie sich der Gedenkkult um den Soldatentod in der heroischen von der der postheroischen Gesellschaft unterscheidet. Während er in der heroischen selbstverständlich ist (vgl. Bröckling 1997, S.103), bleibt er widersprüchlich zur Alltagskultur der postheroischen. Dies wird in Münklers Zitat dadurch kenntlich, dass sich die postheroische Gesellschaft in einer Ausnahmesituation befinden muss, damit sie den Heldentopos aufruft. Im Umkehrschluss kann gefragt werden, welchen gesellschaftlichen Platz den Helden zu normalen Zeiten eingeräumt wird. Im preußisch-deutschen Militarismus als Musterbeispiel des Ausdrucks einer heroischen Gesellschaft war die gesellschaftliche Achtung des Soldaten auch in Nicht-Kriegszeiten keine Frage. Münkler muss hier für unsere postheroische Gesellschaft die Einführung einer »Konkurrenzwährung« fordern. Diese, wie er sie bezeichnenderweise nennt, »zivilgesellschaftliche Währung«, hat als wesentliche Basis den Gedenkkult um den Soldatentod.
Dennoch lässt sich vermuten, dass die Produktivität des Gedenkkults in der Münklerschen Version beiweiten nicht diejenige des preußisch-deutschen Militarismus erreichen kann. Für die heroische Gesellschaft steigert jeder tote Soldat, zumindest wenn deren Zahl nicht über alle Maßen ansteigt, die Produktion an moralischen Ressourcen (vgl. Bröckling 1997, S.103). Dagegen muss in der postheroischen Gesellschaft die zivilgesellschaftliche Währung, sprich der Gedenkkult um den toten Soldaten, mit der marktwirtschaftlichen Währung der Alltagskultur konkurrieren. Mit dieser Konkurrenz verlässt Münkler gar nicht die Logik der marktwirtschaftlichen Währung, was für den preußisch-deutschen Militarismus als heroische Gesellschaft so kaum zugetroffen haben wird.
Das Ehrenmal als symbolisches Desaster
Aus dieser Bundeswehr-konstruktiven Innensicht Münklers lässt sich die eingangs gestellte Frage nach einem Wandel in der Funktion des Gedenkkults um den Soldatentod bejahen. Auch wenn man die vorgestellte Gesellschaftsanalyse Münklers als solche nicht teilt, können einige Schlussfolgerungen bezüglich des Ehrenmals der Bundeswehr gezogen werden. So ist zu prüfen, ob das Ehrenmal als Ausdruck einer postheroischen Heldenverehrung verstanden werden kann bzw. wie das Ehrenmal in einer postheroischen Gesellschaft funktioniert.
Um den zivilgesellschaftlichen Wert dieses rechteckigen Baukörpers von 8 x 32 Metern und einer Höhe von 10 Metern aufzuwerten, wurde er in den Rang eines Denkmals von nationalem Rang erhoben. Er kann in die Kulisse für die Ehrenformationen anlässlich verschiedener offizieller Anlässe eingebunden werden, die bereits auf dem Appellplatz des Bendlerblockes regelmäßig stattfinden. Hierzu wird die öffentliche Zugänglichkeit des Ehrenmals eingeschränkt. In Kontrast zu der - sieht man von dem Bronzekleid ab - äußerlichen Belanglosigkeit steht der Versuch der Anleihe an Formen des Heroischen für das Innere. So betritt man zunächst eine Säulenhalle, die auf eine »Cella« - auch »Raum der Stille« genannt - führt. Die Gestaltung der Cella mit Oberlicht und Opferbank lehnt sich deutlich an die Form der »Neuen Wache« nach deren Umgestaltung von 1931 an, wobei allerdings inzwischen der dortige Opferstein durch eine Pieta kohlscher Prägung ersetzt wurde.
„Der Raum der Stille wird zum Ort der Trauer. Das Innere dieses Raumes ist schwarz: Die realen Raumgrenzen lösen sich auf und dem Betrachter eröffnet sich ein entmaterialisierter Raum. So wie im Tod das Leben aus den Fugen gerät, erfährt die strenge Ordnung und tektonische Schichtung eine Irritation: Die letzte Bodenplatte hat sich aus der Ordnung des restlichen Ehrenmals gelöst und ist aus der Bodenebene herausgeschoben. Die Kraft, mit der sich scheinbar die Platte herausgeschoben hat, steht für das Ausmaß der Gewalt oder des Unglücks, welches ein Menschenleben hat enden lassen.“2
Die Übernahme dieser Gestaltungselemente, die in der heroischen Gesellschaft eine selbstverständliche Deutung fanden, ist als hilfloses Kopieren von Formen zu deuten; von Formen, die schwerlich heute noch funktionieren. Dies liegt sicherlich nicht nur daran, dass diese Selbstverständlichkeit in der postheroischen Gesellschaft so nicht gegeben ist, sondern auch an einem veränderten ästhetischen Empfinden. Ein Oberlicht erzeugt heute nicht mehr unbedingt eine weihevolle Stimmung; zumal jedes Blitzlicht das angebliche Verschwimmen der räumlichen Grenzen der dunklen, eigentlich nur durch das Oberlicht erhellten Cella zersetzt. Die Opferbank, gefährdet als Sitzgelegenheit missverstanden zu werden, wird mangels anderer Möglichkeiten als Kranzniederlegungsstelle verstanden; ansonsten erzeugt sie kaum das Interpretationsfeld eines Altars. Jenseits dieser misslungenen Versuche, an alte Gestaltungsformen anzuknüpfen, gibt es neue symbolische Elemente: die LCD-Projektion für die Namensnennung und das Bronzekleid.
„Die Nennung der Toten ist eine körperlose Schrift aus Licht. Die Darstellung wird mit einem LED-Display gelöst, das hinter transluzentem, also lichtdurchlässigem Beton in die Deckenplatte integriert ist. Die Namen erscheinen so scheinbar schwerelos im Raum.“ Etwa alle acht Sekunden ein neuer Name. Ein bisschen kurz für Münklers »Unsterblichkeit« als zivilgesellschaftliche Währung. Acht Sekunden sind kaum geeignet, Angehörige auch nur in irgendeiner Weise vergleichbar zu beeindrucken wie etwa am Vietnam Memorial in Washington, in dem die Namen auf »ewig« eingraviert sind. Diesem symbolischen Dilettantismus steht das Bronzekleid des Ehrenmals nicht nach: „Über die Stahlbetonkonstruktion ist ein feines durchbrochenes Bronzekleid gelegt. Jeder Soldat trägt eine Erkennungsmarke. Die halbe Erkennungsmarke steht für den Getöteten, für den Tod. In Anlehnung daran sind halbe Marken aus dem Bronzekleid gestanzt. Das ganze Objekt umhüllend, findet metaphorisch der alles umfassende Tod Ausdruck. Der Anordnung der ausgestanzten Marken liegt eine Codierung zugrunde, welche sich aus dem Morsealphabet ableitet. Die Stanzung stellt den Eid der Zeit- und Berufssoldaten, das Gelöbnis der Wehrdienstleistenden sowie den Amtseid der Wehrverwaltung in codierter Form dar.“ Von dieser für uninformierte BetrachterInnen unverständlichen Symbolik bleibt nur der Tod, in Form der halben Erkennungsmarken, als Ornament auf der Außenhaut des Ehrenmals übrig, denn der Morsecode ist per se für die allermeisten Menschen unverständlich. Darüber hinaus gibt es keine weitergehende erkennbare Symbolik am Äußeren des Ehrenmals. Mangels eines anderen Angebots an Symbolik verkommt damit der Soldatentod zu einer löchrigen Verzierung. In diesem symbolischen und ästhetischen Desaster hilft auch keine goldene Wand als abschließender Eindruck des inszenierten Aufenthalts im Ehrenmal mehr. „Beim Verlassen des Raumes geht der Besucher auf eine goldschimmernde Wand zu - Gold steht für das Übernatürliche und die daraus resultierende Hoffnung in allen Kulturen. Die Inschrift lautet: »Den Toten unserer Bundeswehr. Für Frieden, Recht und Freiheit.« Sie ist als glattes Relief aus der goldschimmernden Wand herausgearbeitet.“
Goldfarbe allein macht im Zeitalter der inflationären Goldkettchen nichts mehr edel, und übernatürlich schon gar nicht. Hier erliegen Planer und Auftraggeber außerdem einem groben semiotischen Irrtum: Nicht Gold an sich „steht für das Übernatürliche und die daraus resultierende Hoffnung in allen Kulturen“. Vielmehr werden Gegenstände, die mit einer solchen Hoffnung bereits verbunden sind, diese unterstreichend in goldenen Behältnissen bis hin zu ganzen Bauwerken verwahrt, oder durch das Anbringen von goldenen Zusätzen aufgewertet. Bisweilen werden die hoffnungsspendenden Gegenstände selbst aus Gold gefertigt so beispielsweise Reliquienschreine zur Aufbewahrung, Kronen als Aufsatz für Thorarollen und vergoldete Buddhastatuen.
Sind die Ideenlosigkeit und der schlechte Geschmack gewollt, um gesellschaftliche Auseinandersetzung zu vermeiden? Eine solche Strategie wäre gelungen, da sich kaum jemand für das Ehrenmal interessiert. Damit ist aber keine Annahme des Ehrenmals durch eine breite Öffentlichkeit abzusehen, wie es für ein Denkmal von nationalem Rang eigentlich geboten wäre. Noch schwerer wiegt für den Auftraggeber, dass das Ehrenmal der Bundeswehr wohl kaum die Münklersche Forderung nach einer zivilgesellschaftlichen Währung erfüllen kann. Dieses Ehrenmal kann keine »Form von Unsterblichkeit« für den Soldaten herstellen.
Bleibt zu fragen, ob sich die Auftraggeber und politisch Verantwortlichen auf Dauer mit den Unzulänglichkeiten des Baues abfinden werden, zumal ein intensiveres Engagement der Bundeswehr in Kriegen vermehrt zu toten Soldaten führen wird. In Konsequenz ist absehbar, dass das jetzige Ehrenmal durch eine bedeutendere Anlage ersetzt werden wird. Dieses neue Ehrenmal wird wahrscheinlich auch dem Ortswechsel des Gelöbnisses zum 20. Juli folgen, vom Bendlerblock zum Platz der Republik, zwischen Reichstag und Kanzleramt. In diesem Sinne kann auch das Ehrenmal als weiterer Schritt zur Normalisierung der aktiven Kriegsführung durch die Bundeswehr verstanden werden. Wie das Gelöbnis zum 20. Juli wird es zunächst im Schutzbereich des Geländes des Bundesverteidigungsministeriums selbst erprobt und durchgesetzt, um später zur vollständigen Entfaltung seiner kriegslegitimatorischen Wirkung ins repräsentative Zentrum der neuen Berliner Republik zu ziehen.
Literatur
Bröckling, Ulrich (1997): Disziplin. Soziologie und Geschichte militärischer Gehorsamsproduktion. München.
Giller, Joachim (1992): Demokratie und Wehrpflicht. (Reihe »Studien und Berichte« der Landesverteidigungsakademie Wien). Wien.
Küpeli, Ismail (2007): Einige Anmerkungen zu Kriegslegitimationen des 21. Jahrhunderts, in: Mühland, Rudolf u.a. (Hrsg.): Die neuen Kriege. Moers.
Münkler, Herfried (2002): Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg.
Münkler, Herfried (2002a): Interview in Focus Nr. 9, 2002.
Anmerkungen
1) Zitiert nach Giller 1992, S.40.
2) Diese und die folgenden Zitate stammen aus der Projektbeschreibung des Ehrenmals auf der Homepage des Bundesverteidigungsministeriums. Stand November 2009.
Eugen Januschke ist Semiotiker und engagiert sich in der DFG-VK Berlin-Brandenburg.