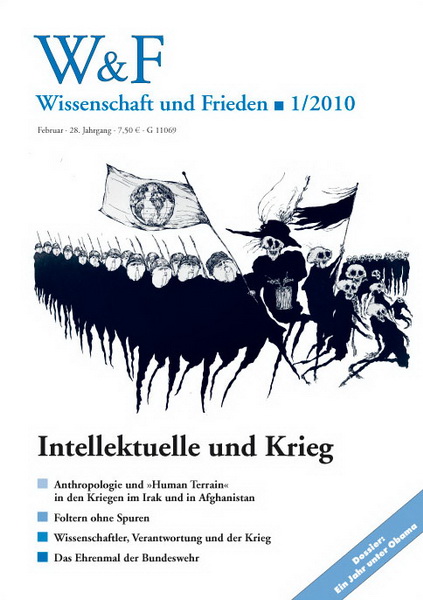Das televisuelle Sterben Neda Soltanis
Von Frank Möller
Fotografien sind Annäherungen an die einer jeweiligen Fotografie vorangegangene Realität - einer Realität, die die BetrachterInnen im Prozess des Betrachtens, Einordnens und Nachdenkens aufs Neue konstruieren. Während analoge Fotografie immer noch häufig als „Authentizitätsbeweis“ 1 (miss)verstanden wird, wird digitaler Fotografie infolge der Abwesenheit eines Originals und der technisch einfachen Manipulierbarkeit oftmals ein „Glaubwürdigkeitsproblem [...] in Sachen Quellenlage“ 2 unterstellt. Die Kritik ist wichtig, da wir uns im Zeitalter des Übergangs von analoger zu digitaler Produktionsweise von Bildern befinden. Somit werden auch Bilder von Kriegen und Konflikten zunehmend digital produziert und verbreitet. Die gedanklichen Kategorien, in denen wir über digitale Fotografie nachdenken, sind allerdings nach wie vor größtenteils durch unsere Erfahrungen mit analoger Fotografie geprägt. Daraus entsteht ein Spannungszustand, der durchaus produktiv genutzt werden kann.
Politische Reaktionen auf Bilder und auf die in Bildern dargestellten Bedingungen sind zu einem großen Teil von der Glaubwürdigkeit und der Authentizität der Bilder abhängig, genauer: davon, welches Maß an Glaubwürdigkeit den Bildern zugewiesen wird. Die Kritik an digitaler Fotografie überschätzt häufig das Glaubwürdigkeitsproblem digitaler Fotografie: die Abwesenheit eines Originals wird zumindest zum Teil durch die Anzahl digitaler Fotografien eines jeweiligen Ereignisses ausgeglichen; digitale Fotograf(i)en kontrollieren sich gegenseitig. Die Kritik überschätzt aber auch die Authentizität analoger Fotografie, die keine originalgetreue Abbildung von Realität sein kann, sondern immer nur Annäherung an Realität, aber trotzdem - oder gerade deshalb - „neues Wissen“ 3 produziert. Andernfalls bräuchten wir sie nicht.
Durch kommentierende, die Glaubwürdigkeit von Bildern scheinbar stärkende Texte wird versucht, den BetrachterInnen die Gewissheit zu vermitteln, die Bilder allein nicht zu liefern vermögen und nach der die BetrachterInnen angeblich verlangen. Natürlich sind es nicht die Bilder, die „beanspruchen ›komplexe Phänomene zu verdichten und Geschichte stellvertretend wiederzugeben‹.“ 4 Derartige Ansprüche sind Projektionen und Wunschvorstellungen derjenigen, die über Bilder schreiben und ihnen diese Aufgaben - Komplexitätsverdichtung und stellvertretende Wiedergabe der Geschichte - ungeachtet der Tatsache zuweisen, daß Bilder einen „Überschuß an Bedeutung“ 5 vermitteln, der die Idee der Komplexitätsverdichtung durch Bilder fragwürdig erscheinen läßt.
Wegweiser und Direktiven
Walter Benjamin sah in der Beschriftung den „wesentlichsten Bestandteil der Aufnahme“ 6 - »Wegweiser«, die das zu Sehende in das Sag- und Schreibbare übersetzen, »Direktiven«, die den BetrachterInnen sowohl das erklären, was sie sehen können als auch das, was sie nicht sehen können, vor allem aber das, was sie sehen sollen. Sprache macht Bilder beherrschbar, indem sie den visuellen Überschuss an Bedeutung scheinbar reduziert. Sprache richtet das Visuelle an den zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer gegebenen Gesellschaft herrschenden Sagbarkeitsregeln aus. Das, was nicht gesagt werden kann oder darf, wird tendenziell aus dem Repertoire möglicher Interpretationen eines Bildes ausgeschlossen. Damit wird das Potential von Bildern, als Quelle möglicher alternativer Wissensproduktion zu dienen, erheblich eingeschränkt; Bilder werden unschädlich, unsichtbar gemacht.
Für Benjamin spielte es keine Rolle, ob es sich bei den Wegweisern um richtige oder falsche handelte: „Richtige oder falsche - gleichviel.“ 7 Michel Foucault würde argumentieren, daß es »richtige« Wegweiser überhaupt nicht geben kann: „Es ist vergebens, dass wir sagen, was wir sehen. Was wir sehen, ist in dem, was wir sagen, nie anwesend.“ 8 Der Gedanke, dass wir nicht genau wissen können, was wir sehen; dass wir, selbst wenn wir es wüssten, keine Worte hätten, um es adäquat auszudrücken; und dass das, was wir sehen, nie identisch ist mit dem, was wir sagen, ist zweifellos eine Provokation für sprach- und schriftfixierte westliche Wissensgesellschaften. Diese Gesellschaften sind zwar Bildergesellschaften, wissen aber mit Bildern selten mehr anzufangen als sie in Sprache zu »übersetzen« oder als »Illustrationen« des sprachlich zum Ausdruck Gebrachten einzusetzen - in der irrigen Annahme, dass solche »Übersetzungen« unproblematisch seien.9 Der Direktor von Yale University Press, John Donatich, begründete zum Beispiel seine Entscheidung, in einem neuen Buch über die dänische Cartoonkrise die Cartoons nicht zu reproduzieren, unter anderem mit dem Hinweis darauf, dass sie akkurat in Worten beschrieben werden könnten.10 Diese Begründung dokumentiert bestenfals Donatichs Naivität oder Unwissenheit hinsichtlich der Beziehung zwischen Worten und Bildern.
Der von Bildern vermittelte „Überschuß an Bedeutung [ist] besonders dann problematisch, wenn Fotografien eine soziale Aufgabe erfüllen sollen.“ 11 Er kann mittels Sprache nur scheinbar reduziert werden, verrät diese sprachliche Vermittlung doch mehr über die der Sprache zugrundeliegenden Regeln und Konventionen und über das, was in einer jeweiligen Sprache ausgedrückt werden kann, als über die Bilder, denen die BetrachterInnen sprachlich angeblich nähergebracht werden, von denen sie sich aber durch sprachliche Vermittlung eher entfernen. Ohne „Direktiven, die der Betrachter von Bildern [...] durch die Beschriftung erhält“, muss „alle photographische Konstruktion im Ungefähren stecken bleiben“ 12, aber auch mit »Wegweisern« läßt sich das „Ungefähre“ (Benjamin) nur scheinbar überwinden und die „Echtheit“ (Schulz-Ojala) eines Videos oder einer anderen Form visueller Repräsentation nur scheinbar belegen. Bergers und Luckmanns soziologisch konkretes „Wer spricht?“ 13 wird denn auch viel zu selten im Zusammenhang mit Interpretationen visueller Konstruktionen der Realität gefragt, obwohl derartige Interpretationen weitreichende politische Folgen haben können: der »Krieg gegen den Terrorismus« wäre ein anderer geworden, wären die Bilder vom 11. September 2001 als Ausdruck eines kriminellen Akts und nicht eines terroristischen Anschlags interpretiert worden. Die interpretatorische Verengung des Bildes eines Menschen auf das Bild eines »Terroristen«, in anderen Worten: die sprachliche und nur scheinbar bildhafte Konstruktion eines »Terroristen« hat weitreichende Bedeutung sowohl hinsichtlich der Überlebenschancen dieses Menschen als auch hinsichtlich der Leichtigkeit, mit der dieser Mensch straffrei getötet werden kann. Indem die BetrachterInnen darauf verzichten, die sprachliche Verengung der Bedeutung eines Bildes regelmäßig hinsichtlich der ihr zugrunde liegenden politischen Motivationen und Interessen zu hinterfragen, erhöhen sie ihre eigene Verwicklung in und Verantwortung für die in einem jeweiligen Bild dargestellten Bedingungen.
Von »Masseneremiten« zu globalen Zuschauern
In modernen Bildergesellschaften ist Hinschauen die Bedingung der Möglichkeit politischen Handelns. Robert Hariman und John Louis Lucaites haben gezeigt, dass der individuelle Betrachter und die individuelle Betrachterin nur als Mitglied der visuell-diskursiv konstituierten politischen Öffentlichkeit und als Teil potentiellen kollektiven Handelns in Reaktion auf Bilder und die darin gezeigten politischen und sozialen Bedingungen politisch handeln können. Die Tätigkeit des Zuschauens sei nicht als passives Konsumieren, sondern als aktive Tätigkeit zu verstehen, die die politische Öffentlichkeit konstituiere. Nur als Teil dieser visuell hergestellten Öffentlichkeit könnten der und die Einzelne hoffen, politischen Einfluss auszuüben.14 Günter Anders' »Masseneremit« wird bei Hariman und Lucaites zum »common spectator«, der wiederum in den virtuellen Welten des Internet zum globalen Zuschauer mutiert.
Wer hinschaut - und hinschauen muss, wer politisch handeln will - wird aber auch zu einem Teil des durch massenhaftes Hinschauen konstruierten Ereignisses und verliert seine oder ihre Neutralität hinsichtlich dieses Ereignisses. Damit werden der Betrachter und die Betrachterin tendenziell für das Ereignis mitverantwortlich. Diese Mitverantwortung betrifft nicht nur fotografische Repräsentation. In seinem Gemälde »Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko« (1868/69) hat der Maler Edouard Manet die Verwicklung des Publikums in die dargestellte Szene durch den Schatten des Betrachters/der Betrachterin angedeutet, der in dem Gemälde vor dem Unteroffizier erscheint.15 Was tun wir da, was haben wir da zu suchen? Sind wir Beobachter oder teilnehmende Beobachter, d.h. nehmen wir dadurch, dass wir uns eine Darstellung der Erschießung anschauen, in irgendeinem Sinne an der Erschießung selber teil? Gibt es irgendetwas, das wir hätten tun können, um die Hinrichtung zu verhindern? Vielleicht schauen wir ja gar nicht hin und drehen der Exekution(szene) den Rücken zu, erschrocken über das, was passiert und unfähig, es zu verhindern, auf unserem Recht, nicht hinzuschauen, beharrend?
Die Mitverantwortung des Betrachters und der Betrachterin ist besonders deutlich bei Verbrechen, die begangen werden, um Bilder zu erzeugen: „Wenn das Töten eines Menschen den Zweck hat, seinen Tod zum Bild werden zu lassen, dann ist das Betrachten dieses Bildes unabdingbar ein Akt der Beteiligung.“ 16 Enthauptungen vor laufender Kamera sind einschlägige Beispiele, aber auch die notorischen Abu Ghraib-Fotografien fallen in diese Kategorie, vor allem die am 7. November 2003 entstandenen Aufnahmen der »menschlichen Pyramide«, die - im Gegensatz zu früheren Inszenierungen - die Herstellung von Bildern zum Ziel hatten.17 Auch die Anschläge vom 11. September 2001 hatten maximale Sichtbarkeit zum Ziel.
Wer nicht hinschaut, unterminiert die Absicht der Täter. Wer nicht hinschaut, trägt nicht zu dem bei, was Mieke Bal als „sekundäre Ausbeutung“, als „zweites Leiden“ und als „Diebstahl der Subjektivität“ bezeichnet.18 Wer nicht hinschaut, verweigert sich den Funktionsmechanismen moderner Bildergesellschaften, und eine solche Verweigerungshaltung kann an sich schon als Kritik dieser Gesellschaften und der ihr zugrunde liegenden diskursiven Regeln verstanden werden. Wer nicht hinschaut, grenzt sich aber auch aus der visuell konstruierten politischen Öffentlichkeit aus und kann auf die abgebildeten Bedingungen politisch nicht reagieren. Auch deshalb bestehen Kunsthistoriker darauf, den in Abu Ghraib entstandenen Aufnahmen große Aufmerksamkeit zu widmen und sie in die Bildergeschichte einzuordnen, um damit die „moralische Blindheit“ zu entlarven, die Abu Ghraib erst möglich gemacht habe.19 Nicht hinzuschauen bedarf angesichts der Flut von Bildern, der wir heutzutage zu jedem Zeitpunkt ausgesetzt sind, einer außergewöhnlichen Willensanstrengung, und die Augen vor dem Leiden anderer Menschen zu verschließen, ist alles andere als moralisch unproblematisch. Wenn Hinschauen die Bedingung der Möglichkeit politischen Handelns ist, würden wir uns, wenn wir uns außerhalb der visuell-diskursiv konstruierten politischen Öffentlichkeit positionierten, eben dieser Möglichkeit berauben. Wir würden zur Unsichtbarkeit der Opfer und damit zum endgültigen Triumph der Täter beitragen.
Fotokritik, Repräsentation und Ästhetisierung
Die Mitverantwortung der BetrachterInnen ist nicht auf die Aufnahmen von Verbrechen begrenzt, die begangen wurden, um Bilder zu produzieren. Sowohl Bal als auch Mark Reinhardt betonen die Mitverantwortung der BetrachterInnen im Zusammenhang mit Bildern von leidenden Menschen - Reinhardt mit Blick auf die Abu Ghraib-Fotos („die Gesichter der Gefolterten starren uns an in einem Moment nicht nur der Angst und Qual, sondern auch der Scham. Und wir verlängern diese Scham durch unser Schauen“), Bal mit Blick auf James Nachtweys Fotografien hungernder Menschen im Sudan („ihr Leiden zu betrachten [...] kommt einer zusätzlichen Ausbeutung gleich“).20 Jenny Edkins hat jedoch darauf hingewiesen, dass viele Fotografien Sebastião Salgados, der auch oftmals mit dem Vorwurf der visuellen Ausbeutung seiner Subjekte konfrontiert wird, von seinen Subjekten in Auftrag gegeben wurden.21 Auch Jonathan Torgovniks Subjekte bestanden darauf, fotografiert zu werden; für sie waren die Fotos nicht Diebstahl ihrer Subjektivität, sondern Ausdruck ihrer Fähigkeit, als Subjekte zu handeln.22 Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, dass ausgerechnet Angehörige des US-Militärs für sich das Recht in Anspruch nehmen, die Augen vor den Abu Ghraib-Bildern zu verschließen. In den Worten eines Generalleutnants: „Ich will nicht dadurch einbezogen warden, dass ich hinschaue; denn was macht man mit diesen Informationen, wenn man einmal weiß, was sie zeigen?“.23
Fotografen wie Nachtwey und Salgado werden regelmäßig der Ästhetisierung ihrer Subjekte beschuldigt - eine absurde Kritik, da jegliche Repräsentation ästhetisiert: die Möglichkeit, zu repräsentieren und dabei nicht zu ästhetisieren besteht nicht. Auch „das schmucklose, schnell hochgeladene und eben nicht komponierend gearbeitete Bild“ des Sterbens Neda Soltanis ästhetisiert, aber angeblich depolitisiert und desensibilisiert es die BetrachterInnen nicht, da der Mangel an kompositorischer Finesse „unmittelbare ästhetische Plausibilität“ nach sich ziehe.24
Repräsentation ästhetisiert notwendigerweise und Ästhetisierung depolitisiert tendenziell, da sie die Aufmerksamkeit der BetrachterInnen vom repräsentierten Subjekt zur formalen Qualität und Schönheit eines Fotos lenkt. Aber das Schöne kann auch als Aufforderung zu politischem Handeln verstanden werden25, und der Mangel an künstlerischer Finesse politisiert die BetrachterInnen nicht automatisch. Die wenigen existierenden Aufnahmen des 1994 in Ruanda an der Tutsi-Minderheit verübten Völkermords zum Beispiel erzeugten den Eindruck, es handele sich um eine spontane, archaische Stammesfehde und nicht um einen modernen, staatlich organisierten und sehr effizienten Völkermord. Bilder von mit Macheten, Keulen und Knüppeln bewaffneten Menschen dienten als Vorwand, um politische und militärische Passivität zu rechtfertigen, indem sie westliche Vorurteile gegenüber Afrika zu bestätigen schienen.26 Diesen Fotografien gelang es nicht, politisches Bewusstsein zu schaffen; sie scheiterten an der Abwesenheit der „Existenz eines relevanten politischen Bewusstseins“, auf das Bilder angewiesen sind, um die BetrachterInnen moralisch zu beeinflussen.27
Dass Fotografien durch ständige Wiederholung ihre Wirkung verlieren, ist ein weiteres, oft gehörtes Argument. Im Zusammenhang mit fotografischen Holocaust-Repräsentationen ist von politischer, technologischer und moralischer Gewöhnung gesprochen worden.28 Allerdings gelten Nick Uts berühmtes Foto »Accidental Napalm« aus dem Vietnamkrieg und Robert Capas ebenso berühmte Aufnahme »Fallen Soldier« aus dem Spanischen Bürgerkrieg trotz tausendfacher Reproduktion nach wie vor als Ikonen des Fotojournalismus' und der Antikriegsfotografie. Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, unter welchen Bedingungen Capas Foto entstanden ist und wen oder was es tatsächlich darstellt. Die Einbußen an Glaubwürdigkeit, die das Foto infolge neuerer Forschungen hat hinnehmen müssen29, haben das Ikonografische der Aufnahme nicht beeinträchtigen können. Im Zusammenhang mit dem Video des Sterbens Neda Soltanis gibt es deshalb auch zunächst einmal keinen Grund a priori davon auszugehen, daß sich „mit der ständigen Wiederholung [...] das Ikonografische des Videos [entleert]“.30
Die Macht der Summe der kleinen Schritte
Wer hinschaut, muß reagieren, besser noch: angemessen reagieren. Doch die Unmöglichkeit, angemessen auf Bilder menschlichen Leidens zu reagieren, wird in der Literatur genauso häufig betont wie die Unmöglichkeit, menschliches Leiden angemessen darzustellen. Sharon Sliwinski argumentiert, dass die Reaktion der BetrachterInnen auf Bilder menschlichen Leidens niemals adäquat sein könne, da sie nicht imstande sei, das abgebildete Leiden zu lindern. Für Jenny Edkins muss die Reaktion auf individuelle Bilder individuellen Leidens immer inadäquat sein, da sie notwendigerweise alle anderen Fälle menschlichen Leidens verraten müsse, die es gleichermaßen verdient hätten, unterstützt zu werden. John Berger, die möglichen Reaktionen auf zwei - Verzweiflung und Empörung - reduzierend, argumentiert, dass die BetrachterInnen auf das Gefühl ihrer moralischen Unzulänglichkeit, das Kriegsbilder zu vermitteln imstande seien, entweder mit Achselzucken oder damit reagieren könnten, was Berger „Buße tun“ nennt, zum Beispiel mit einer Spende für eine gemeinnützige Organisation.31
Aus Harimans und Lucaites' Argument folgt allerdings, dass wir unsere Augen vor Bildern wie denen vom Sterben Neda Soltanis nicht verschließen dürfen. Nur als Teil der visuell-diskursiv konstruierten politischen Öffentlichkeit können wir hoffen, politisch wirksam zu werden. Die Unsichtbarkeit ihres Todes würde eine politische Reaktion unmöglich machen und letztendlich auf den Erfolg ihrer Mörder hinauslaufen. Aus diesem Argument folgt weder, dass wir mehr als einmal hinschauen müssen, noch dass uns das Anschauen der Bilder das Wesen des Regimes in Teheran erklärt. Aus dem Argument folgt allerdings, dass der einzelne Betrachter und die einzelne Betrachterin nicht so hilflos sind, wie es die Literatur häufig suggeriert. Eine angemessene Reaktion auf Bilder menschlichen Leidens kann nicht in der isolierten einzelnen Reaktion individueller Betrachter und Betrachterinnen bestehen, sondern immer nur in der Summe der notwendigerweise inadäquaten individuellen Reaktionen einzelner Betrachter und Betrachterinnen als Teil der kollektiv-diskursiv-visuell konstituierten politischen Öffentlichkeit.32 Aus dieser Sicht gibt es keinen Grund, auch der kleinsten und scheinbar unbedeutendsten individuellen Reaktion ihre Legitimität, ihren Sinn und ihre Angemessenheit abzusprechen.
Anmerkungen
1) Vgl. Karsten Polke-Majewski (2009): Lasst der Sterbenden ihre Würde, in: Zeit Online, 24.06.2009.
2) Jan Schulz-Ojala (2009): Ich bin Neda, in: Zeit Online, 23.06.2009.
3) Alex Danchev (2009): On Art and War and Terror. Edinburgh: Edinburgh University Press, S.36.
4) Vgl. Fußnote 1, die Historikerin Cornelia Brink zitierend.
5) Barry King (2003): Über die Arbeit des Erinnerns. Die Suche nach dem perfekten Moment, in: Herta Wolf (Hrsg.): Diskurse der Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters. Frankfurt: Suhrkamp, S.180.
6) Walter Benjamin (1963): Kleine Geschichte der Photographie, in: ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt: Suhrkamp, S.64.
7) Benjamin (1963): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt: Suhrkamp, S.21.
8) Michel Foucault (1994): The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books, S.9.
9) Vgl. David MacDougall (1998): Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press.
10) Vgl. Patricia Cohen (2009): Yale Press Bans Images of Muhammad in New Book, in: The New York Times, 13.08.2009.
11) Vgl. Fußnote 5, S.180.
12) Vgl. Fußnote 7, S.21; Fußnote 6, S.64.
13) Peter Berger & Thomas Luckmann (1967): The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin, S.134.
14) Robert Hariman & John Louis Lucaites (2007): No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy. Chicago und London: The University of Chicago Press.
15) Vgl. Frank Möller (2008): The Implicated Spectator: From Manet to Botero, in: Matti Hyvärinen und Lisa Muszysnki (Hrsg.): Terror and the Arts: Artistic, Literary, and Political Interpretations of Violence from Dostoyevski to Abu Ghraib. New York: Palgrave, S.25-31.
16) Horst Bredekamp (2004): Wir sind befremdete Komplizen, in: Süddeutsche Zeitung 28.05.2004, S.17.
17) Philip Gourevitch & Errol Morris (2008): Standard Operating Procedure: A War Story. London: Picador, S.196-197.
18) Mieke Bal (2007): The Pain of Images, in: Mark Reinhardt, Holly Edwards & Erina Duganne (Hrsg.): Beautiful Suffering: Photography and the Traffic in Pain (Williamstown/Chicago: Williams College Museum of Art/The University of Chicago Press), S.95.
19) Stephen F. Eisenman (2007): The Abu Ghraib Effect. London: Reaktion Books, S.9.
20) Mark Reinhardt (2009): Picturing Violence: Aesthetics and the Anxiety of Critique, in: ders., Holly Edwards & Erina Duganne (Hrsg.): Beautiful Suffering: Photography and the Traffic in Pain, S.21; vgl. Bal, Fußnote 19, S.95.
21) Jenny Edkins (2005): Exposed Singularity, in: Journal for Cultural Research Jg. 9, No. 4, S.363.
22) Jonathan Torgovnik (2009): Intended Consequences: Rwandan Children Born of Rape. New York: Aperture.
23) Seymour Hersh (2007): The General's Report: How Antonio Taguba, who investigated the Abu Ghraib scandal, became one of its casualties, in: New Yorker, 25.06.2007.
24) Vgl. Fußnote 2.
25) David Levi Strauss (2003): Between the Eyes: Essays on Photographs and Politics. New York: Aperture.
26) Vgl. Linda Melvern (2000): A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide. New York: Zed Books.
27) Sontag: Über Fotografie, S.24.
28) Barbie Zelizer (1998): Remembering to Forget: Holocaust Memory through the Camera's Eye. Chicago und London: The University of Chicago Press.
29) Vgl. Giles Tremlett (2009): Wrong place, wrong man? Fresh doubts on Capa's famed war photo, in: The Observer 14.06.2009.
30) Vgl. Fußnote 1.
31) Sharon Sliwinski (2004): A Painful Labour: Responsibility and Photography, in: Visual Studies Jg. 19, No. 2, S.154-156; Edkins (Fußnote 21), S.372; John Berger (2003): Photographs of Agony, in: Liz Wells (Hrsg.): The Photography Reader. New York und London: Routledge, S.288-290.
32) Frank Möller (2009): The Looking/Not Looking Dilemma, Review of International Studies Jg. 35, No. 4, S.781-794.
Dr. Frank Möller ist Research Fellow am Tampere Peace Research Institute, Universität Tampere, Finnland, und Mitglied des Finnish Center of Excellence Political Thought and Conceptual Change, Forschungsteam Politics and the Arts (frank.moller@uta.fi).