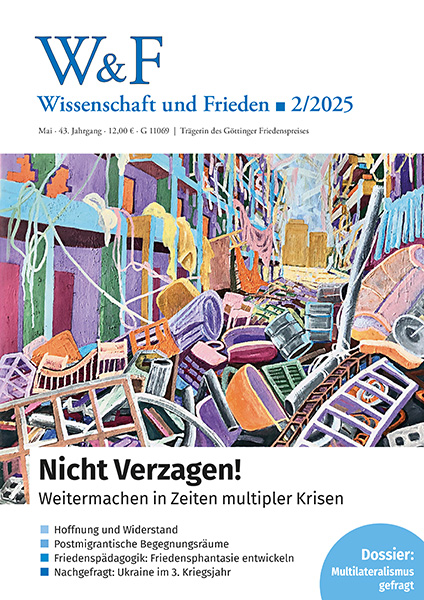Demonstrieren – und was dann?
Jahrestagung des Bund für Soziale Verteidigung, Hannover, 4.-6. April 2025
Vom 4. bis zum 6. April 2025 fand in Hannover die Jahrestagung des Bund für Soziale Verteidigung (BSV) zum Thema » Demonstrieren – und was dann? Gesellschaft gestalten – Demokratie schützen – Gewaltfrei aktiv gegen Rechts!« statt. Rund 55 Teilnehmende diskutierten Strategien gegen die zunehmende Bedrohung der Demokratie durch die extreme Rechte – mit einem besonderen Fokus auf gewaltfreie, zivilgesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten.
Den Auftakt machte Prof. Virchow mit einem Vortrag zur Entwicklung der extremen Rechten, in dem er die AfD als Sammelbewegung nationalistischer, neoliberaler und völkischer Strömungen analysierte. Er beschrieb deren Strategie aus Diskurshoheit, Polarisierung und dem Schüren von Ängsten, sowie der Etablierung rechter „Normalitätsdimensionen“. Virchow forderte in seiner Rede, die demokratische Selbstwirksamkeit zu stärken und notfalls auch ein AfD-Verbot zu prüfen.
Praxisbeispiele und internationale Erfahrungen
Als praktisches Beispiel demokratischer Selbstwirksamkeit erörterte Thomas Handrich, wie die rechtsnationale PiS in Polen 2023 abgewählt werden konnte. Hierbei hob er hervor, dass es keine rein parteipolitische Antwort auf Rechtspopulismus gäbe. Denn ein wichtiger Faktor sei u.a. die gesellschaftliche Mobilisierung im Sinne einer erhöhten Wahlbeteiligung. Großes Potenzial hierfür sah er insbesondere unter Frauen, die sich durch verschärfte Abtreibungsgesetze sehr stark organisierten. Entscheidend sei aber auch ein positives Narrativ der Opposition gewesen, welches etwa im »Marsch der Millionen Herzen« seinen Ausdruck fand. Mit Blick auf Deutschland warnte Handrich, Rechtspopulismus könne nur durch eine echte soziale und demokratische Erneuerung überwunden werden.
Jan Stehn gab einen Einblick in die Strukturen des Autoritarismus. Er analysierte, wie autoritäre Herrschaft auf loyalen Eliten, Anhängerschaft und der Unterdrückung der Opposition beruhe. Entscheidender noch als die Selbstinszenierung des vermeintlich »starken Mannes« selbst (Trump, Putin, Modi etc.), sei die Kontrolle über Ressourcen und Angst. Hoffnung machte schließlich sein Befund in einer Studie der Autor*innen Nord et al (2025), die 102 Fälle (im Zeitraum von 1900 bis 2023) der Rückkehr zur Demokratie nach einer Autokratisierung untersucht, dass in 61 % der Fälle autoritäre Tendenzen durch zivilgesellschaftlichen Widerstand erfolgreich gestoppt werden konnten.
In einer abschließenden Fishbowl-Diskussion zum Austausch über die Vorträge, wurde kontrovers debattiert, ob und wie Dialoge mit AfD-Anhänger*innen möglich seien. Konsens bestand darin, klare Grenzen zu ziehen: Dialog – ja, mit Menschen aus dem persönlichen Umfeld; aber organisierten Rechten keine Bühne zu bieten – schon gar nicht auf Kosten von Menschenrechten. Auf praktischer Ebene wurden Erfahrungen aus Serbien, den Malediven oder dem Sudan ausgetauscht die zeigten, dass kreative und humorvolle Aktionen effektiv sein können, um Angstbarrieren zu überwinden und Zivilcourage zu fördern.
Vom Wissen ins Handeln
In vier parallelen Workshops wurden am Samstagnachmittag konkrete Handlungsmöglichkeiten vertieft: Im Workshop »Parolen Paroli bieten« wurde Zivilcourage durch gewaltfreies Eingreifen in Diskriminierungssituationen anhand der Methode des »Forumtheaters« geübt. In einem Workshop sahen die Teilnehmenden die eindrucksvolle Dokumentation »Jamel – Lauter Widerstand«, ein Film über das Festival »Jamel rockt den Förster« und den Widerstand hiergegen im von Neonazis geprägten Dorf Jamel (Mecklenburg-Vorpommern). Im Anschluss konnte mit der Initiatorin über Erfahrungen und Herausforderungen gesprochen werden. Unter dem Titel „Was tun gegen Rechtsextremismus in Chatgruppen und sozialen Medien?“ wurden praktische Strategien vorgestellt, um Hassrede sichtbar zu widersprechen, Betroffene zu unterstützen und digitale Räume aktiv, offen und solidarisch zu gestalten. In der Arbeitsgruppe „Soziale Verteidigung gegen Rechtsextremismus“ wurden Ansätze vorgestellt, wie durch Erzählcafés, Dialogformate und lokale Vernetzung gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt, rechtsextreme Veranstaltungen durch Gegenreden und das Besetzen von Sitzplätzen gestört und Betroffene durch Schutzstrukturen wie Telefonketten oder Mediationsteams unterstützt werden können.
Eigene Narrative statt Abwehrhaltung
Ein roter Faden zog sich durch alle AGs und darüber hinaus: Nicht allein Reaktion auf rechtsextreme Angriffe sei nötig, sondern die aktive Gestaltung gesellschaftlicher Räume und der Demokratie – sichtbar, positiv und vernetzt. In vielen Diskussionen kam somit immer wieder eine Variation der Frage auf, wie demokratische Werte stärker positiv vermittelt und gelebt werden können. Statt sich vor allem an rechten Bedrohungen abzuarbeiten und dem Hass »nur« entgegenzutreten, müsse eine eigene, überzeugende Vision eines »guten Lebens für alle« formuliert werden. Es wurde immer wieder betont, wie wichtig es sei, Demokratie positiv zu framen und klare, menschenrechtsbasierte Alternativen zu rechtsextremen Narrativen zu entwickeln. Eine inklusive und solidarische Gesellschaft müsse sich auch sprachlich selbstbewusst präsentieren, wozu gehöre, Begriffe bewusst zu wählen und umzudeuten.
Der Weg zu einem solchen »guten Leben für alle« erfordert Mut, Ausdauer und die bewusste Gestaltung solidarischer Strukturen – gerade in Zeiten des Rechtsrucks. Thomas Handrich brachte es mit Ernst Blochs Worten auf den Punkt: „Wir müssen uns ins Gelingen verlieben – nicht ins Scheitern.“
Dalilah Shemia-Goeke