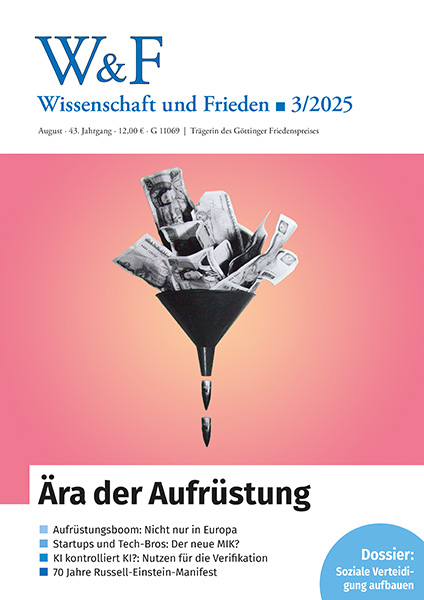Günter Verheugen, Petra Erler (2024): Der lange Weg zum Krieg. Russland, die Ukraine und der Westen: Eskalation statt Entspannung. München: Heyne. ISBN 978-3-4532-1883-3, 336 S., 24 €.
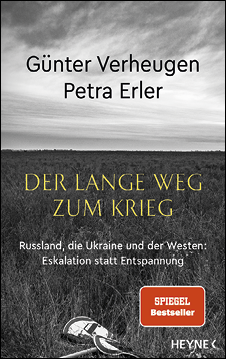
Gleich zu Beginn eines aufschlussreichen Vorworts sprechen die Autor*innen – im Folgenden: V&E – von eigener, seit Jahren „wachsender Sorge“ über eine zunehmende Verschlechterung des Verhältnisses zwischen dem Westen und Russland (S. 9). Diese persönliche Betroffenheit geht einher mit einer markanten Distanzierung von einem aus ihrer Sicht „falschen Kriegsnarrativ, einem gefährlichen Kriegsziel und einer Propagandawelle“, die jeden denunziere, der diesen Krieg anhalten wolle, sich jedoch dem sachlichen Diskurs verweigere (S. 10).
„Aus Sorge um die Zukunft […]“ hoffen dagegen der Autor und die Autorin, „dem Frieden dienen“ zu können, indem sie „über die Zusammenhänge und Hintergründe“ informieren „die zum aktuellen Krieg führten“ – und das als Voraussetzung sachgerechter Folgenabschätzung und korrigierenden Eingreifens (S. 11). Als Grundlage dieser Aufklärungsarbeit wird insbesondere geltend gemacht: „Gerade dem erklärten Gegner sollte man immer sehr genau zuhören“, um möglichst „[…] die Realität komplett wahrzunehmen“ (S. 12).
Über diese allgemeine Charakterisierung ihres Ansatzes hinaus skizzieren V&E im Vorwort auch bereits ihr grundlegendes Konfliktverständnis. Gegen die herrschende zentrale These, der Ukraine-Krieg sei ein anlassloser Überfall des aggressiven Russland auf ein friedvolles demokratisches Land, getrieben von „imperialen Gelüsten und Vernichtungswut“ (S. 12), konstatieren sie: „Die militärische und politische Expansion verlief von West nach Ost.“ (S. 13) Dabei seien in einer zentralen Frage der internationalen Beziehungen, in der Frage der Sicherheit von Staaten, „legitime russische Interessen […] über Jahrzehnte“ (ebd.) missachtet worden. Es gehe demnach nicht um einen Systemkonflikt zwischen Autokratie und Demokratien, wohl aber um strikte Gegnerschaft gegen eine „Weltordnung, die von den USA dominiert“ werde (S. 15). Dabei sei „die Absicht, Putin zu stürzen […] Teil der aktuellen Kriegsführungsstrategie des Westens“ (S. 14) – das allerdings „auf dem Rücken […] der Ukraine“ (S. 16).
V&E versichern, weder Putin weißwaschen noch einen westlichen »regime change« in Russland unterstützen zu wollen. Sie sehen auch nicht nur ein Ost-West-Problem. Und wie bei jedem Sicherheitsproblem sei eine Lösung nur einvernehmlich zu erreichen: indem man sich über die legitimen Sicherheitsinteressen verständige und an einer Struktur arbeite, die allen Seiten genüge. Damit stelle sich die Frage nach Möglichkeiten einer konstruktiven Entwicklung einer internationalen Friedensordnung in der Perspektive Gemeinsamer Sicherheit und sei die Befassung mit entspannungspolitischen Erfahrungen angesagt. Für V&E ist Entspannung jedenfalls kein gescheitertes politisches Projekt; gescheitert sei vielmehr eine Politik, die glaube, auf Entspannung verzichten zu können.
Anders als der Haupttitel ihres Buches vielleicht erwarten lässt, geht es V&E in den neun Kapiteln des Bandes nicht nur um eine mehr oder weniger kleinteilige diachronische (längsschnittliche) Darstellung, wie es auf der zwischenstaatlichen Ebene zum kriegerischen Konfliktaustrag gekommen ist. Ihr Interesse ist einerseits zwar auf eine differenziert ausgefächerte Darstellung dieser Entwicklung gerichtet, andererseits aber auch auf tieferliegende, die Entwicklung bestimmende »Treiber« und deren Zusammenspiel. Relevant ist diese eher synchronische (querschnittliche) Perspektive nicht zuletzt im Hinblick auf die Frage, welche Wege aus der Misere führen (könnten). Den Untertitel des Bandes, die Phrase »Eskalation statt Entspannung«, mag man als Hinweis darauf lesen.
Das Eröffnungskapitel ist weitgehend durch diesen synchronischen Angang geprägt. Dabei geht es allerdings nicht um einen kurzen Zeitabschnitt im Verlauf des Ereignisstroms sondern um die gesamte Verlaufszeit. Vor dem Hintergrund einer kritischen Beleuchtung der hinlänglich bekannten Elemente der westlichen »offiziellen Erzählung« arbeiten V&E (die) Grundzüge der Konfliktkonstellation und -dynamik entsprechend der eigenen Gegenerzählung heraus.
In dem thematisch zentralen, durchgehend diachronisch angelegten zweiten Kapitel werden die »Schritte in den Krieg« differenziert beleuchtet. Als Beginn der kritischen Entwicklung gelten die Konferenzen von Jalta und Potsdam (1945); sie seien bereits durch gravierende Interessen- und Auffassungsdivergenzen beschwert gewesen. Spätestens mit der Gründung der Nato (1949) setzte der Kalte Krieg ein mit zunehmender Fixierung auf die Doktrin der militärischen Abschreckung, begleitet von Worst-Case Szenarien und ständigen Versuchen, die militärstrategische Parität zu unterlaufen. Nur Kennedy und im Besonderen Gorbatschow hätten einen neuen, kooperativen und inklusiven Weg des Zusammenlebens gesucht.
Mit der Auflösung des Warschauer Pakts jedoch und der Sowjetunion war für die USA, so die Autor*innen, der Weg frei zum Zenit ihrer globalen Machtprojektion. Man habe sich als „unverzichtbare Nation“ begriffen, getragen von einem entsprechend imperialen geo-ökonomischen und -politischen Denken. In diesem Kontext, insbesondere in Überlegungen, wie es gelingen könne, die „einzige Weltmacht“ zu bleiben, nahm die Ukraine einen prominenten Platz darin ein, „wie man Russland schwächen und destabilisieren könnte“ (S. 61). Zudem kam der in der ersten Clinton-Ära offen einsetzende Nato-Expansionskurs ausdrücklich den Sicherheits- und Entwicklungsinteressen der im vormals sowjetischen Raum entstandenen Demokratien entgegen. Dagegen bevorzugte Russland unter Jelzin, und zunächst auch unter Putin, eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur unter dem Dach der KSZE/OSZE – nicht zuletzt im Blick auf die Gefahr einer sicherheitspolitischen Isolierung ihres Landes.
Die erste Nato-Osterweiterung (1999), der Nato-Angriff etwa zwei Wochen später auf das befreundete Serbien, auch der zur Beschwichtigung russischer Vorbehalte geschaffene Nato-Russland-Rat, habe Russland, so V&E, vor Augen geführt, dass seine Stimme in der Nato unerheblich war. Versuche Putins einer Annäherung an die Nato seien nicht zuletzt an der Gegenläufigkeit zweier mächtiger Tendenzen gescheitert, die aus russischer Sicht die internationalen Beziehungen bestimmen: eine Tendenz zu Multilateralismus und die Tendenz westlicher Staaten unter Führung der USA zu Dominanz und einseitigen Lösungen (unter Umständen auch unter Umgehung des internationalen Rechts und unter Anwendung von militärischer Gewalt). Diese zweite Tendenz wirke aus Russlands Sicht destabilisierend für die internationale Sicherheit und stelle im Besonderen eine fundamentale Gefahr für die eigene Sicherheit dar. Mit der Kündigung des ABM-Vertrags durch die Bush-Administration 2002 sei zudem ein „wichtiger Baustein“ entfallen, „um das Wettrüsten zwischen atomar bewaffneten Supermächten zu begrenzen und das Verlangen nach Erwerb einer Erstschlagfähigkeit auszuschalten“ (S. 70). Eine schwere Irritation im Verhältnis zur Nato ergebe sich für Moskau auch aus der Planung und dem Aufbau von US-Raketenabwehrsystemen in Polen, Rumänien und Tschechien; man befürchte, dass damit die eigenen Abschreckungs-Kapazitäten unterlaufen werden sollten.
Die drei folgenden Kapitel stellen im Wesentlichen spezialisierende Fortsetzungen des zweiten Kapitels dar. Diese Kapitel behandeln u.a. das „Tauziehen um die Ukraine“ ab dem Nato-Gipfel 2008 (in Kap. 3), den nach V&E vor allem US-getriebenen „endlose(n) Kalte Krieg“ (Kap. 4) und das „gefährliche Erbe“ der „politischen Auflösung der Sowjetunion“ (Kap. 5). In Kapitel sechs blicken V&E auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine nach 1989 bis heute. In Kapitel sieben steht dann der politisch-praktische Ansatz, die entspannungspolitische Erfahrung zur Diskussion. Kapitel 8 beinhaltet eine Auseinandersetzung mit dem Überleben der Menschheit in einer (multipolaren) Weltfriedensordnung als höchstem Zielwert (U Thant) und mit (den) diesbezüglichen Ansätzen und Widerständen. Im Abschlusskapitel neun erörtern V&E vor dem Hintergrund der Rolle Deutschlands in der Konfliktgeschichte die sich daraus für unser Land ergebende besondere Herausforderung: „seine Macht in der EU für den Frieden [zu] nutzen“ (S. 8).
Der Band von V&E dürfte zu den anregendsten und gehaltvollsten Beiträgen gehören, die auf dem deutschsprachigen Debatten-Markt zum Krieg um die Ukraine in Umlauf sind. Der besondere Wert des Bandes liegt nicht einfach darin, dass die hierzulande politisch wie medial herrschende Ukraine-Erzählung hinterfragt wird, sondern vor allem darin, wie diese Erzählung hinterfragt wird: auf solider Fakten-Basis, analytisch anspruchsvoll, konzeptionell breit und umfassend und nicht zuletzt beseelt von einer tragfähigen politischen Ethik und vermittelt mit authentischem Engagement – und zwar in konsequent interaktionistischer Perspektive.
Dagegen muss irritieren, dass Russlands Invasion mehrmals als „völkerrechtswidrig“ gebrandmarkt wird, in variierender Form und mit unterschiedlicher Intensität, jedoch quasi beiläufig, ohne Erläuterung, Begründung und kritische Diskussion und ohne Einbezug der gegnerischen Sicht. Dem kriegs-politischen Gewicht des Völkerrechtswidrigkeits-Verdikts wird diese »Behandlung« sicher nicht gerecht.
Eine andere Schwäche betrifft die inhaltliche Erschließbarkeit des Bandes. Die eindrucksvolle Fakten-Fundierung schlägt sich im Wesentlichen im »Apparat« nieder. Der aber liegt in Form von über 600 Anmerkungen fast nur im Web-Link-Format am Ende des Bandes vor. Wahrscheinlich können sich daher nur wenige »Überzeugungstäter*innen« darauf einlassen, die eine oder andere dieser Quellen zu konsultieren. Schließlich hätte der Band mit einem Personenregister, vor allem aber mit einem Sachregister erheblich an »Gebrauchswert« gewinnen können.
Trotz dieser Schwächen, der sich aus den Stärken des Buches von Verheugen und Erler ergebenden Empfehlung „Nimm und lies!“ tun sie kaum Abbruch – vorausgesetzt, es geht einem um die Sache.
Albert Fuchs