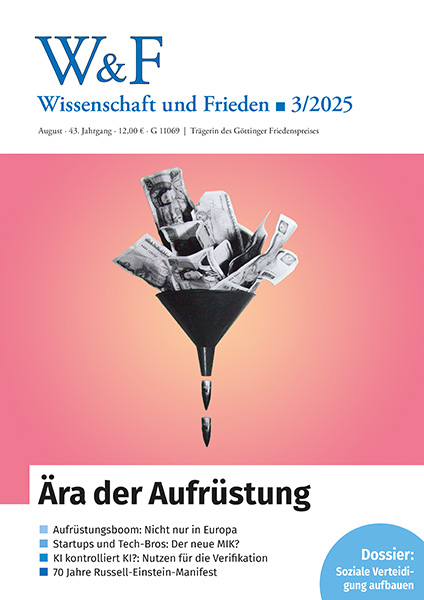Rolf Cantzen (2025): Deserteure. Die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht. Springe: zu Klampen Verlag. ISBN 978-3-9873-7030-4, 202 S., 28,00 €.
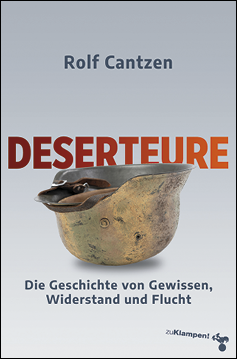
Mit einer gewissen Spitze, fast Häme, in jedem Fall aber mit einer verdichteten Analyse davon, inwieweit Militarisierungstendenzen in den letzten Jahren in aller Breite im Diskurs Einzug gehalten haben, endet das hier rezensierte Buch – und zwar, indem von einem Flugblatt der Grünen nach dem Bayreuther Parteitag 1990 zitiert wird: „Verweigert den Kriegsdienst, verlaßt die Armee! […] Sagt Nein!“ (S. 187) Eine heute kaum vorstellbare Position linksliberaler Parteien.
Darin kommt eine Haltung und eine politische Figur zum Ausdruck, die historisch im wörtlichen Sinn totjudiziert und gegenwärtig zumindest totgeschwiegen wird: der Deserteur. Vor allem im Nationalsozialismus waren die Erschießungen und Verurteilungen jener, die sich dem Kriegsdienst verweigerten, sehr hoch – die Forschung spricht von ca. 30.000 Menschen; für die Sowjetunion geht man von weit höheren Zahlen aus. Die Auseinandersetzung mit jenen, die nicht für Führer, Volk und Vaterland kämpfen wollten, bildet das Zentrum von Rolf Cantzens soeben erschienenem Buch: das ist schade und logisch zugleich, denn für die deutsche Geschichte muss über diesen Abschnitt in dieser Ausführlichkeit berichtet werden, gleichzeitig wäre ein breiterer Blick lohnenswert. Das markiert Cantzen jedoch schon in der Einleitung: „Doch auch anderswo verstaatlicht der nationalisierte und militarisierte Staat seine Einwohner.“ (S. 10) Dass das Sprechen mit Deserteuren, das Nachdenken über sie und die Solidarisierung mit ihnen internationalistisch sein muss, ist jedoch den gesamten Ausführungen dieses jüngst erschienenen Buches selbstverständlich – insgesamt ist Cantzen seine Empörung über das Besprochene anzumerken, was dem Thema guttut.
In relativ zugänglicher Sprache skizziert Rolf Cantzen also die Geschichte von „Männern, die sich dem Krieg und Militär entziehen“ (S. 9). In einer Fußnote und auch später im Text verweist er auch auf die patriarchale Dimension des Militärs und dessen Kehrseite, verkörpert im feigen Deserteur, der sich der »Manneszucht« verweigert. Allerdings, so Cantzens Analyse, könne dieses Bild auch brechen und quasi patriarchalen Impulsen folgen: Der Deserteur „will ein freier Mann sein.“ (S. 9)
Cantzen verarbeitet in dem Buch seine umfassenden Recherchen für eine Sendung im Rahmen der Reihe »Lange Nacht« im Deutschlandradio. Das dreistündige (sehr hörenswerte) Feature „Nicht töten und nicht getötet werden“ wurde 2024 mit dem Alternativen Medienpreis ausgezeichnet – in komprimierter Form wird hierin ein geschichtlicher Überblick zu Deserteuren und Kriegsdienstverweigerung gegeben. Dass Cantzens Auseinandersetzung nun als Buchform vorliegt, ist sehr erfreulich. Die im Radio mit unterschiedlichen Stimmen markierten Passagen aus (oft verstörenden) Verordnungen, Todesurteilen usw. wurden im Text gesondert gesetzt und bereichern diesen als eine Art Primärquelle. Zwar hauptsächlich für den deutschen Kontext und ein breites Publikum, dafür aber umso anschaulicher, werden so die geschichtlichen Kontinuitäten und auch Veränderungen jener nachgezeichnet, die Loyalitäten verweigerten, Angst um sich und ihre Familien hatten, ihrem Gewissen folgten, sich schlicht weigerten, in Uniform zu marschieren, zu töten und getötet zu werden.
Die Geschichte der Desertion vor dem Ersten Weltkrieg fällt etwas kurz aus, bringt jedoch eine wesentliche Entwicklung auf den Punkt, nämlich jene von Söldnerheeren zur nationalen Armee. Der sich erst im 19. Jahrhundert ausprägende Nationalismus und Patriotismus veränderte nicht nur die geopolitische und militärische Struktur Europas, sondern letztlich auch die Figur des Deserteurs und dessen Diffamierung: „Der Deserteur war nun endgültig nicht nur mehr ein Feigling, sondern auch ein Vaterlandsverräter.“ (S. 29) Am Vorabend des Ersten Weltkrieges schwankte zwar die nationale Kriegstüchtigkeit in nationalistische Kriegseuphorie um, allerdings traten auch vielfältige pazifistische und antimilitaristische Bewegungen auf den Plan. Und nicht nur an dieser Stelle des Buches liegen Parallelen zur Gegenwart und die Anforderungen an diese auf der Hand. Zugleich tritt hier eine analytische Dimension des Buches in den Vordergrund, das sich ansonsten meist zurückhält: „Deserteure, Überläufer, Fahnenflüchtige, Unangepasste, Wehrdienstentzieher und andere sind in militärrechtlicher Hinsicht vor allem eins: Störfaktoren, Sand im Getriebe, etwas, das die Ansprüche von Staat und Nation auf den Einzelnen infrage stellt.“ (S. 44) Diese staatskritische Perspektive widerspricht also einer gefügigen Betriebsblindheit. Hier muss jeder Einspruch – und dieses Buch ist ein solcher – willkommen sein.
Insgesamt lassen sich einige Passagen des Buches im Licht des zeitgenössischen Diskurses – Remilitarisierung, Wehrhaftigkeit, Kriegstüchtigkeit – lesen und darauf nimmt Cantzen immer wieder Bezug. Der Fokus auf den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus liegt aus unterschiedlichen Gründen nahe; besonders anschlussfähig für die Gegenwart werden dann vor allem seine Überlegungen zu den unterschiedlichen Motiven von Wehrmachtsdeserteuren, die Hauptgrund für ihre Bewertung von außen wurden: „Die einen nobilitieren Deserteure mit Verweis auf ihre ethischen und politischen Motive. Die anderen unterstellen Eigennützigkeit, Egoismus, Charakterlosigkeit und eine verbrecherisch-asoziale Haltung.“ (S. 103)
Vor allem die juristischen, diskursiven und personellen Kontinuitäten im Post-Nationalsozialismus beleuchtet Cantzen, etwa in Bezug auf den ehemaligen Baden-Württembergerischen Ministerpräsidenten Filbinger, der im Faschismus mehrere Deserteure zum Tode verurteilt hatte und quasi aus dem Rückblick damaliger Rechtsprechung zu legitimieren versuchte: „Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein.“ (S. 151)
Die Debatte über die Legitimation von Kriegsdienstverweigerung und die Frage, welcher Deserteur »gut« oder »schlecht« sei, wurde im Kontext von DDR und BRD ideologisch ausgeschlachtet: Desertion war auf der einen Seite ein Problem des Klassenkampfes, auf der anderen Seite eine heldenhaft Tat im Sinne westlicher Freiheit. Die hochstilisierten Kämpfer wurden also dergestalt idealisiert „und damit genau das, was zu dieser Zeit die Deserteure der Wehrmacht nicht sein durften“ (S. 163). Dieser Widersprüchlichkeiten ist sich Cantzen bewusst und benennt sie in unterschiedlichen Zusammenhängen – was auch für die Gegenwart von Relevanz ist, wobei sich hier die Widersprüche verkomplizieren, etwa wenn »böse und verdächtige Russen aus einem Angriffskrieg« desertieren, aber dennoch kaum Asyl erhalten, oder »gute Ukrainer, die aber eigentlich ihr Land verteidigen sollten«, wodurch sie „noch ein bisschen ‚böser’“ (S. 177) werden.
Dass der Band etwas schmal geraten und nicht zu einer breiten wissenschaftlichen Abhandlung oder gar zu einem Handbuch geronnen ist, ist einerseits bedauerlich, andererseits darf sich das Thema dadurch eine größere Zugänglichkeit und Rezeption erhoffen. Zudem finden sich ausreichend Referenzen im Buch, sodass eine solide Mischung aus Lesbarkeit und Fundiertheit vorliegt.
Deserteure widersprechen nicht nur dem Militarismus an sich, sondern tun dies auch aus einer oft anti-institutionellen Perspektive – in militaristischen Zeiten, in denen Institutionen in die Krise geraten und Krisen (und Kriegen) kaum etwas entgegenzuhalten vermögen, gewinnt die Figur des Verweigerers wohl wieder an Bedeutung. Wie das tatsächlich in eine kollektive Handlungsfähigkeit münden kann, bespricht Cantzen zwar nicht – dass seine Auseinandersetzungen jedoch dazu anregen, sei uns allen gewünscht.
Jakob Frühmann