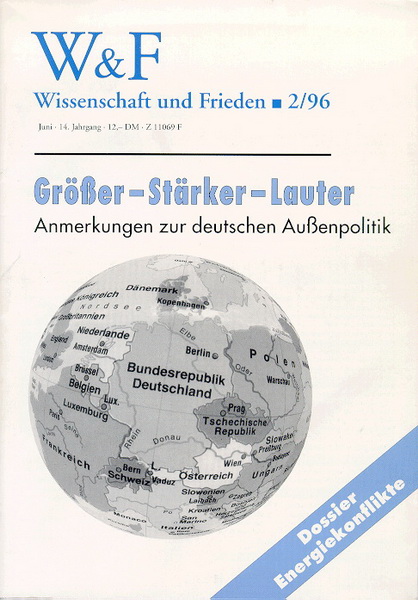Deutsche Außenpolitik und die NATO-Osterweiterung
von Berthold Meyer
Die Debatte um die Osterweiterung der NATO hat das Bündnis in eine Sackgasse geführt, aus der es nur schwerlich herausgelangen kann. Losgetreten wurde diese Debatte Anfang 1993 vom deutschen Verteidigungsminister Volker Rühe, der allerdings mit seinen Plädoyers für die Aufnahme Polens und anderer mittel- und osteuropäischer Staaten unter seinen Amtskollegen zunächst einmal allein dastand. Vor allem die USA zeigten sich unter dem damaligen Pentagonchef Les Aspin nicht daran interessiert, dem Drängen der Mittel- und Osteuropäer nach Westen weiter nachzugeben, als ihnen zusätzlich zu ihrer Mitgliedschaft im Ende 1991 gegründeten NATO-Kooperationsrat eine „Partnerschaft für den Frieden“ anzubieten.
Erst nachdem der vorher als US-Botschafter in Bonn tätige Richard C. Holbrooke im Sommer 1994 zum Unterstaatssekretär für Europaangelegenheiten im State Department aufgestiegen war, kam es zu einer Kehrtwende in der amerikanischen Haltung, der sich die Gremien des Bündnisses auf ihren Herbsttagungen 1994 anschlossen und die Offenheit der NATO für neue Partner verkündeten. Zugleich machten sie dort allerdings deutlich, daß sie mit Rußland zwar besondere Beziehungen pflegen, es jedoch nicht in die NATO aufnehmen wollen. War die Stimmung zwischen dem westlichen Bündnis und der russischen Regierung schon das ganze Jahr 1994 hindurch nicht mehr so entspannt wie in der ersten Phase nach der Auflösung der Sowjetunion, so wurde sie um diese Zeit geradezu frostig.1
Seither sind zwar die Sicherheitspolitiker der Allianz lebhaft darum bemüht, aus ihren Dreiecksbeziehungen zu den mittel- und osteuropäischen Staaten, die darauf warten, in die NATO aufgenommen zu werden, einerseits und der Rußländischen Föderation, die sich durch einen solchen Schritt brüskiert und bedroht sieht, andererseits kein »Bermuda-Dreieck« werden zu lassen, in dem die europäische Sicherheit verloren gehen könnte. Doch will dies so recht nicht gelingen, zumal auf manchen Emissär des Westens das bekannte Bismarck-Wort zutrifft: „Sie sind wohl ein Gesandter, aber kein geschickter“.
Auch wenn momentan noch nicht entschieden ist, mit welchen Ländern wann über einen Beitritt verhandelt werden soll, heißt es in Bonn und anderen westlichen Hauptstädten trotz der fortdauernden russischen Kritik, es gebe kein Zurück. Worin liegen die Hauptgründe für die Verhärtungen und ist es noch möglich, den durch die Aufnahme einiger Staaten zu erwartenden Schaden zu begrenzen und welche Rolle könnte die Bundesrepublik hierbei spielen? Bevor versucht wird, hierauf eine Antwort zu geben, soll die Entwicklung der Bonner Positionen zur Osterweiterung skizziert werden.
Wer bestimmt eigentlich die deutsche Außenpolitik?
Als am Ende des Ost-West-Konfliktes der Eiserne Vorhang zwischen den bis dahin gegnerischen Blöcken fiel, wurde der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher nicht müde zu erklären, Europa ende nicht an der polnischen Ostgrenze. Für ihn bestand kein Zweifel daran, daß auch die Sowjetunion und ihre Nachfolgestaaten in den europäischen Kontext eingebunden werden mußten. Dabei dachte er aber in erster Linie an einen weiteren Ausbau der KSZE sowie an vertragliche Bindungen an die Europäische Gemeinschaft. Und er glaubte wie sein amerikanischer Kollege James Baker, der Sorge vor einem durch die Auflösung des Warschauer Paktes entstehenden Machtvakuum durch die Schaffung des Nordatlantischen Kooperationsrates entgegenwirken zu können. Genscher und andere kooperationsfreudige Politiker sahen nicht, daß sie damit bei den mittel- und osteuropäischen Staaten, die sich magnetisch vom reichen und stabilen Westen angezogen fühlten, eine Erwartungshaltung erzeugten, die sie auch mittelfristig nicht einlösen konnten, ohne das zu gefährden, was die Attraktivität von Europäischer Union und NATO ausmacht. Dennoch gelang es bis zum Ende der Ära Genscher (Mai 1992) durch ein variantenreiches Spiel zwischen Hinhalten und Entgegenkommen allen Beteiligten wie auch der Öffentlichkeit zu vermitteln, daß Europa wirtschaftlich und (sicherheits-)politisch zusammenwachse.
Sechs Wochen bevor Genscher sein Amt an Klaus Kinkel übergab, hatte im Verteidigungsministerium ebenfalls ein Stabwechsel stattgefunden. Dem unambitionierten Gerhard Stoltenberg war der bisherige CDU-Generalsekretär Volker Rühe gefolgt, von dem bekannt war, daß er lieber das von der FDP uneinnehmbar besetzte Außenministerium geleitet hätte. Rühe begriff jedoch schnell, daß sich ihm nach Genschers Abtritt auch außenpolitische Profilierungsmöglichkeiten boten, zumal ihm Kinkel hierfür Raum ließ und Bundeskanzler Kohl von seiner Richtlinienkompetenz zumindest keinen öffentlichen Gebrauch machte. So kam es, daß in der wichtigen Frage der Osterweiterung der NATO, in der eigentlich eine enge Abstimmung zwischen dem Verteidigungs- und dem Außenministerium zu erwarten gewesen wäre, die beiden Ressortchefs grundverschiedene Prioritäten setzen konnten.
Auf der einen Seite vermochte der Verteidigungsminister schon früh „keinen stichhaltigen Grund dafür sehen, künftigen Mitgliedern der Europäischen Union die NATO-Mitgliedschaft vorzuenthalten. Ich frage mich auch, ob die Mitgliedschaft in der Europäischen Union unbedingt dem Beitritt zur NATO vorausgehen muß.“ In derselben Rede schloß Rühe aber wegen der „riesigen Potentiale und (der) geostrategische(n) Lage Rußlands“, die europäische Dimensionen sprengen, dessen „Mitgliedschaft in der Europäischen Union und in unseren Bündnissen aus.2 Vor allem warb Rühe immer wieder für eine schnelle Öffnung. In seinen Reden schob er dabei gelegentlich ein Argument nach, das zeigt, daß er weniger die Wünsche der Beitrittskandidaten im Auge hat als das „vitale Interesse Deutschlands", so jüngst bei einem Vortrag am 1. Mai 1996 in Washington: „Auf Dauer ist es nicht haltbar, wenn Deutschlands Ostgrenze die Grenze zwischen Stabilität und Instabilität in Europa ist. Deutschlands Ostgrenze kann nicht die Ostgrenze von Europäischer Union und Nato bleiben. Entweder wir exportieren Stabilität oder die Instabilität kommt zu uns.“3
Grenzen des Bündnisses dürfen nicht einfach von der Elbe an den Bug verschoben werden
Auf der anderen Seite vertrat Außenminister Kinkel von Anfang an eine Position, die dem Weg über die EU den Vorrang einräumte. Mit der Assoziierung sei den Visegrad-Staaten (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn / Red.) „die klare Perspektive einer künftigen Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union, und damit auch in der WEU, angeboten“ worden. „Europa öffnet sich so auch im Bereich der sicherheitspolitischen Institutionen.“ Ob jedoch auch eine Mitgliedschaft in der NATO in Frage komme, müsse in engster Abstimmung mit den Partnern, vor allem den USA, die zu dieser Zeit eindeutig nicht dafür waren, geprüft werden. Jedenfalls dürften die Grenzen des Bündnisses „nicht einfach von der Elbe an den Bug verschoben werden.“ 4 Damit nahm er auf russische Empfindlichkeiten Rücksicht, wobei er bis zum August 1994 sicher auch im Auge hatte, daß es galt, den Abzug russischer Truppen aus Deutschland nicht zu gefährden. Doch auch über diesen Zeitpunkt hinweg steht bei Kinkel immer wieder die aus der Ära Genscher übernommene Forderung nach einer Integration Rußlands in die europäische Sicherheitsarchitektur im Vordergrund.
Der Bundeskanzler schien die Osterweiterung lange Zeit nicht zur Chefsache machen zu wollen. Einerseits ließ er Rühe gewähren, sicher auch, weil dessen Öffnungsrhetorik in Polen freundlich aufgenommen wurde. Zum anderen zeigte er aber bei verschiedenen Gelegenheiten ebenso wie Kinkel Verständnis für russische Bedenken. Besonders deutlich sagte er dies auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik am 3./4. Februar 1996: „An die Öffnung der NATO müssen wir mit Sorgfalt und politischer Umsicht herangehen, da es dabei um Schritte von grundlegender Tragweite für das Bündnis selbst und für die Sicherheit in einem kommenden Europa geht. Wir Deutsche und Europäer haben ein elementares Interesse daran, daß die NATO auch in Zukunft stabil und handlungsfähig bleibt. Wir haben aber auch größtes Interesse daran, ein partnerschaftliches, freundschaftliches Verhältnis zu Rußland und der Ukraine zu entwickeln. Wir müssen die wohlverstandenen Sicherheitsinteressen Rußlands und der Ukraine berücksichtigen. Es versteht sich dabei von selbst, daß es für eine Frage dieser Bedeutung nur schädlich sein kann, wenn sie zum Thema in dem russischen, aber auch in dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf würde.“ 5
Der letzte Satz wurde als Plädoyer verstanden, die Debatte zumindest bis nach der amerikanischen Präsidentenwahl ruhen zu lassen. Als Kohl dann aber im russischen Wahlkampf seinem Freund Jelzin zu Hilfe kommen wollte, und dabei gleichermaßen Verständnis für die russischen Sicherheitsbelange äußerte wie auch für das Recht anderer Staaten plädierte, sich für ein Bündnis zu entscheiden, erntete er nur einen »Wutausbruch« Jelzins.6
Weiter im Spagat?
Während sich das Bundesverteidigungsministerium im Herbst 1995 bemühte, Moskau dadurch Wind aus den Segeln zu nehmen, daß es die Sprachregelung herausgab, künftig statt des expansiv klingenden Begriffs der »Erweiterung« den der »Öffnung« des Bündnisses zu verwenden, veröffentlichte die NATO zur gleichen Zeit selbst ihre »Studie über die Erweiterung der NATO« (Study on NATO-Enlargement). Dieses vom Ministerrat in Auftrag gegebene Dokument soll Grundlage für die Verhandlungen mit beitrittswilligen Staaten sein. Es beschreibt aber auch das künftige Verhältnis zu Rußland. Wer diese Studie genauer gelesen hat,7 wundert sich danach nicht mehr darüber, daß die Allianz, die hier einen extremen Spagat versucht, zumindest im russischen Fettnapf gelandet ist. Verwundern muß allerdings, daß die Bundesregierung diesem Dokument zugestimmt hat, das trotz einer Vorbereitungszeit von neun Monaten nicht als ausgereift bezeichnet werden kann.
Es enthält auf der einen Seite einen ganzen Katalog von bereits getroffenen Vereinbarungen wie auch von beabsichtigten Übereinkünften, die auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen der NATO und Rußland zielen und dazu beitragen sollen, das „aus der Zeit des Kalten Krieges übriggebliebene Mißtrauen“ zu überwinden und mitzuhelfen, „dafür zu sorgen, daß Europa nie wieder in feindliche Lager gespalten wird“. 8 Dabei übersehen die Autoren der Studie keineswegs, daß Rußland wegen der Erweiterung »Besorgnis geäußert« hat. Doch meinen sie allem Anschein nach, daß es neben den vielfältigen Kooperationsabsichten ausreiche, dem Kreml ein um das andere Mal zu sagen, „daß diese Erweiterung, einschließlich der damit verbundenen Militärabkommen, niemanden bedroht und zur Entwicklung eines breiten europäischen Sicherheitssystems auf der Grundlage echter Zusammenarbeit in ganz Europa beiträgt und die Sicherheit und Stabilität für alle erhöht.“ 9
Da die NATO bis dahin mit dem bloßen Gut-Zureden keinen Erfolg hatte, muß also gefragt werden, wie die Autoren der Studie dies Rußland klarmachen wollen. Aus der Zeit des Kalten Krieges sollte noch bekannt sein, daß die Beteuerung des eigenen Friedenswillens für die Bedrohungswahrnehmung der anderen Seite weit weniger wichtig ist als die Einschätzung des Bedrohungspotentials, vor allem der räumlichen Nähe und Konzentration der Streitkräfte und der Reichweite der Waffensysteme. Hier ist der Hauptgrund dafür zu suchen, warum von den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, allen voran von Rußland, die Ausdehnung des NATO-Gebietes in das durch den Rückzug der Sowjet-Streitkräfte entstandene Machtvakuum bis an die unmittelbaren Grenzen des einstigen Imperiums als eine ernste potentielle Bedrohung ihrer Sicherheit gesehen wird. Es hätte also darum gehen müssen, diese Sorgen nicht nur mit freundlichen Worten, sondern durch unmißverständliche vertrauensbildende Maßnahmen zu entkräften.
Genau das Gegenteil geschieht jedoch in dem Kapitel der NATO-Studie, das die militärischen Aspekte des Beitritts und die dazugehörige Hardware diskutiert. Zwar müßten die neuen Mitglieder nicht schon vor ihrem Beitritt die volle Interoperabilität erreicht haben, aber sie würden „doch gewisse Mindestnormen erfüllen müssen, die für ein funktionsfähiges und glaubwürdiges Bündnis unerläßlich sind.“ 10 Dazu gehöre auch, „alle gemäß dem Washingtoner Vertrag anfallenden Pflichten (zu) übernehmen“ und vor allem bereit zu sein, „nach Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung beizutragen“.11
Konkretisiert wird dies an den Forderungen, daß die Streitkräfte des Bündnisses „zur Verstärkung, für Übungen, für das Krisenmanagement und gegebenenfalls zur Stationierung Zugang zum Hoheitsgebiet“12 dieser Staaten haben müßten, wenn dies zweckmäßig erscheine. Außerdem wird von den neuen Mitgliedern Unterstützung für das Konzept der nuklearen Abschreckung erwartet. Zwar gebe es „keine A-Priori-Forderung für die Stationierung von Nuklearwaffen auf dem Hoheitsgebiet neuer Mitgliedstaaten“. Doch weil Köpfe, die einmal das Worst-Case-Denken trainiert haben, dieses offenbar nicht mehr aufgeben können, folgt dann eine Passage, die deutlich macht, daß man aber auch nicht a priori generell oder dauerhaft auf eine Stationierung verzichten möchte: „Es besteht … zur Zeit keine Notwendigkeit, irgendwelche Änderungen oder Modifizierungen am Nuklearpotential oder an der Nuklearpolitik der NATO vorzunehmen; die langfristigen Auswirkungen einer Bündniserweiterung in diesen beiden Bereichen werden jedoch Gegenstand weiterer Beurteilung bleiben. Die NATO sollte ihr vorhandenes Nuklearpotential zusammen mit ihrem Recht zur Modifizierung ihrer nuklearen Kräftegliederung bewahren, sofern die Umstände dies rechtfertigen. Neue Mitglieder müssen wie die derzeitigen Bündnisstaaten die Entwicklung und Durchführung der Stategie der NATO einschließlich ihrer nuklearen Komponenten fördern.“13
Die Perspektive auch nur einer möglichen Stationierung konventioneller NATO-Streitkräfte, mehr aber noch die der Dislozierung von Nuklearstreitkräften auf dem Staatsgebiet neuer Mitglieder mußte in Rußland alarmierend wirken. Insofern durfe gerade Bundeskanzler Kohl von Präsident Jelzins Wutausbruch nicht überrascht sein, brauchte er sich doch nur an die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen über die deutsche Einheit zu erinnern, in denen die sowjetische Seite darauf bestanden hatte, daß es keine Stationierung alliierter Truppen in den neuen Bundesländern und auch keine Atomwaffen auf diesem Territorium geben darf. Dabei gab es damals noch ihr Glacis in Form der Warschauer Vertragsstaaten. Warum sollte Rußland heute Verständnis dafür haben, daß ebendort mit Argumenten wie dem Rüheschen, man müsse Stabilität exportieren, damit die – nicht offen ausgesprochene, aber gemeinte russische – Instabilität nicht importiert werde, NATO-Streitkräfte oder gar Atomwaffen disloziert werden? Es spricht zumindest gegen das diplomatische Fingerspitzengefühl der für die Veröffentlichung der Studie Verantwortlichen, Rußland gleichzeitig zu umwerben und zu brüskieren.
Ist Schadensbegrenzung noch möglich?
Wenn von der Regierung Deutschlands und anderer NATO-Staaten gegenwärtig betont wird, in der Frage der Osterweiterung gebe es kein Zurück, dann bedeutet dies nicht zugleich, es werde auch vorwärts gehen. Erst bei den Herbsttagungen des Bündnisses im Dezember 1996 soll darüber gesprochen werden, welche Länder wann für eine Aufnahme infrage kommen. Damit beginnt eine in mehrfacher Hinsicht schwierige Phase:
- Werden nämlich zunächst nur wenige der an einem Beitritt interessierten Staaten (Polen, Tschechien und vielleicht Ungarn) zu Verhandlungen eingeladen, so werden sich andere zurückgesetzt fühlen. Zu derartigen Kränkungen kam es schon bei dem Besuch von Verteidigungsminister Rühe im August 1995 in den baltischen Staaten, als er ihnen unverblümt erklärte, sie würden zumindest nicht unter den ersten sein, die aufgenommen würden.
- Sollte die Allianz aber mit allen Kandidaten gleichzeitig die Verhandlungen aufnehmen, so müßte sie mit einer weiteren Abkühlung ihres Verhältnisses zu Rußland rechnen.
- In beiden Fällen stellt sich aber das Problem, daß einige NATO-Mitglieder nur sehr geringes Interesse an der Erweiterung des Bündnisses haben, so daß sie eventuell darauf bestehen werden, Kandidaten erst dann aufzunehmen, wenn sie die in der Studie beschriebenen Bedingungen der Interoperabilität ihrer Rüstungen erfüllt haben. Da dies sehr kostspielig ist, wird es auch zeitaufwendig werden und ebenfalls zur Folge haben, daß einige Länder dieses Ziel früher als andere erreichen.
- Doch auch dann ist noch längst nicht garantiert, daß alle sechzehn Mitglieder die Aufnahmeverträge ratifizieren. Ebensowenig ist sicher, daß nach der Erweiterung um eine erste Gruppe diese neuen Mitglieder der Aufnahme weiterer Länder zustimmen, obwohl dies in der Studie verlangt wird.
Es ist also eine Vielzahl von spannungsgeladenen Konstellationen zu erwarten, die entweder einem künftigen Zusammenhalt des Bündnisses oder dessen Beziehungen zu den nicht oder noch nicht aufgenommenen Ländern Mittel- und Osteuropas einschließlich Rußland schaden können. Damit stellt sich die Frage, wie in der schon jetzt ziemlich verfahrenen Situation weiterer Schaden vermieden oder begrenzt werden kann.
Mit Blick auf Moskau wäre vermutlich schon viel erreicht, wenn die NATO verbindlich erklärte, daß sie »rebus sic stantibus« keinen Anlaß sehe, bei neuen Mitgliedern Bündnistruppen und Nuklearwaffen zu stationieren. Gerade die Bundesregierung müßte ein besonderes Interesse daran haben, daß es relativ nahe an seinen östlichen Grenzen nicht zu einer permanenten Krisenlage kommt. Deshalb sollte sie ihre alten wie auch ihre künftigen Bündnispartner auf diesen Kurs einschwören.
Darüber hinaus sollte die viel beschworene besondere Partnerschaft mit Rußland endlich konkrete Formen annehmen, damit die Argumente derer, die eine Isolation Rußlands befürchten, gegenstandslos werden. Dabei bedeutet es keine Billigung des Tschetschenienkrieges, wenn die NATO Rußland an operativen Gremien wie der Nuklearen Planungsgruppe durch regelmäßige 16+1-Tagungen und an den beiden hochrangigen Gruppen beteiligen würde, die über Nichtverbreitung arbeiten.
Eine funktionale Aufwertung der OSZE durch die NATO-Staaten wäre ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung, der auch der deutschen außenpolitischen Tradition entspräche, wie sie zuletzt 1994 in der Kinkel-Kooijmans-Initiative unter dem Motto »KSZE zuerst!« ihren Ausdruck fand. Dies wäre auch eine Chance, den Sicherheitsbedürfnissen der Staaten stärker Rechnung zu tragen, die auf absehbare Zeit nicht oder nie in die NATO aufgenommen werden.
Da die Gruppe der Beitrittswilligen ausnahmslos auch aus Kandidaten für die Europäische Union besteht, sollte sich die Bundesregierung dafür einsetzen, daß es mit diesen Staaten über den im Dezember 1994 vom Europäischen Rat in Essen beschlossenen Strukturierten Dialog hinaus schon bald zu einer Einbindung in die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU kommt. Diese könnte ein Schritt auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft sein, der gegangen werden kann, bevor diese Länder wirtschaftspolitisch integriert werden können. Entschlösse sich die EU dazu, wäre sie in der Lage, auf Europa bezogene Frustrationen derer aufzufangen, die bei der NATO (vorläufig?) vergeblich angeklopft haben.
Anmerkungen
1) Vgl. zur Entwicklung bis zum Frühjahr 1995 Berthold Meyer, Die Ost-Erweiterung der NATO – Weg zur Einheit oder zur neuen Spaltung Europas? HSFK-Report 5/1995, Frankfurt/M. 1995. Zurück
2) Gestaltung euro-atlantischer Politik – eine „Grand Strategy“ für eine neue Zeit. Rede des Bundesverteidigungsministers in London, in: Bulletin Nr. 27/1993 vom 1.4.1993. Zurück
3) So zitiert in „Rühe: Amerika ist Teil der Sicherheitskultur in Europa“, FAZ v. 2.5.1996, S. 2. Zurück
4) Die transatlantische Partnerschaft als Fundament der Außenpolitik. Rede des Bundesaußenministers bei der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche in Stuttgart am 2. Mai 1993, in: Bulletin Nr. 36/1993 v. 8.5.1993. Zurück
5) Rede Bundeskanzler Kohls anläßlich der 33. Konferenz für Sicherheitspolitik am 3. Februar 1996 in München (Bulletin vom 14.2.1996). Zurück
6) Vgl. „Kohl in Moskau – Wutausbruch Jelzins gegen die Ost-Erweiterung der Nato“ in FAZ v. 20.2.1996, S. 1. Zurück
7) Eine ausführliche Analyse enthält Berthold Meyer / Harald Mül#ler / Hans-Joachim Schmidt, NATO 96: Bündnis im Widerspruch, HSFK-Report 3/1996, Frankfurt/M. 1996, S. 4-19. Zurück
8) Studie über die Erweiterung der NATO (in der Übersetzung des Bundessprachenamtes), Ziffer 26. Zurück
Dr. Berthold Meyer ist Projektleiter bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.