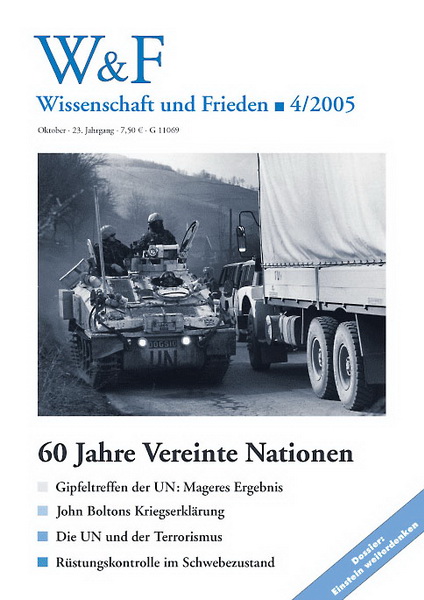Die herbeigeredeten Studiengebühren
von Franz Fujara
Am 26. Januar 2005 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass der Bund in der Frage der Gebührenfreiheit von Hochschulen nicht gesetzgeberisch tätig sein dürfe, da hier „gleichwertige Lebensverhältnisse in den Ländern oder die Rechts- und Wirtschaftseinheit“ nicht tangiert werden. Die Kompetenz liege in dieser Sache folglich auf Länderebene. Das Urteil regelt also die Zuständigkeit. Über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Studiengebühren wird keine Aussage getroffen.
Gleichwohl ergießt sich prompt ein Schwall von Aussagen von Universitätsrektoren und Bildungspolitikern (oder besser solchen, die sich dafür halten), damit seien Studiengebühren im Grunde beschlossene Sache – in einem Ländle vielleicht etwas früher, bei manchen Nordlichtern vielleicht ein wenig später. Das Bertelsmann-gestiftete Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) glaubt einen weiteren Etappensieg errungen zu haben, und auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) schwenkt ein und formuliert ein Bündel von Argumenten für die Einführung von Studiengebühren. Das Herbeireden hat Methode.
Es geht dabei nicht allein um Studiengebühren, sondern um einen neoliberalen Angriff auf unser Bildungswesen »auf breiter Front«. Es soll einer um 1968 begonnenen Entwicklung vollends der Garaus gemacht werden. Wie konnte es dazu kommen?
Das kulturelle »Roll Back« im Bildungsbereich
Im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts – mit einem Höhepunkt in den 1970ern und später schon eher rückläufig – gab es einen von einem Demokratisierungsschub begleiteten Ausbau von Sozialeinrichtungen, von öffentlicher Infrastruktur und nicht zuletzt auch des Bildungsbereichs. Regionale, soziale und geschlechtsspezifische Zugangsbarrieren zu höheren Bildungseinrichtungen wurden (leider nur teilweise) abgebaut. Innerhalb der Universitäten ermutigte die Losung »Mehr Demokratie wagen!« zu einem gewissen Ausbau partizipativer Strukturen.
Diese Konjunktur hielt nicht an. Eine immer bedrohlichere Krise der öffentlichen Finanzen stellt heute vieles Erreichte in Frage. Und nur ein Rezept zur Krisentherapie scheint sich in den Köpfen der Regierenden und der Regierten festzusetzen, nämlich die Ökonomisierung möglichst vieler Bereiche des öffentlichen Lebens. Die Anwendung dieses Allheilmittels wird fast schon zu einem Dogma, der Markt zum Götzen. Die neue Losung »Holt euch, was ihr kriegen könnt!« kennt das Wort Demokratie nicht mehr, kennt nur noch den Wettbewerb. Dieser Neoliberalismus pur macht auch vor Wissenschaft und Bildung nicht halt. In den Forschungslaboren wird aus der kooperativen Suche nach »Wahrheit« der kompetitive Wettlauf um Patentrechte. In den Bildungseinrichtungen regiert der Wettbewerb um die immer höher gehängte Wurst auf allen Ebenen: unter den Standorten, unter den Fachbereichen, unter den Lehrenden und (schlussendlich) unter den Studierenden und sogar Schülern.1 Der Bildungsbegriff wankt spätestens dann, wenn aus kritischem Wissen »Humankapital« wird.
Das CHE-Menü
Die Diskussion um Studiengebühren ist also in einem größeren Zusammenhang zu sehen und eng mit anderen »Reformen« verbunden. Um einige zu nennen, allesamt übrigens Bestandteile des Argumentationsmenüs des CHE in Gütersloh, der bedeutendsten neoliberalen Meinungsschmiede im Hochschulbereich:
- das verordnete Bachelor-/Master-System und Abnicken der neuen Studiengänge durch demokratisch nicht legitimierte Akkreditierungsinstanzen;
- die indikatorengestützte Mittelverteilung;
- das geänderte Dienstrecht;
- die immer stärker werdende Verunglimpfung der Gruppenuniversität;
- die Autonomiebestrebungen der Universitäten;
- die angekündigte Benennung von Eliteuniversitäten;
- und – last but not least – die Studiengebühren.
Nur in diesem Kontext sind die herbeigeredeten Studiengebühren zu verstehen. Ein Blick auf die Homepage etwa der HRK liefert vielsagende Klartextargumente pro Studiengebühren: (i) Studiengebühren spielen die Rolle von Preisen in einem zunehmend marktorientierten System; (ii) Studiengebühren führen zu einem neuen Verhältnis zwischen Studierenden als zahlenden Nachfragern und Hochschule; (iii) in Zeiten knapper Kassen ist ein Ausbau der Hochschulen ohne private Einnahmen kaum möglich.
All diese Argumente benutzen Begriffe aus der BWL-Welt: »privat«, »Markt« oder »Nachfrage«. Unbestreitbar gerät damit die Bildung, bisher ein öffentliches Gut, unter einen starken Privatisierungsdruck. Und somit geht es letztlich um die Frage, ob das Bildungswesen ein öffentlich finanziertes, durch demokratisch legitimierte Instanzen kontrolliertes, gemeinnütziges Gegenmodell zum Markt bleiben oder den Gesetzen des Marktes und des krisenkapitalistischen Wettbewerbs gehorchen soll.2 Ein viertes, häufig genanntes und auch auf der HRK-Homepage benutztes Dictum behauptet, dass Studiengebühren eine existierende Verteilungsungerechtigkeit – Motto: Die Krankenschwester finanziert das Studium des Arztsohnes mit – beseitige. Die notwendige Antwort auf dieses zynische Argument wäre durch eine Gegenfrage zu leisten: Warum erhöhen wir dann nicht den Spitzensteuersatz? Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir einen entsolidarisierten Gebührenstaat oder einen Verfassungs- und Steuerstaat bevorzugen, in dem eine gesellschaftlich konsensuale Mittelzuweisung dann auch keines privaten Bildungssponsorings à la USA mehr bedarf.
Das Recht auf offene Bildung
Den Tendenzen, Bildung zu privatisieren, muss Einhalt geboten werden. Das Recht auf offene Bildung ist eine Errungenschaft, die nicht aufgegeben werden darf. Eine Kommerzialisierung von Bildung würde diese demokratische Teilhabe in Frage stellen.
Der Markt- und Wettbewerbsgedanke stößt an Grenzen, wenn es um öffentliche Güter geht. Die Qualität von Kulturgütern lässt sich auf diese Weise nicht immer optimieren. Wie Beispiele aus der Medienwelt zeigen, ist eher das Gegenteil der Fall. Ein Wettbewerb, bei dem es Sieger und Verlierer gibt, ist auch mit Wissenschaft, die nach Wahrheit sucht, nicht vereinbar. Ein Wettbewerb ist überdies sozial entgrenzend: Die Sieger sind auf neudeutsch die Winner, die Verlierer die Looser. Und solange die Verteilung des Sozialproduktes sich in der Verteilung der Bildungschancen spiegelt, hat Hochschulpolitik eine hochrangige gesellschaftliche Aufgabe und muss in diesem Sinne auch Sozialpolitik sein.
Die Studierenden sollten sich davor hüten, an einer der derzeit in einem absurden und alle demokratisch eingeübten Findungsdiskurse vergessenden Hurratempo ausgeguckten Eliteuniversitäten zu studieren. Es bedarf wohl keiner kühnen Prophetie vorher zu sagen, dass eine Universität, sobald sie sich auf der elitären Sonnenseite wähnt, es nicht bei dem Einstiegsdrogenquantum von 500 Euro pro Semester belassen wird. Denn es war ja schließlich schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Und man möchte doch so sein wie Harvard oder Yale. Nein, wir brauchen keine Elite! Leuchttürme haben auch an der Küste eher ausgedient.
Und schließlich: Der Ruf nach Studiengebühren lebt auch vom Mythos, es sein kein Geld da. Aber fragen wir uns doch bitte, ob wir lieber eine kriegführende oder eine Bildungsnation sein wollen.
Anmerkungen
1) Hans-Olaf Henkel (1998, damals Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Industrie E.V.): „Wettbewerb zwischen Studenten muss schon am Beginn des Studiums über Eingangsprüfungen möglich sein. Wettbewerb zwischen Professoren muss durch leistungsbezogene Bezahlung erfolgen. Wettbewerb zwischen Hochschulen muss auch über die Möglichkeit gefördert werden, Studiengebühren zu erheben.“
2) Lothar Späth (1999, Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG): „Selbst einzelne Institute können als Profit-Center geführt werden, die über ein eigenes Betriebsvermögen verfügen.“„Nur durch Wettbewerb in der Bildung kann eine wettbewerbsfähige Bildung auf Dauer gewährleistet werden.“ Johannes Rau (2003): „Nein sagen müssen wir zu allen Bemühungen, Forschung und Lehre vornehmlich an den Bedürfnissen der Wirtschaft auszurichten und die Universität wie einen Wirtschaftsbetrieb mit einem allmächtigen Manager an der Spitze zu organisieren.“
Franz Fujara ist Hochschullehrer für Physik an der TU Darmstadt und Mitglied der dort angesiedelten Interdisziplinären Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS).