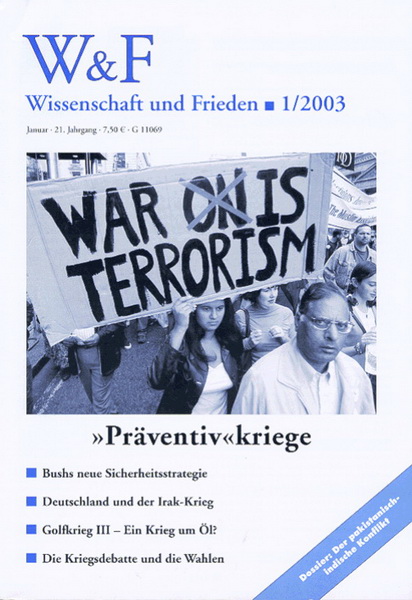Die Paradoxie des Friedens und die Lehre vom gerechten Krieg
von Gertrud Brücher
Nachdem es offensichtlich in Mode gekommen ist, Kriege mit »humanitären Gründen« zu rechtfertigen, nimmt auch die Debatte über die Lehre vom gerechten Krieg wieder einen breiteren Raum ein. Davon zeugen neue Buchveröffentlichungen; selbst große deutsche Tageszeitungen wie die Frankfurter Rundschau befasen sich mit diesemThema. In drei Ausgaben von Wissenschaft und Frieden haben bisher Albert Fuchs und Heinz-Günther Stobbe ihre unterschiedlichen Auffassungen dargelegt. Mit ihnen setzt sich die Marburger Philosophin und Soziologin Gertrud Brücher kritisch auseinander.
Die Kontroverse über Entbehrlichkeit oder Unentbehrlichkeit der Lehre vom gerechten Krieg, die zwischen Albert Fuchs und Heinz-Günther Stobbe in dieser Zeitschrift geführt wurde, kreist um ein Dilemma, das wohl niemals endgültig aus der Welt zu schaffen sein dürfte, dessen Reformulierung jedoch immer wieder auf die Höhe der Zeit gebracht werden muss. Dieses Dilemma lautet: Das säkularisierte Rechtsbewusstsein ist an rechtsetzende und -garantierende gewaltgestützte Instanzen gebunden und kennt deshalb – solange es kein internationales Gewaltmonopol gibt – nur positivistisch verfasste souveräne Rechtsgemeinschaften. Wenn es für diese Gemeinschaften eine reale oder fiktive Gefahr für ihr Bestehen gibt, dann können sie in ihrer Eigenschaft als reale Bedingungen geltenden Rechts, zu an sich rechtswidrigen Mitteln greifen, ohne ihren Status als rechtssetzende Gemeinschaft zu verlieren.
Dieses Dilemma fasst Immanuel Kant in den Satz: „Das Problem der Errichtung einer vollkommenen bürgerlichen Verfassung ist von dem Problem eines gesetzmäßigen äußeren Staatsverhältnisses abhängig und kann ohne das letztere nicht aufgelöst werden“1. Anders gesagt. Demokratien können ihrer eigenen Maxime, Konflikte unter Rückgriff auf das Mittel des Diskurses, also nichtgewaltsam auszutragen, nur unter der Voraussetzung treu bleiben, dass alle Staaten der Erde demokratisch verfasst sind. Die Überführung der zwischenstaatlichen Verhältnisse von einem vorrechtlichen in ein rechtsförmliches Verhältnis setzt jedoch voraus, dass alle Staaten bereits Rechtsstaaten sind. Die Bedingung der Möglichkeit des Friedens – die weltweite Akzeptanz eines verbindlichen Regelwerkes, das gewaltsame Konfliktlösung ausschließt – ist die Bedingung der Unmöglichkeit des Friedens – ein Handeln mächtiger Akteure, die eine weltweite Akzeptanz im Falle einer Verweigerung erzwingt.
In diesem genuin rechtsfreien Zwischenraum, der das positive Recht von den vorpositiven Grundlagen positiven Rechts trennt, ist die Legitimation militärischer Aktionen angesiedelt. Jeder kriegerische Akt ist in sich gerechtfertigt, der sich als Verteidigung der Rechtsgemeinschaft ausgibt. Dieses formidable Legitimitätskonstrukt für Kriege jeder Art wird nicht bereits dadurch deplausibilisiert, dass ein ideologiekritisches Argument auf die Instrumentalisierbarkeit hinweist. Denn dieser Hinweis legt nur eine Selbstverständlichkeit offen, die das Grundproblem, die paradoxe Konstitution des Friedens, nicht tangiert.
Dieser bereits in den Grundentwurf moderner friedensfähiger Republiken eingebaute Widerspruch von Müssen und Nichtkönnen war zu Zeiten des Kalten Krieges in den Hintergrund getreten, um einem Allen oder zumindest dem größten Teil der Menschheit einleuchtenden Diktum der »pax atomica« zu weichen. Es verwundert nicht, dass mit dem Ende der allem Anschein nach friedenstiftenden »mutual destruction« das alte Paradoxon wieder die Konturen des politischen Weltgeschehens zu erobern beginnt.
Was in dieser Lage allein möglich scheint, ist die Diskussion jener Kasuistiken, die den Verteidigungsfall ausrufen lassen. Verteidigung ist notwendig, wenn angegriffen wird – und hier gehen die Meinungen über das Einheitskonstrukt auseinander, das in seiner Verfasstheit vor der Überwältigung geschützt werden muss. Provoziert nur die verletzte territoriale Integrität den Verteidigungfall oder werden bereits Wertegemeinschaften durch eine für sich werbende alternative Wertegemeinschaft gefährdet, »angegriffen«? Da Bedeutung und Reichweite dessen, was Verteidigung meint, von der Bestimmung der Einheit abhängt, deren Bestand zur Disposition gestellt sein kann, ist Verteidigung kein transdiskursives Thema; sie muss immer wieder – und gegenwärtig mit verstärkter Vehemenz – im diskurstheoretische Sinne auf ihre Geltungsgründe hin überprüft werden.
Ein durch Diskurs nicht mehr zu bewältigendes Problem ist und bleibt aber die paradoxe Konstitution des Friedens, die Kant gegenüber der alten aristotelisch-thomistischen Fassung lediglich den modernen säkularisierten Bedingungen angepasst hat. Da Kant nicht das Dilemma an sich schon aufzulösen vermag, ersetzen die in den Präliminar- und den Definitivartikeln genannten Bedingungen, die Staaten erfüllen sollen, um der Gefahr eines Krieges entgegenzuwirken2, nicht die Lehre vom gerechten Krieg, die Schadensbegrenzung angesichts einer in das Friedensproblem eingebauten Paradoxie ermöglichen sollte.An dieser Stelle greift die Kontroverse, die zu Unrecht als eine solche zwischen Bellizismus und Pazifismus wahrgenommen wird. Die Realität kriegerischer Auseinandersetzungen scheint ein Regelwerk zu erzwingen, wenn als Alternative nur der regel- und kriterienlose Einsatz für den guten Zweck bleibt. Wenn dies aber so ist, dann gewinnen die Hinweise von Albert Fuchs3 auf doktrinäre Schwachstellen der bellum-iustum-Lehre ein besonderes Gewicht, die in Frage stellen lassen, ob die selbstgesteckten Ziele eines Regelwerkes, nämlich regelnd in Erscheinung zu treten, überhaupt erfüllt werden können.
A. Fuchs formuliert diesen Zweifels als historisches Argument, das der bellum-iustum-Lehre bescheinigt, gemessen an dem „vorgeblichen Ziel der Kriegsverhinderung, -begrenzung oder -beendigung“ gescheitert zu sein.4 Die ganz offensichtliche Diskrepanz zwischen moralischem Anspruch und fatalen unmoralischen Konsequenzen wird gewissermaßen als Verstoß gegen das eigene Prinzip der Proportionalität betrachtet. Die Lehre hat über sich selbst das historische Urteil der Unverhältnismäßigkeit gefällt.
Dieser Einwand provoziert die grundsätzliche Frage, ob der Vergleich zwischen einer ethischen Konzeption, wie der »Lehre vom gerechten Krieg« , die Sollensprinzipien aufstellt, auf der einen Seite, und Wirkungen eines Handelns, das sich durch Berufung auf diese Lehre legitimiert, auf der anderen Seite, überhaupt möglich ist. Die Feststellung einer Inkompatibilität ist entweder logischer (wahr/unwahr, konsistent oder inkonsistent in Bezug auf Wahrheitskriterien) oder empirischer Art (Ursache/Wirkung, Intention und Resultat stimmen nicht überein). Als empirisch relevante Wirkursache tritt die Lehre nur als faktisches Legitimitätskonstrukt in Funktion. Empirisch ist die Intention, mit der ein Beobachter sich auf die Lehre beruft. Eine vom Beobachter abstrahierte Intentionalität der Lehre ist hingegen konzeptioneller Art und lässt sich nur im Kontext mit historisch-gesellschaftlichen Auslegungsvarianten ermitteln. Die bellum-iustum-Lehre muss als eine normative Theorie das Verhältnis von Absicht und Resultat konzeptionalisieren. Das tut sie, indem sie einen Akteur in seinen Konturen, d.h. in seinem Handlungsspielraum, beschreibt.
Wenn man nicht die konkrete Absicht eines konkreten Akteurs (bspw.: Nato, George W. Bush, Schröder), sondern die Intentionalität »der Lehre« herausarbeiten will, dann stößt man auf die unterschiedlichen semantisch-gesellschaftsstrukturellen Kontexte, einmal des aristotelisch-thomistischen, des kosmologischen Weltbildes, in dem die Lehre formuliert worden ist (Augustinus), und des subjektphilosophisch-aufklärerischen, innerhalb dessen eine Legitimierung des Menschenrechtsinterventionismus von Seiten der Humanisten in Angriff genommen wird.
Das Scheitern als unüberbrückbare Diskrepanz zwischen moralischem Anspruch und Resultat gilt Fuchs als empirisch erwiesen, weil es im historischen Geltungsbereich der bellum-iustum-Lehre weiterhin Kriege gegeben habe. Analog zu diesem Widerlegungstypus könnte man jedoch in gleicher Weise die Habermassche Diskursethik mit dem Argument widerlegen, dass es weiterhin Interaktionszusammenhänge gibt, in denen ethische Kriterien nicht auf ihren Geltungsgrund intersubjektiv überprüft werden. Im Falle eines Theorietypus, der Maximen für rechtmäßiges Handeln aufstellt oder – systemtheoretisch ausgedrückt – der ein Programm für den moralischen Code aufstellt, kann das Überprüfungskriterium nicht das der Falsifikation sein, mit dem empirisch-analytische Theorien auf ihre Validität getestet werden.
Wenn man die historische Wirkung als Maßstab der Bewertung ins Feld führt, dann muss man am Ereignischarakter der Lehre ansetzen; und das bedeutet, man muss die Lehre im Lichte der Intention analysieren, mit der ein bestimmter Akteur sich der Lehre bedient. Man muss sie aber auch im Lichte der intentionalen Struktur einer bestimmten historischen Ausprägung der Semantik der bellum-iustum-Lehre begutachten, die den Interpretationsradius der Akteure beeinflusst. Die konkrete Absicht, mit der sich ein Akteur auf die Lehre bezieht, ist nicht unabhängig von der historisch-semantischen Intentionalität des Textes, die unabhängig von den Instrumentalisierungsabsichten des Akteurs mit transportiert wird.
Das von H.-G. Stobbe konstatierte historische Scheitern der bellum-iustum-Lehre bezieht sich auf diesen zweiten Zusammenhang. Moralische Absicht und moralisches Resultat beginnen auf der konzeptionellen Ebene der Lehre in dem Augenblick auseinanderzutreten, in dem der politische Akteur nicht mehr als »Herrscher von Gottes Gnaden« gedacht ist, sondern als nur sich selbst unterworfener »Souverän«. Mit der Emanzipation des Politischen von religiösen und moralischen Bindungen, mit der Ausdifferenzierung des politischen Systems mithin (Westfälischer Frieden 1648, Herausbildung souveräner Nationalstaaten), entfällt der Hintergrund, vor dem die bellum-iustum-Lehre ihre Bindewirkung – Proportionalität, intentio recta, Immunität, causa iusta – entfalten konnte.
Diese Figur des »Herrschers von Gottes Gnaden« ist entgegen der Suggestion von A. Fuchs kein Symbol für Omnipotenz, sondern im Gegenteil eine Institution, die Machtbegrenzung durch die Differenz von irdischer und spiritueller Macht (Kaiser und Papst) zu garantieren suchte. Der »Herrscher von Gottes Gnaden« erreicht das moderne Souveränitätsprofil gerade nicht,5 weil er dem göttlichen Gesetz unterworfen ist. Erst Hugo Grotios hat mit der Völkerrechtsidee ein säkulares Äquivalent für die Dialektik von Macht und Gegenmacht entworfen, die ein autonom gesetztes politisches System ersatzlos gestrichen und durch eine Souveränitätstheorie ersetzt hatte, die nur die Vernunft der Staaten, die Staatsraison anerkennt.
Die im Hirtenbrief der Deutschen Bischofskonferenz von 1983 (»Gerechtigkeit schafft Frieden«) bestätigte Verabschiedung der Lehre vom gerechten Krieg, auf die H.-G. Stobbe Bezug nimmt, verweist auf eine Inkompatibilität zwischen historisch-semantischer Intentionalität und Resultat. Unter den Bedingungen eines autonom gesetzten politischen Akteurs ist die Berufung auf gerechte Gründe und auf eine Verhältnismäßigkeit der Mittel – die ein im Gewissen gegründetes Gerechtigkeitsempfinden voraussetzt – eine Persuasivtechnik, ein Rechtfertigungskonstrukt, das ausschließlich die Funktion hat, die Akzeptanz durch die Bevölkerung zu sichern und damit einen Anschein demokratischer Legitimität zu erwecken. Diese Funktion strukturiert die politische Handlungswirklichkeit aufgrund der intentionalen Struktur einer säkularisierten bellum-iustum Lehre unabhängig von den konkreten Absichten der politischen Akteure.
Vor dem Hintergrund der notwendigen Differenzierung von Ereignis (Intention des Akteurs) und Struktur (Intentionalität der BJL) können einige der strittigen Punkte der Kontroverse als Missverständnisse aufgezeigt werden.
- Es wird deutlich, dass Fuchs (W&F 2/2002, S. 62) die Stobbessche Einordnung des Scheiterns als eine Folge der „’Ablösung (…) von ihrem traditionellen religiösen oder theologischen Fundament’ im Zusammenhang des geistesgeschichtlichen Umbruchs von Mittelalter zur Neuzeit“ kaum als „falsche Fährte“ bezeichnen kann, mit der das Versagen der BJL „rein external attribuiert“, also lediglich Umständen, Prozessen und Akteuren zuschrieben wird. H.-G. Stobbe attribuiert im Gegenteil gerade internal, indem er die Inkompatibilität als interne Unvereinbarkeit der semantisch festgelegten Intentionalität (Kriterium: Gewissensbindung) und gesellschaftsstrukturell ermöglichte Intentionalität (Kriterium: moralfreie Staatsraison) als Grund für das Scheitern angibt.
- Die Thematisierung des Akteurs bei A. Fuchs mit der „Frage, wer letztverbindlich entscheiden soll, ob in einem konkreten Fall alle Voraussetzungen der ethischen Vertretbarkeit von militärischer Gewalt vorliegen“ (Fuchs 2001, S. 14, Sp. 2), reflektiert genau den Kontext eines Auseinanderdriftens von Semantik und Gesellschaftsstruktur, das die Intentionalität der BJL grundlegend verändert. Im Rahmen eines ausdifferenzierten, moralisch entlasteten politischen Systems ist die Entscheidungsinstanz, die die Bedingungen prüft, nicht mehr das Gewissen, sondern nur der sich selbst verantwortliche und damit in seiner Willkür bestätigte Souverän.
- Der Definitionsnotstand, den A. Fuchs beschreibt, indem er die Kontingenz der Kriterien für den „gerechten Grund“, für eine kollektive „rechte Absicht“, für die Diagnose der „ultima-ratio“-Situation, der „legitimen Autorität“ hervorhebt, ist eine Folge des in der Neuzeit weggebrochenen religiösen Fundaments, von dem H.-G. Stobbe seine Überlegungen ausgehen lässt.
- Wenn die »legitime Autorität« von der christlichen und katholischen Soziallehre lange Zeit in der „rechtmäßigen Regierung eines Staates“6ausgemacht wurde, so entsprang dies dem Wunsch, die BJL auf eine säkularisierte Legitimitätsgrundlage zu stellen, um auch weiterhin über einen Kriterienkatalog verfügen zu können, der innerhalb des Tötens im Krieg moralische Subdifferenzierungen vornehmen lässt. Damit hoffte man der in der Souveränitätstheorie liegenden Tendenz zum totalen Krieg – in Ermangelung eines alternativen Regelwerkes – etwas entgegensetzen zu können. Das ius ad bellum war durch die Verwandlung zum Recht auf legitime Verteidigung bereits durch die schwindenden Chancen der Verteidigung in einer Staatenwelt ausgehöhlt, die über ABC-Waffen verfügt. A. Fuchs moniert an diesem Konstrukt, dass mit dem Festhalten an einer »legitimen Autorität« Befreiungs- oder Sezessionskriege niemals »gerecht« sein könnten und stellt sich damit implizit auf den Boden der BJL, die in Bezug auf die Legitimität dieser Kriege keine Vorentscheidung trifft. Da in letzterem Fall beide Seiten – die Verteidiger der nationalen Einheit und die Verteidiger einer ethnisch oder religiös definierten Wertegemeinschaft – gute Gründe geltend machen können, bezeichnen sie geradezu den klassischen Konfliktfall, für dessen Lösung die BJL konzipiert ist.
In dem Augenblick jedoch, in dem die Verteidiger des Status quo mit den Verteidigern einer Wertegemeinschaft identisch werden, stehen nicht mehr zwei Konfliktparteien einander gegenüber, von denen jede für sich gerechte Gründe geltend machen kann. Wenn nun gefährliche und potenziell gefährliche Akteure als Exponenten des Bösen ausgeschaltet werden sollen, sind die Bedingungen, auf die das Regelwerk der BJL zugeschnitten ist, durch eine Wirklichkeitsdefinition eliminiert, die ausschließlich die Voraussetzungen für den – nicht mehr regulierbaren – »heiligen« oder »totalen« Krieg schafft. Das Strategiekonzept der »präventiven Verteidigung«, das der Potenzialität potenzieller Attacken noch vorzugreifen gebietet, um nicht den frühstmöglichen Zeitpunkt zu verpassen, an dem mit einem relativ geringen Mittelaufwand höchste Erfolge für die eigene Sicherheit erzielt werden können, etabliert nicht den »gerechten«, sondern den »permanenten« Krieg mit unabsehbaren Konsequenzen, die nicht weniger als das Ende der sogenannten zivilisierten Welt erahnen lassen.
Anmerkungen
1) Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Kant: Kleinere Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, hrsg. v. K. Vorländer, Hamburg 1959, S. 3-20, hier S. 12.
2) 1. „Es soll kein Friedensschluß für einen solchen geben, der mit dem geheimen Vorbehalte des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden.“ 2. „Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines anderen Staats gewalttätig einmischen.“ 3. „Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen“. Die Definitivartikel lauten: 1. „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein.“ 2. „Das Völkerrecht soll auf einem Föderalism freier Staaten gegründet sein.“ 3. „Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.“ (Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (1795).
3) Gerechter Krieg? Anmerkungen zur bellum-iustum-Lehre, in: W&F 2/2001, S. 12-15.
4) W&F 2/2002, S.62.
5) Der Obrichkeitsgehorsam als Kennzeichen einer hierarchischen Gesellschaftsstruktur, tangiert die BJL nur rudimentär, weil der geistigen und weltlichen Autorität die Autorität des individuellen Gewissens als höherstufige Instanz gegenüber steht. In das kirchliche Gesetzbuch wurde die Entscheidung des Papstes Innozenz III aufgenommen, im Falle inneren Konflikts zwischen dem Gewissen und Anordnungen einer Obrigkeit auf das Gewissen zu hören. „Alles, was nicht aus Überzeugung geschieht, ist Sünde (Röm. 14.23); und was gegen das Gewissen geschieht, erbaut zur Hölle. Gegen Gott darf man nicht dem Richter gehorchen, sondern muß lieber die Exkommunikation über sich ergehen lassen.“ (Corp.iur.can.II 286 s. Richer-Friedberg, nach Hirschberger 1965:319).
6) Stobbe W&F 4/2001, S. 53, Sp. 3.
Dr. Gertrud Brücher ist Privatdozentin an der FernUni Hagen