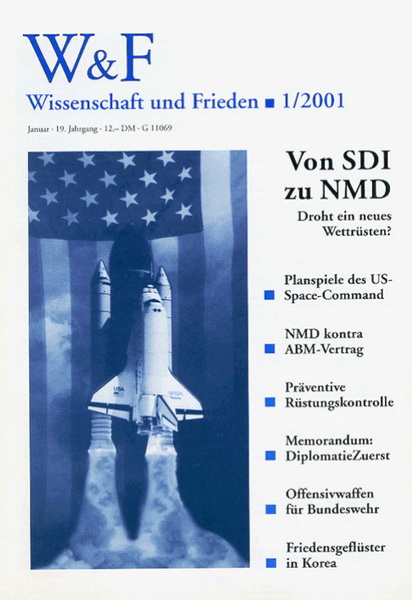Die US-Wahlen: Herausforderungen für Demokratie und Politik
von Paul Walker
Der Wahlkampf um das Weiße Haus war in diesem Jahr alles andere als langweilig: Ein bemerkenswert deutlicher Wettbewerb zwischen Demokraten und Republikanern, das Aufkommen einer neuen Grünen Partei, die vom Verbraucheranwalt Ralph Nader geführt wird, eine bescheidene, da zersplitterte Herausforderung durch die Rechten der Reform-Partei und ihren Kandidaten Pat Buchanan, viele landesweite Aufrufe und eine Liste politischer Themen, die von Steuersenkungen bis zu Immigration, Wahl- und Abtreibungsrechten reichte, die Wahlkampagne der First Lady, Hillary Clinton, in New York und sehr knappe Wahlkampfausgänge über das ganze Land hinweg.
Die 2000er-Schlacht um die US-amerikanische Präsidentschaft wird mit Sicherheit als kontroverseste und strittigste in über zwei Jahrhunderten Präsidentschaftswahlen in die Geschichte eingehen. Bislang ist kaum etwas klar – außer der Tatsache, dass der Kampf bis Mitte Dezember, vielleicht sogar länger und möglicherweise ins Neue Jahr hinein, weitergeführt werden wird.
Die landesweiten Wahlergebnisse fielen sehr knapp aus: 50.133.912 Stimmen für Gore und 49.805.216 für Bush (so die inoffizielle Auszählung unter Ausschluss der manuellen Neuzählung und der Zählungswiederholung in Florida vom 26. November). Bei fast 100 Millionen abgegebenen WählerInnenstimmen führt Gore mit 328.696 Stimmen, weniger als einem Drittel eines Prozents. Allerdings ist die landesweite Stimmabgabe durch die Bevölkerung nicht der entscheidende Faktor. Entscheidend sind die gewählten »Wahlmänner«. Jeder Bundesstaat entsendet unterschiedlich viele »Wahlmänner« auf der Grundlage der Bevölkerungsgröße des jeweiligen Staates in das »Electoral College«, damit sie die einzig entscheidende Wahl im Januar tätigen.
Im US-amerikanischen Wahlmänner/-frauen-System sind 270 solcher Stimmen erforderlich für die Wahl des Präsidenten. Vor der endgültigen Stimmenauszählung in Florida hatte Gore genügend Bundesstaaten zur Erringung von 267 dieser Wahlmänner/-frauen-Stimmen gewonnen, nur drei weniger als die 270 erforderlichen; Bush hatte 246 Stimmen bekommen, 24 weniger. Floridas 25 Wahlmänner/-frauen sind daher die schlussendlich entscheidende Menge für jeden der beiden Kandidaten, um im 2000er Rennen um das Weiße Haus zu siegen.
Die Wahl in Florida wurde jedoch sowohl seitens der Demokratischen wie der Republikanischen Partei in Frage gestellt wegen einer Reihe von Unstimmigkeiten, einschließlich technischer Probleme mit dem Kartenlochungs-System beim Wählen, dem behaupteten Ausschluss einer großen Zahl afroamerikanischer Wähler in bestimmten Bezirken, Fragen zur Gültigkeit zahlreicher Briefwahlstimmen und weit verbreiteter Konfusion mit den neuen »Schmetterlings«-Stimmen, die – wie berichtet wird – dazu führten, dass WählerInnen ihre Stimme irrtümlich Pat Buchanan gaben anstatt Al Gore. Diese Probleme führten in den meisten Bezirken Floridas dazu, unterschiedlich intensive Nachzählungen durchzuführen. Doch auch nach zwanzig Tagen der Nachzählung ist immer noch unklar, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird.
Während wir alle darauf warten, wie die endgültige Entscheidung der Bezirksgerichte und letztlich des höchsten Gerichts, des United States Supreme Court, ausfallen wird, lassen sich einige Beobachtungen schon jetzt aus dem diesjährigen Wahlkampf um das Weiße Haus ableiten.
- Erstens: Das Land ist tief gespalten hinsichtlich seiner Zukunft. Das engste Kopf-an-Kopf-Rennen um die Präsidentschaft in der US-amerikanischen Geschichte illustriert deutlich, dass die US-AmerikanerInnen – jedenfalls die 100 Millionen von ihnen, die zur Wahl gehen – sich im Moment des Eintritts ins neue Jahrtausend sehr unschlüssig sind über die Richtung, die das Land künftig einschlagen sollte. Die eine Theorie dazu ist, dass das Land angesichts einer extrem geringen Arbeitslosigkeit, einem auf den Auslandsmärkten starken Dollar, anhaltend florierender Wirtschaft und relativ starker Börse demokratisch gewählt hat, d. h. keinen Wechsel der Pferde im Lauf wolle. Die zweite Theorie ist: Mit Präsident Clinton, der immer noch im Weißen Haus sitzt, nach Jahren persönlicher Skandale, republikanischen Impeachment-Versuchen und einer stark polarisierenden Washingtoner Politik seien die US-AmerikanerInnen bereit zum Wechsel und hätten die Republikaner gewählt. Diese Art nationaler Schizophrenie scheint die diesjährigen Wahlen beherrscht zu haben. Und die US-AmerikanerInnen nehmen dies auch sehr deutlich wahr. Man muss nur einmal Zeuge der öffentlichen Demonstrationen im November für oder gegen den einen oder anderen Kandidaten in Florida geworden sein um festzustellen, wie tief die miteinander konkurrierenden Ideologien in die Gefühle der Leuten hinein reichen.
- Zweitens: Die US-amerikanische Demokratie ist nicht bedroht. Ein paar Wahlbeobachter kommentierten kürzlich, der demokratische Prozess werde nach diesen bitteren politischen Novemberkämpfen böse beschädigt sein. Es scheint aber eher danach auszusehen, dass das derzeitige Durcheinander und die Besorgnisse letztlich die US-amerikanische Politik beleben, zu einer stärkeren Wahlbeteiligung ermutigen und verdeutlichen, dass zwischen den beiden großen Parteien tatsächlich ein Unterschied besteht (im Gegensatz zu der jeden Tag erneuerten These des Kandidaten der Grünen Partei Ralph Nader).
- Drittens: Das technische Prozedere der Wahl benötigt eine Reform. Das Lochkartensystem, das über die ganzen Vereinigten Staaten weit verbreitet ist, hat sich speziell bei den diesjährigen Wahlen in Florida als sehr anfällig erwiesen. Zehntausende Wählerstimmen sind unter das Verdikt der Ungültigkeit gefallen, weil nicht klar war, welches Loch gestanzt war. Begriffe wie »chad« – das kleine Stückchen Karton, das vom Computer beim Wählen gelocht wird, und »dimple« – ein nur teilweise ausgestanztes Stückchen Karton – sind nun dem Vokabular der meisten US-AmerikanerInnen hinzu gefügt worden. Angesichts der von Hightech durchsetzten US-Industrie erstaunt es die meisten US-AmerikanerInnen schon, dass wir unsere Wahlmaschinerie anscheinend nicht perfekt hinkriegen. Wenn unsere demokratischen Wahlen überleben sollen, müssen diese technischen – und offensichtlich einfachen – Hindernisse überwunden werden. Die US-AmerikanerInnen müssen wie in jeder funktionierenden Demokratie Vertrauen darin haben können, dass die Stimme eines/r jeden auch zählt.
- Viertens: Die US-amerikanische Politik wird während der nächsten Präsidentschaft – und möglicherweise über sie hinaus – schrill und gespalten bleiben. Unabhängig davon, ob es George Bush oder Al Gore sein wird, der im Januar ins Weiße Haus einzieht, wird sich die Bitterkeit der diesjährigen Wahl voraussichtlich in die nationale Politik und das politische Geschäft übertragen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass beide Häuser des Kongresses aus diesem Wahlzyklus gespaltener denn je hervorgegangen sind. Das Repräsentantenhaus, in dem die Republikanische Partei seit 1995 die Mehrheit hatte, ist mit einer Handvoll Sitze stärker demokratisch geworden. Der Senat ist sogar halbe-halbe zwischen den beiden Parteien gespalten (unter der Voraussetzung, dass der demokratische Vizepräsidentschafts-Kandidat und Senator Joseph Lieberman nicht ins Weiße Haus geht). Die Aufspaltung des Senats wurde erst zwei Wochen nach den Wahlen klar, als die Kandidatin der Demokraten Maria Cantwell in Oregon mit einer nachträglichen Auszählung gegen den dort amtierenden republikanischen Senator Slade Gorton gewann. Stellen wir uns dazu die First Lady und nunmehr gewählte Senatorin Hillary Clinton in den Hallen des Senats vor, dann lässt sich eine lebhafte Politik für 2001 und darüber hinaus leicht voraussagen. Und wie schon angemerkt: Die Straßendemonstrationen in Florida deuten lang anhaltenden Zorn in beiden politischen Parteien an. Angesichts der zusätzlichen Sitze im Repräsentantenhaus wie im Senat, die die Demokraten gewonnen haben, besteht nun die Möglichkeit, dass bei den Kongresswahlen 2002 wieder die Demokraten die Mehrheit bekommen, insbesondere falls George Bush Präsident wird. Typischerweise verliert die das Weiße Haus besetzende Partei Kongresssitze bei den Wahlen inmitten der Präsidentenlegislatur.
- Mit einem so gespaltenen Rennen um die Besetzung des Weißen Hauses und so schmalen Kongressmehrheiten bleibt als letzter Punkt zu betonen, dass es schwierig werden wird, in einer neuen Administration Konsense zu erreichen, sei es in der Innen-, sei es in der Außenpolitik.
In der Außen- und Militärpolitik haben beide Kandidaten umfangreiche Erhöhungen der Verteidigungsausgaben betont. Bush unterstrich auch seine klare Unterstützung der weltraumgestützten nationalen Verteidigung. Das sogar in einer Ausgabenhöhe, die zur Aussetzung des ABM-Vertrags von 1972 führen würde. Er sprach sich für den Rückzug von US-Truppen vom Balkan mit einem stärkerem »burden-sharing« mit den Europäern aus. Gore seinerseits wäre weniger isolationistisch in der Außenpolitik. Einerseits sprach er sich für eine Unterstützung der Star Wars-Technologien aus, andererseits aber auch für eine Verlängerung des ABM-Vertrags. Jede Politik, die im Kongress vorgeschlagen werden wird, wird ein Mehrheitsvotum benötigen, das im nächsten Jahr nicht gerade einfach zu bekommen sein wird. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit zur Aushebelung von Präsidenten-Vetos zusammen zu bekommen, wird jedoch dem Parlament kaum möglich sein.
Was immer bei diesem Präsidentschafts-Wahlkampf 2000 herauskommen wird: Das US-amerikanische politische System ist unwiderruflich verändert. Ich nehme an, dass dies besser ist, als wäre es nicht geschehen. Aber das wird uns erst die Zeit danach zeigen.
Anmerkungen
1) Affirmative Action: Politische und gesellschaftliche Handlungsstrategie, die vor allem gegen die Diskriminierung ethnischer Minderheiten entwickelt wurde: Handeln als Bestätigung – Affirmierung – ihrer Gleichwertigkeit.
2) Pro Choice: Wahlfreiheit der Individuen zwischen unterschiedlichen Handlungsoptionen
Paul F. Walker ist Politikwissenschaftler und Leiter des Legacy Program bei Global Green USA, der US-amerikanischen Sektion des Grünen Kreuzes International, in Washington D.C.
Übersetzung aus dem Englischen von Dr. Claudia Stellmach, Bonn