Digitaler Faschismus?
Gefährliche Ideologien der Tech-Blase und ihre Auswirkungen
von Rainer Mühlhoff
Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem faschistoiden Potential der Politik der »Neuen Rechten« und ihrer Synergie mit elitistischen Tech-Ideologien? Lässt sich begründeterweise von einem digitalisierten Faschismus im neuen Gewand sprechen? Der Beitrag erkundet die ideologischen, theoretischen und praktischen Verknüpfungen dieser Bestrebungen im Kontext des KI-Booms. Ein Schwerpunkt liegt auf den realpolitischen und sozialen Gefahren der – nicht mehr so unwahrscheinlichen – Auswirkungen der Tech-Ideologien.
Kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump zum 47. US-Präsidenten waren in den USA bemerkenswerte Vorgänge zu beobachten: Der Tech-Unternehmer Elon Musk hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mit einem Gefolge aus Ingenieuren und Führungskräften seiner zahlreichen Unternehmen durch die Bundesbehörden in Washington zu ziehen, um sich Zugang zu Gebäuden, Computersystemen und Daten zu verschaffen. Diese als digitaler Staatsstreich beschriebene Übernahme stellt eine scheinbar beispiellose Entwicklung dar, die in Tempo und Methode einen Qualitätssprung im politischen Projekt Trumps markiert. Diese Entwicklung lässt sich am besten mit dem Wort Faschismus beschreiben.
Dieser neue Faschismus sieht in vielen Hinsichten nicht exakt so aus wie seine historischen Vorbilder – doch gerade deshalb müssen die Kräfte, die ihn antreiben, frühzeitig als faschistisch erkannt werden. Dabei geht es im Folgenden darum, die in den letzten Jahrzehnten erstarkten ultrarechten und rechtsextremen politischen Kräfte zu analysieren, die nationalistische, rassistische, antifeministische und autoritäre Ideologien als tiefgreifenden zivilisatorischen Antagonismus (»Kulturkampf«) vertreten und sich damit gegenüber klassischen konservativen Strömungen abgrenzen und radikalisieren.
Es zeigt sich, dass aktuell eine politische Synergie zwischen diesen neuen rechten Bewegungen und Tech-Eliten sichtbar wird und an Bedeutung gewinnt. Diese Verbindung stellt keinen zufälligen, vorübergehenden Opportunismus dar, sondern steht auf einer soliden ideengeschichtlichen und ideologischen Grundlage. Den Dreh- und Angelpunkt bildet dabei das Thema künstliche Intelligenz (KI). KI-Technologie bildet nicht nur ein Kernsegment der aktuellen IT-Industrie, sondern ist seit Jahrzehnten mit ideologischen und pseudophilosophischen Denkfiguren verknüpft, in denen libertäre, elitistische und antiegalitäre Weltanschauungen dominieren – als Fortsetzung von Eugenik, weißer Vorherrschaft und Rassismus.
Die Ideologien hinter dem KI-Hype
Alle Tech-Ideologien, die nachfolgend vorgestellt werden, stehen zunächst im Zusammenhang mit der aggressiven Innovationskultur, die besonders im Silicon Valley vorzufinden ist (vgl. Golumbia 2024; Turner 2019). Diese Kultur basiert auf technologischer »Disruption« als Triebkraft gesellschaftlichen Fortschritts und wird von einer libertären Ideologie geprägt.
In diesem Umfeld werden technophile Gesellschaftsutopien besonders gefördert und weitergetragen, die der Auffassung folgen, dass technologische Entwicklung eine autonome Kraft darstellt, die gesellschaftliche Strukturen, Wohlstand und Fortschritt maßgeblich und zwangsläufig bestimmt. Eine notorische Leerstelle dieser Denkweisen bildet die Auseinandersetzung mit Fragen der gesellschaftlichen Verteilung von Macht und Ressourcen oder der schon jetzt sichtbaren sozialen und ökologischen Schäden, die durch KI-Technologie verursacht werden. Ein zentraler Aspekt der Ideologieförmigkeit dieses Weltbildes besteht darin, dass diese Punkte systematisch verdunkelt werden (vgl. grundlegend: Gebru und Torres 2024; Golumbia 2024).
Das ideologische Bündel technofaschistoider Tendenzen
In einem einflussreichen kritischen Artikel aus dem Jahr 2024 führen die Informatikerin, KI-Ethikerin und ehemalige Google-Mitarbeiterin Timnit Gebru sowie die US-amerikanische Philosoph*in Émile Torres das Akronym »TESCREAL« ein, um damit ein »Bündel« aus miteinander verwobenen und sich überlappenden Ideologien und Lehren zu bezeichnen, die in bestimmten technologischen und wissenschaftlichen Kreisen, insbesondere im Silicon Valley, verbreitet sind (Gebru und Torres 2024). Die Abkürzung TESCREAL steht für »Transhumanism, Extropianism, Singularitarianism, Cosmism, Rationalism, Effective Altruism, and Longtermism«.
Obwohl es sich um keine geschlossene Ideologie handelt, sondern um eine lose Verknüpfung von teils jahrzehntealten, teils sehr neuen Ideen, argumentieren Gebru und Torres, dass diese weltanschaulichen Lehren maßgeblich die Narrative großer Technologieunternehmen, einflussreicher Investor*innen und Vordenker*innen in der KI-Forschung prägen.
Der Transhumanismus bildet eine der zentralen ideologischen Wurzeln der TESCREAL-Ideologien. Er basiert auf der Überzeugung, dass der Mensch durch den gezielten Einsatz von Technologie seine physischen, psychischen und intellektuellen Grenzen überwinden, in einer hybriden biologisch-technologischen Existenzform aufgehen und dabei ein gesteigertes Dasein erreichen könne, das insbesondere Krankheiten und die Sterblichkeit überwinden wird. Ein zentraler Akteur in der zeitgenössischen transhumanistischen Bewegung ist der schwedische Philosoph Nick Bostrom. In seinem Buch »Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies« (2014) vertritt Bostrom die These, dass die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz entweder den ultimativen Fortschritt zu einer neuen Stufe der Menschheit bedeuten oder zu ihrer vollständigen Auslöschung führen würde – eine utopisch-apokalyptische Überzeichnung, die für das zeitgenössische transhumanistische Denken typisch ist und von dort in den populären KI-Diskurs übertragen wurde. Die im Transhumanismus formulierte Sicht auf die Rolle der Technologie in der menschlichen Evolution wirft allerdings grundlegende ethische Fragen im Zusammenhang mit sozialer Ungleichheit und Diskriminierung auf: Welche Menschen werden tatsächlich von der Verschmelzung mit Technologie profitieren und »unsterblich« werden? Die Antworten darauf sind notwendigerweise selektiv und setzen eugenische Denkmuster des 19. und 20. Jahrhunderts fort. Gebru und Torres warnen daher auch davor, dass viele dieser alten reaktionären Ideen heute im Gewand der Tech-Ideologien weiterhin präsent sind – allerdings mit Bezug auf Konzepte wie Sicherheit, Effizienz und globale Optimierung. In transhumanistischen Kreisen wird dieser historische Zusammenhang oft heruntergespielt oder als überholt abgetan (vgl. Gebru und Torres 2024).
Einen Popularitätsschub haben transhumanistische Überzeugungen in den letzten Jahrzehnten durch die Bewegung der sogenannten »Rationalisten« in den USA erhalten (der zweite Baustein des ideologischen »Bündels«), die nicht mit der Schule des Rationalismus in der Philosophie zu verwechseln sind. Für die Rationalisten ermöglicht der Bayes’sche Wahrscheinlichkeitsbegriff eine Form zu denken und zu urteilen, die von falschen Intuitionen, kognitiven Biases und Bauchgefühlen befreit sein soll. Für ihren umfassenden Anspruch, die »Fehler menschlicher Rationalität« aufzudecken und eine möglichst »fehlerfreie Weltsicht« zu entwickeln, wurde die Bewegung als elitär und selbstherrlich kritisiert.
Der sogenannte »Effektive Altruismus« (EA) als dritte Komponente des »Bündels« wiederum stellt eine Bewegung dar, die mit den Rationalisten ideell, personell und materiell eng verwoben ist und seit den 2010er Jahren überdies einen erheblichen Grad an institutioneller Verankerung gefunden hat. Man könnte EA als die Anwendung der erkenntnistheoretischen Prinzipien der Rationalisten auf moralisches Handeln beschreiben. Problematisch ist vor allem deren vereinfachende reduktive, technokratische und oft selbstherrliche Herangehensweise an moralische Fragen: EA betrachtet ethische Entscheidungen vor allem als mathematische Optimierungsprobleme und blendet dabei soziale Aushandlungsprozesse und politische Dimensionen im Kampf gegen Ungleichheit systematisch aus. Technologie ist immer die Lösung, nicht Teil des Problems. Das vorhandene System wird nie in Frage gestellt, strukturelle Probleme wie Kolonialismus, Kapitalismus oder Machtakkumulation gelten als zu komplex oder als zu schwer quantifizierbar und werden zugunsten kurzfristig skalierbarer Lösungen vernachlässigt.
Besonders relevant im Zusammenhang mit reaktionären Tech-Ideologien ist nicht zuletzt der »Longtermismus«, der die Betrachtungsweise immer weiter weg von akuten globalen Problemen wie Armut oder Gesundheitsversorgung hin zu spekulativen Szenarien in der fernen Zukunft verschoben hat – insbesondere im Kontext von KI. Hier wird die ethische Doktrin vertreten, dass ultralangfristige Risiken bereits heute moralisch zu berücksichtigen oder sogar zu priorisieren seien. Mit »ultralangfristig« sind dabei weniger die nächsten Generationen gemeint, sondern Menschen, die in Millionen, Milliarden oder Billionen Jahren leben werden (Gebru und Torres 2024, S. 7).
Es kommt deshalb entscheidend darauf an, solche Zukunftsnarrative als politische Beiträge zu begreifen, die bestimmte Interessen in der Gegenwart durchsetzen wollen. Dadurch wird von den realen Missständen und Krisen abgelenkt, die durch die KI-Industrie nicht nur massiv gefördert, sondern auch profitabel ausgenutzt werden.
Aus dem Geist von Tech-Ideologien wie Transhumanismus, Techno-Optimismus, Rationalismus, EA und Longtermismus gehen auch gleichzeitig neue, dezidiert politische Strömungen hervor: Bewegungen, die nicht nur als Hintergrundphilosophie das Handeln von Tech-Eliten inspirieren und legitimieren, sondern alternative Gesellschaftsentwürfe formulieren und aktiv versuchen, diese Entwürfe in radikalen politischen Diskursen umzusetzen.
Diese Bewegungen eint, dass sie gegen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Egalitarismus in liberalen Gesellschaften agitieren und wichtige Beiträge der politischen Philosophie seit der Aufklärung revisionistisch umdeuten. Exemplarisch verkörpern drei einflussreiche und radikale Strömungen diese Verknüpfung: der Cyberlibertarismus, mit seiner extremen Sichtweise in Bezug auf das Verhältnis zwischen Staat, Markt und individueller Freiheit; die Troll- und Manosphere-Subkulturen, die in ihren entsprechenden Online-Communitys sexistische, rassistische und antiegalitäre Ressentiments pflegen; sowie die Bewegung der Dark Enlightenment bzw. Neoreaction (NRX), die als faschistoide Radikalisierung technopolitischer Ideologien verstanden werden kann. Diese drei Strömungen spielen eine zentrale Rolle in der sich seit einem Jahrzehnt abzeichnenden Allianz zwischen Tech-Eliten und Alt-Right-Milieus.
Der neue Faschismus
Für den historischen Faschismus muss gelten: Rechte Kräfte wurden in ihrem transgressiven, also antagonistischen und destruktiven Potential verkannt. Transgression und Rückabwicklung aufklärerischer Errungenschaften der öffentlichen und politischen Kultur bilden dabei das zentrale Merkmal jeder aus der Demokratie heraus entstehenden faschistischen Bewegung (vgl. Eco 2020; Mason 2022). Um in den Blick zu bekommen, wie faschistische Regime – vielleicht gerade heute wieder – entstehen, werden faschistische Bewegungen im Folgenden als Kräfte begriffen, die wesentlich transgressiv und destruktiv sind. Faschismus bezeichnet damit zunächst kein bestimmtes politisches System, sondern eine Charakterdisposition und ihre politische Wirkungsweise. Faschismus ist so gesehen durch drei zentrale Merkmale gekennzeichnet, nämlich:
- 1. durch eine grundlegende Ablehnung von Streitkultur, Kritik und demokratischen Prinzipien inklusive der Ideale der Aufklärung wie etwa Gleichheit, Freiheit und geteilter Wohlstand;
- 2. durch eine persönliche Disposition zur Ausübung menschenverachtender Gewalt und Herabwürdigung anderer Menschen; sowie
- 3. durch positive Verklärung und instrumentelle Aneignung moderner Technologie als Machtinstrument.
Antidemokratisches Wirken und fehlende Streitkultur
Bei den politischen Kräfte, die sich im Zusammenspiel der angesprochenen intellektuellen und politischen Bewegungen zusammenbrauen, handelt es sich um antidemokratische Bestrebungen, die das Links-Rechts-System einander widerstreitender Positionen als solches überwinden wollen. Alt-Right-Akteure möchten über politische Fragen nicht argumentieren und sich in der Sache streiten, sondern das Fundament der Streitkultur selbst aushebeln und in diesem Sinne das demokratische System zersetzen.
Um die gewünschten »Verbesserungen« im Erbgut oder die »Anhebung« (bis hin zur »Explosion«) kognitiver Fähigkeiten und Intelligenz zu ermöglichen, laufen diese Ideologien darauf hinaus, technologisch fundierte Strukturen von Macht und Herrschaft zu installieren (oder bereits installierte stillschweigend zu tolerieren), die Menschen nach bestimmten Kriterien kategorisieren, bewerten und aussondern.
Für solche Zwecke ist bereits die heutige KI-Technologie nicht nur besonders geeignet, sondern in privatwirtschaftlichen Anwendungen wie Risikoscoring und prädiktiver Analytik dezidiert entwickelt worden (vgl. Mühlhoff 2023; McQuillan 2022). Die vermeintliche Sorge um die langfristige Zukunft der Menschheit erweist sich damit als eine Chiffre für Rassismus, Eugenik und weißes Überlegenheitsdenken.
Politisch sind viele dieser Bewegungen von der Idee von CEO-Monarchien als Staatsform verzückt. Demokratietheoretisch hat dieses Prinzip etwas Menschenverachtendes, weil es die Bürger*innen des Staates nur anerkennt, insofern sie sich widerspruchslos in eine Verwertungslogik einfügen und als Humanressource verwenden lassen. Das Recht, sich zu den Belangen des Gemeinwesens zu äußern und in politische Debatten einzubringen, wird ihnen dagegen nicht zugestanden.
Faschismus als Gewaltdisposition
Die rechte Konfliktführung, die den Gegner als Feind versteht, setzt psychische und charakterliche Dispositionen der Gewaltaffinität jener Menschen voraus, die diesen Politikstil befürworten und ausleben. Faschistische Kräfte erteilen der demokratischen Grundidee einer gewaltfreien Konfliktbewältigung eine Absage und möchten, wie die italienische Schriftstellerin Michela Murgia ausführt, Gewalt als „Instrument [des] politischen Kampfes“ rehabilitieren (2019, S. 57). So sind faschistische Kräfte in Vergangenheit und Gegenwart durch Verherrlichung und Romantisierung von Gewalt sowie erzieherische und sozioökonomische Bedingungen, die die Gewaltbereitschaft in einer Gesellschaft erhöhen, gekennzeichnet.
Das gewaltsame politische Agieren kann sich in verschiedenen Registern abspielen: sprachlich, medial, physisch, administrativ oder ökonomisch. Trotz der manifesten Präsenz menschenverachtender physischer Gewalt im rechtsradikalen politischen Spektrum ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass die nichtphysischen Gewaltformen eine ebenso entscheidende Rolle bei der politischen Massenmobilisierung des Faschismus spielen.
So ist das wohl wichtigste Vehikel von Gewalt als politischem Instrument die Sprache (wie Heidrun Deborah Kämper (2024) am Beispiel der AfD in Deutschland untersucht hat). Auch das Phänomen der Hassrede in den sozialen Medien und die gezielten, sprachlichen Diffamierungen politisch Andersdenkender durch rechtsorientierte Boulevardmedien gehören dazu.
Zu den administrativen und ökonomischen Formen der Gewalt zählt die gezielte Härte und Kälte, in der staatliche Apparate mit bestimmten Menschengruppen umgehen: Abschiebungen, Zurückweisung an der Grenze, überdurchschnittlich häufige Personenkontrollen, Einweisung in Notunterkünfte oder Detention Center, oder die Entmündigung durch Bezahlkarten treffen insbesondere migrantisierte Bevölkerungsgruppen. Die Verwendung der KI-Technologien in diesem Bereich ist weit vorangeschritten, nicht nur durch den Anbieter »Palantir« und seine Überwachungssoftware.
Zum Faschismus gehört aber nicht nur die persönliche Bereitschaft, Gewalt auszuüben, sondern auch eine Weltsicht, die diese Ausübung von Gewalt als naturgegeben versteht. Die Behauptung, dass soziale Hierarchien »natürlich« seien, findet sich unmittelbar in verschiedensten Ausdeutungen in den hier angesprochenen Tech-Ideologien wieder: Für den Transhumanismus ist technologischer Fortschritt das, was »natürliche« Hierarchien zwischen verschiedenen Subspezies der Menschheit begründet. Den Extropisten und Rationalisten sind angeblich natürliche Hierarchien der »Intelligenz« (die den technologischen Fortschritt bedingen) unbestreitbare Realität. Dabei wurde das hochgradig konstruierte Konzept der Intelligenz schon mehrfach dafür kritisiert, rassistische Verzerrungen zu beinhalten, was auch daran liegt, dass es der Eugenik des 20. Jahrhunderts entstammt (vgl. Cave 2020).
Technologie als Machtinstrument
Die Aneignung neuester Technologie als Machtinstrument – oft im Zusammenspiel von Industrie und Politik – ist ein weiteres wesentliches Kennzeichen des Faschismus. Schon der historische Faschismus eignete sich neueste Datenverarbeitungstechnologie als Machtinstrument an. „Sowohl die [italienischen] Faschisten als auch die Nazis verehrten die Technologie“, schreibt Umberto Eco (2020, S. 32).
Das ist heute nicht anders. Die Ideologien rund um das Thema KI zeigen, wie faschistoide Tendenzen aus dem Geist einer technologischen Innovationskultur geboren werden können. Die Vorgehensweise von DOGE in den USA ist ein naheliegendes Beispiel: KI-Technologie und techno-ideologische Managementprinzipien werden für einen antidemokratischen und antirechtsstaatlichen Umbau des Staatswesens genutzt. KI-Technologie ist prädestiniert dafür, bei einem solchen Rückschritt eine zentrale Rolle zu spielen. Denn es ist einer der Hauptzwecke, für die KI-Technologie heutzutage in der Privatwirtschaft entwickelt und eingesetzt wird, Menschen automatisiert zu sortieren und in Kategorien einzuteilen.
Die Büchse der Pandora wird in dem Moment geöffnet, wenn sich Tech-Eliten und Alt-Right-Politik wechselseitig annähern und die faschistoiden Potentiale solch einer Technologie zur Anwendung bringen: Ein politisches Regime, dem es auf gezielte Verfolgung und Diskriminierung bestimmter Gruppen ankommt, muss heute gar keine Volksbefragung mehr durchführen, braucht gar keinen detaillierten Zensus als Grundlage für seine Entscheidungen mehr, wenn dieses Regime die moderne IT-Industrie an seiner Seite weiß. Denn die Datenschätze von Plattformunternehmen umfassen bereits detaillierteste Informationen über die meisten Bürger*innen, Firmen, politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure – weil wir diese Informationen als Nutzer*innen tagtäglich freiwillig in diese Systeme einspeisen.
Wenn es nach dem Plan aktueller rechter Bewegungen geht, dann wird es unweigerlich zu einer unbeschränkten Verschmelzung von Staatsmacht und technologischer Macht kommen – mit dem Ergebnis, dass sich antirechtsstaatliche Verfahrensweisen, die auf automatisiertem Ein- oder Ausschluss, Bevorzugung oder Benachteiligung von Menschen durch KI-Systeme beruhen, und die Wirtschaftsinteressen der KI-Industrie gegenseitig steigern. Es steht zu befürchten, dass aus dieser Dynamik ein neues faschistisches System erwachsen könnte.
Was tun?
Wichtig wäre es, zuerst einmal diese Kräfte so früh wie möglich als solche zu benennen, durch Abgrenzung zu isolieren und bereits auf diese Weise daran zu hindern, sich auszubreiten. Gegen den neuen Faschismus zu kämpfen bedeutet daher, einander den Wert der freiheitlichen Rechtsordnung und der Demokratie in einer globalisierten Welt zu vermitteln und zu verteidigen, auch und besonders, indem diejenigen klar benannt werden, die diese Ordnung angreifen und abschaffen wollen. Keine Institution unseres Gemeinwesens sollte sich auf eine Position der vermeintlichen politischen Neutralität berufen, wenn es um die Frage von Demokratie oder Antidemokratie geht.
Bei der Aushandlung technologischer Zukunftsvisionen sollten wir zudem von der Prämisse ausgehen, dass wir Technologie gestalten können, dass wir der Machtakkumulation, die mit der Entwicklung bestimmter Technologien einhergehen wird, etwas entgegensetzen können – und dabei müssen wir stets die Frage nach der gesellschaftlichen Verteilung des Nutzens und Gewinns im Auge behalten. Und wir sollten uns bei alledem auch nicht zu sehr auf die Zukunft versteifen. KI ist jetzt schon da und hat reale Auswirkungen auf Menschen weltweit: soziale Ungleichheit, Manipulierbarkeit, Ausbeutung von Menschen und natürlichen Ressourcen, Erosion der Privatsphäre, Erosion der demokratischen Öffentlichkeiten, massive Akkumulation von Macht und Kapital bei wenigen Akteuren. Wir müssen uns über diese Verhältnisse aktiv aufklären, erst dann bekommen wir ein kritisches Instrumentarium in die Hand, das uns dazu befähigen könnte, verantwortungsvoll über KI-Zukünfte zu diskutieren.
Und schließlich wäre es gut, gesellschaftlich besser zu vermitteln und zu erklären, dass bewusste Regulierung das mächtigste demokratische Mittel darstellt, unsere Zukunft mit KI aktiv zu gestalten. Wir brauchen nicht weniger, sondern wir brauchen mehr Regulierung – und ein starkes demokratisches Gemeinwesen, das über diese verantwortungsvolle Regulierung bestimmt. Es geht hierbei um den Schutz vor Machtmissbrauch in der Gestalt von Angriffen auf die Grundrechte und die freiheitliche demokratische Grundordnung, die Technologie ermöglicht, wenn sie in die falschen Hände gerät. Nur eine aktive und aufgeklärte demokratische Kontrolle über die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien kann verhindern, dass diese zu Instrumenten faschistischer politischer Kräfte werden.
Literatur
Bostrom, N. (2014): Superintelligence. Paths, dangers, strategies. Oxford: Oxford University Press.
Cave, S. (2020): The Problem with intelligence. Its value-laden history and the future of AI. Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, S. 29-35.
Eco, U. (2020): Der ewige Faschismus. München: Hanser.
Gebru, T.; Torres, É. P. (2024): The TESCREAL bundle. Eugenics and the promise of utopia through Artificial General Intelligence. first monday 29(4), 1.4.2024.
Golumbia, D. (2024): Cyberlibertarianism. The right-wing politics of digital technology. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Kämper, H. D. (2024): Die Sprache der Rechten. Stuttgart: Reclam.
Mason, P. (2022): Faschismus. und wie man ihn stoppt. Berlin: Suhrkamp.
McQuillan, D. (2022): Resisting AI. An anti-fascist approach to Artificial Intelligence. Bristol: Bristol University Press.
Mühlhoff, R. (2023): Die Macht der Daten. Warum künstliche Intelligenz eine Frage der Ethik ist. Osnabrück: V&R unipress.
Murgia, M. (2019): Faschist werden. Eine Anleitung. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach.
Turner, F. (2019): Machine Politics. The rise of the internet and a new age of authoritarianism. Harper’s Magazine 29, S. 25-33.
Rainer Mühlhoff, Philosoph und Mathematiker, ist Professor für Ethik und kritische Theorien der Künstlichen Intelligenz an der Universität Osnabrück. Seine Forschungsthemen umfassen Ethik und Sozialphilosophie, kritische Theorie und Kontinentalphilosophie, Datenschutz und Demokratieresilienz, Wissenschaftsphilosophie und Technikphilosophie in der digitalen Gesellschaft.
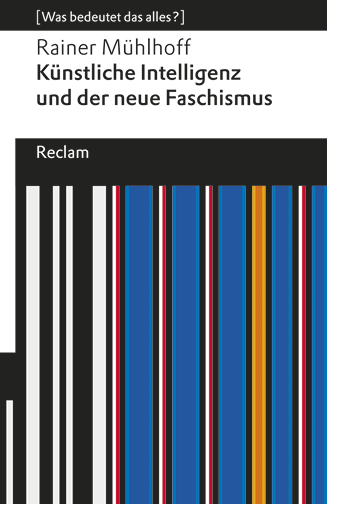
Dieser Beitrag basiert als gekürzter und überarbeiteter Auszug auf der jüngsten Veröffentlichung des Autors: Mühlhoff, R. (2025): Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus. Ditzingen: Reclam. W&F dankt dem Reclam-Verlag für die Nachdruckgenehmigung.


