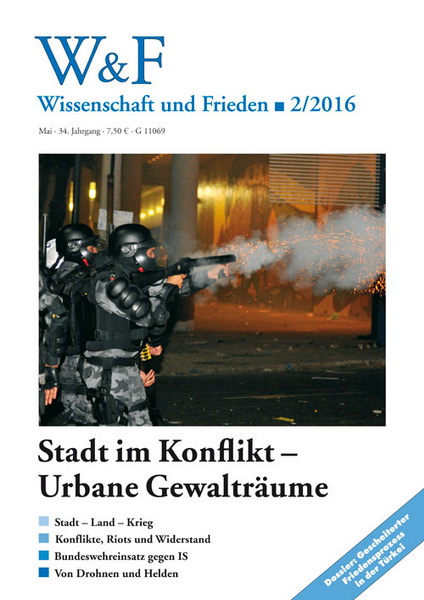Drohnen und Helden
von Ulrich Bröckling
W&F druckte in der Vergangenheit wiederholt Texte zur Drohnenkriegführung. Der Autor dieses Artikels interessiert sich besonders für die vermeintliche Ferne, in der mit Raketen bewaffnete Drohnen zum Einsatz kommen – das Einsatzteam sitzt Tausende Kilometer entfernt in einem Büro in Nevada oder im Pfälzer Wald –, die gleichzeitig mit einer außerordentlichen Nähe des Kriegsgeschehens gekoppelt ist, das in Echtzeit und hoher Auflösung auf den Bildschirmen der Operatoren angezeigt wird. Diese Art der Kriegsführung hat Folgen für das Selbstbild der Soldaten.
Am 4. Februar 2002 feuerte eine Drohne vom Typ Predator eine Hellfire-Rakete auf drei Männer in der Nähe der afghanischen Stadt Khost und tötete sie. Man vermutete, die CIA habe einen der drei wegen seiner Körpergröße und seiner grauen Haare für Osama bin Laden gehalten. Ein offensichtlicher Irrtum, wie sich bald herausstellte. Ein Pentagon-Sprecher erklärte im Nachhinein, „[w]ir sind davon überzeugt. es war ein angemessenes Ziel“, musste jedoch einräumen, „[w]ir wissen noch nicht genau, wer es war“.1 Journalisten berichteten später, bei den Getöteten habe es sich um Zivilisten gehandelt, die auf dem Gelände eines verlassenen Mudjaheddin-Camps nach Altmetall suchten.
Bei dieser Tötungsaktion handelte sich um die erste bekannt gewordene Operation einer bewaffneten Drohne. Zu Aufklärungszwecken waren die Predators schon seit 1994 eingesetzt worden, mit einem Waffensystem hatte man sie allerdings erst kurz zuvor ausgerüstet. In der Testphase hatten Experten befürchtet, der rückwärtige Feuerstrahl der Raketen könne die Leichtfluggeräte zerstören. Das geschah nicht, und damit begann der rasante Aufstieg der »Remotely Piloted Aircrafts« oder «Unmanned Combat Air Vehicles« (UCAV), so die offizielle Bezeichnung.
Die Bush-Regierung setzte in der Folge bewaffnete Drohnen in Afghanistan und Pakistan zunächst zur Tötung so genannter »high-value targets« ein, die Angriffe richteten sich gegen bekannte Talibanführer oder Mitglieder von al Kaida. Unter Obama wurde das Programm massiv ausgebaut, allein während seiner ersten Amtszeit zählte man fünfmal so viele Angriffe wie in den acht Jahren der Bush-Präsidentschaft. Inzwischen machen Drohnen ein Drittel der US-amerikanischen Kriegsluftflotte aus.2
Die US-Regierung betreibt zwei Drohnenprogramme: ein militärisches, das feindliche Kräfte in den Kriegsgebieten in Afghanistan und dem Irak bekämpft, und ein geheimes unter Verantwortung der CIA, das sich gegen Terrorverdächtige in der gesamten Welt richtet und auch in Gebieten operiert, in denen keine US-Truppen stationiert sind.3 Dokumentiert sind verdeckte Drohnenangriffe vor allem im Jemen, in Somalia und Syrien. Die Obama-Regierung weitete indes nicht nur die Einsatzgebiete aus, sondern sie erhöhte auch die Anzahl der Ziele.
Neben der Tötung namentlich bekannter Terrorverdächtiger, die auf einer vom Präsidenten unterzeichneten Todesliste aufgeführt sind, setzt sie auf »signature strikes«. Diese richten sich gegen „Gruppen von Männern, die bestimmte Signaturen tragen oder bestimmte Merkmale, die mit terroristischen Aktivitäten verbunden sind“.4 Die Identität der Zielpersonen ist zunächst noch unbekannt, »signiert« werden sie aufgrund ihres Verhaltens. Anhand einer Lebensmusteranalyse (pattern of life analysis) werden persönliche Profile angelegt, die sich aus den von den Überwachungskameras der Drohnen gesammelten Bewegungsmustern speisen, aber auch aus anderen Daten, beispielsweise aus der Auswertung von Mobilfunkverbindungen. In der Summe ergibt das Profiling ein Gesamtbild der zeitlichen, räumlichen und sozialen Verhaltensparameter eines Menschen.
Auf diese Weise wird das Töten sukzessive automatisiert; Algorithmen entscheiden, wer sterben muss.5 Welche Merkmale die Zielpersonen im Einzelnen als Verdächtige ausweisen, das bleibt geheim. Zivile Opfer werden kurzerhand wegdefiniert: Nachdem John Brennan, Obamas Berater in Sachen Terrorbekämpfung, 2011 stolz verkündet hatte, die Technik sei inzwischen so weit fortgeschritten, dass es im Jahr zuvor so gut wie keinen kollateralen Todesfall gegeben habe, deckte die New York Times auf, dass die amtlichen Dokumente alle Männer im wehrfähigen Alter, die sich im Gebiet des Drohneneinsatzes aufhalten, pauschal als Kombattanten einstuften. Korrigiert wurde dies, sofern explizite Hinweise auf die Unschuld der Getöteten auftauchten, allenfalls posthum.6
Recherchen unabhängiger Journalisten belegen demgegenüber einen hohen Anteil getöteter Zivilisten; ihr Anteil bewegt sich zwischen 12 und 35 Prozent. Allein für Pakistan gehen sie – Stand Anfang Mai 2015 – von 423 bis 962 zivilen Drohnenopfern aus, darunter zwischen 172 und 207 getötete Kinder, bei einer Gesamtzahl der Getöteten zwischen 2.449 und 3.949.7 Rechtlich gesehen ist die Politik der gezielten Tötungen höchst umstritten: Selbst Juristen, die solche Aktionen im Rahmen bewaffneter zwischenstaatlicher Konflikte durch das Völkerrecht gedeckt sehen, stufen Drohnenangriffe auf dem Gebiet von Staaten, mit denen man sich nicht im Kriegszustand befindet, als völkerrechtswidrig ein.
Die »präemptive« Tötung Verdächtiger ohne Anklage und Gerichtsurteil, die mit dem zynischen Euphemismus eines Kollateralschadens belegten Opfer unter der Zivilbevölkerung, die Traumatisierung der gesamten Bevölkerung in den betroffenen Regionen, die täglich 24 Stunden die Drohnen über sich kreisen hören und sehen und die jederzeit fürchten müssen, ohne Vorwarnung unter Raketenbeschuss zu geraten, all das gerät zum Skandal.
Geführt wird der Drohnenkrieg von US-amerikanischer Seite derzeit vor allem mit dem MQ-9 Reaper, einer Weiterentwicklung der Predator-Drohne, die für »hunt and kill«-Operationen ausgelegt ist. Mit einer Länge von elf und einer Flügelspannweite von zwanzig Metern kann diese Drohne bis zu dreißig Stunden in der Luft bleiben; sie fliegt in einer Höhe von bis zu 15.000 Metern und deckt dabei einen Einsatzradius von mehr als 3.000 Kilometern ab. Bestückt ist sie zum einen mit Hellfire Luft-Boden-Raketen und lasergesteuerten Präzisionsbomben, zum anderen mit dem Aufklärungssystem Gorgon Stare, das zahlreiche Infrarot- und Videokameras sowie Richtlaser kombiniert, bis zu 65 Streaming-Bilder gleichzeitig an unterschiedliche Adressaten sendet und es ermöglicht, eine Fläche von vier mal vier Kilometern in hoher Bildauflösung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu überwachen. Aus einer Flughöhe von 3,2 Kilometern lassen sich damit Nummernschilder entziffern. Das noch in der Planung befindliche Nachfolgesystem heißt Argus IS.
Neben einem Bodenteam, das für Start und Landung der Drohne zuständig ist, sind drei Personen für ihren Einsatz erforderlich. Diese Crew besteht aus einem Piloten, der das System fernsteuert, einem »Sensor Operator«, der die verschiedenen Kameras, Radargeräte und Sensoren bedient, und einem »Mission Intelligence Coordinator«, der die Kommunikation mit Analysten, Datenbanken und anderen Crews übernimmt.8 Während das Bodenteam auf einem Flughafen in regionaler Nähe zum Einsatzgebiet stationiert ist, sitzen die Operatoren im Schichtdienst auf einer Tausende von Kilometern entfernten Militärbasis in Nevada oder im Pfälzerwald vor ihren Bildschirmen. Die Daten werden ihnen in Echtzeit per Satellit übermittelt.
Die räumliche Distanz geht allerdings einher mit einer virtuellen Nähe: Mit dem ferngesteuerten Super-Zoom verfolgen die Drohnen-Operatoren ihre Zielpersonen über Tage, Wochen, manchmal Monate, rund um die Uhr. Sie registrieren, wann diese das Haus verlassen, wohin sie gehen, mit wem sie sich treffen. So entsteht eine einseitige, aber geradezu intime soziale Beziehung. Und wenn sie die Hellfires abgefeuert haben, sehen sie aus ebenso großer Nähe, was diese anrichten: Tod und Zerstörung in einem Umkreis von mindestens fünfzehn Metern. Anders als Bomberpiloten, die nach einem Abwurf weiterfliegen und den Schrecken, den sie bringen, niemals zu Gesicht bekommen, bleibt das elektronische Auge nach dem Treffer weiterhin auf den Punkt gerichtet, an dem die Opfer vernichtet wurden.
Es ist diese Virtualität des Tele-Kriegs, es ist der geografische Abstand zwischen waffenbewehrtem Flugobjekt und Bedienungspersonal und damit verbunden die Diskrepanz zwischen der tödlichen Gewalt, denen die Opfer der Drohnenangriffe ausgesetzt sind, und der Sicherheit der Crews in ihren »Operation Rooms«, welche diese Form der Kriegführung anstößig erscheinen lässt. Kritik kommt nicht zuletzt von militärischer Seite: Der Drohnenkrieg sei ein „»tugendloser Krieg«,der weder Mut noch Heldentum erfordert“, zitiert ein Artikel im »New Yorker« den vormaligen British Air Chief Marshall Sir Brian Burridge.9 Ein 19-jähriger Drohnenpilot berichtet von seinem ersten Angriff, bei dem er Fahrer und Beifahrer eines mit einem Maschinengewehr bestückten Pickups tötete, die eine Patrouille amerikanischer Bodentruppen in Südafghanistan beschossen: „Du fühlst Dich schlecht. Du fühlst Dich nicht ebenbürtig. Ich sitze hier heil und unversehrt, und diese Kerls da unten sind mitten drin, und ich kann mehr Wirkung haben als sie das können. Es ist fast, also, mir komme mir nicht so vor, dass ich es verdiene, wohlbehalten zu sein.“ 10
Die Strategie des gezielten Tötens widerspricht dem soldatischen Ethos mit seiner Idee eines »gerechten Kampfs«. Das Verdikt der Feigheit impliziert auch eine sexuelle Depotenzierung. So hat die offizielle Bezeichnung für die ferngesteuerten Waffensysteme – Unmanned Combat Air Vehicles – einen die Männlichkeit anzweifelnden Doppelsinn: »Unmanned« bedeutet im Englischen nicht nur unbemannt, sondern auch entmannt.11
Militärische Disziplinierung, die Fabrikation gehorsamer Soldaten, muss beides wecken, die Bereitschaft zu töten und die zu sterben, und zu diesem Zwecke werden diejenigen, die zum einen wie zum anderen willens und in der Lage sind, zu Vorbildern erhoben und als Helden verehrt. Das Ethos des fairen Kampfes liefert dafür das normative Gerüst: Die Gefahr, selbst getötet zu werden, suspendiert das allgemeine Tötungsverbot. Nur weil der Gegner mir ans Leben will und kann, so das militärische Ethos, darf und muss ich ihm das seine nehmen. Mit der kriegerischen Wirklichkeit hatten die Beschwörungen militärischen Heldentums indes niemals viel zu tun. Das Letzte, was sich Soldaten auf dem Schlachtfeld wünschen, ist ein fairer Kampf.12 Sie wollen überleben, keine Verletzungen davon tragen, nicht in Gefangenschaft geraten, vielleicht Beute machen, sich rächen, ihre Gegner außer Gefecht setzen oder einfach nur töten, und sie werden deshalb alles tun, um auf jeden Fall zu den Stärkeren gehören. Die Geschichte militärischer Rüstung lässt sich als ein einziger Versuch lesen, die Symmetrie der Konfrontation durch technische Überlegenheit zu asymmetrisieren, was durch immer neue Resymmetrisierungsversuche konterkariert wird, die wiederum neue Asymmetrisierungsanstrengungen in Gang setzen und so weiter.13
Die Drohnenkriegführung treibt die Asymmetrie von Kampf und technischer Effizienz so weit ins Extrem, dass die eine Seite ganz verschwindet. Die Spielregeln wandeln sich radikal: „Das Paradigma ist nicht jenes von zwei Kämpfern, die einander gegenüberstehen, sondern ein anderes: ein Jäger, der seinen Vorstoß macht, und eine Beute, die flieht oder sich versteckt.“ 14 Der Krieg wird zur präventiven Menschenjagd: „Es geht weniger darum, spezifische Angriffe zu erwidern, als vielmehr die Entstehung neuer Bedrohungen durch die frühzeitige Ausschaltung ihrer potenziellen Agenten zu verhindern.“ 15 Drohnen machen keine Gefangenen, und sie erlauben keine Kapitulation.
Das Besondere der »Drohnisierung« des Krieges liegt nicht in der imperialen Machtüberlegenheit, sondern im offiziellen Übergang „von einer Ethik der Aufopferung und Tapferkeit zu einer Ethik der Selbsterhaltung und mehr oder weniger akzeptierten Feigheit“.16 Für die westliche Militärpolitik wird der Schutz des Lebens der eigenen Soldaten zum absoluten Imperativ. Schon eine begrenzte Anzahl von Gefallenen – gemeint sind selbstverständlich nur Tote auf der eigenen Seite – würde die öffentliche Zustimmung zu einem Kriegseinsatz gefährden, so die militärische Begründung für die Umwertung militärischer Werte. Smarte Technologie soll deshalb übernehmen, wofür bisher Kampfeswille und Opferbereitschaft mobilisiert werden mussten.
In der Geschichte des Krieges führten neue und besonders wirkmächtige Waffen häufig auch zur Heroisierung derjenigen, die sie trugen oder lenkten – man denke nur an die Fliegerhelden des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Für die Drohnenpiloten trifft das Gegenteil zu: Sie sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, unverbesserliche »Nerds« zu sein, die ihrer puerilen Leidenschaft für Computerspiele nachgehen und vom sicheren Sessel aus die Raketen schon deshalb ohne Skrupel abfeuern, da sie zwischen virtueller und realer Welt kaum mehr zu unterscheiden wüssten. Der »Gamifizierung« des Krieges entspreche eine Playstation-Mentalität der »chair-borne rangers«, die ihre prospektiven Opfer nur als bewegte Bilder auf den Monitoren sähen. Die US Air Force klagt über ein »drone stigma«, dem die Crews ausgesetzt seien, und hat Mühe ausreichend qualifiziertes Personal zu finden: „Die meisten Piloten haben keinen Spaß daran, von einer Kiste aus zu fliegen.“ 17
Die militärischen Instanzen betonen inzwischen die besonderen psychischen Belastungen, denen die Drohnen-Operatoren ausgesetzt sein sollen. Die permanente Sorge, versehentlich Unschuldige zu treffen, sowie das emotionale Wechselbad, in der Nachtschicht per Fernsteuerung verdächtige Terrorkämpfer zu töten und am nächsten Morgen die Kinder zur Schule zu bringen, stellen demnach außergewöhnliche Stressoren dar und erhöhen das Burnout-Risiko.
Bedeutet Postheroismus also die Delegation heldenhafter Tugenden an Maschinen, die möglicherweise bald auch auf die menschliche Fernsteuerung verzichten werden? Phantasmen einer Kriegführung ohne tötende Gewalt gleichermaßen als technisches Substitut wie als geradezu hegelianische Aufhebung militärischen Heldentums. Der „prometheischen Scham“, dem unhintergehbaren Inferioritätsgefühl der Menschen angesichts der Überlegenheit der von ihnen geschaffenen technischen Werkzeuge, das der Philosoph Günther Anders den Menschen des Atomzeitalters attestierte,18 korrespondiert die ehrfürchtige Bewunderung ebendieser Werkzeuge.
Helden erzeugen die Drohnen allerdings auf ganze andere Weise: Das ferngesteuerte »targeted killing« führt dem globalisierten Dschihadismus fortlaufend neue Kämpfer zu. Sie setzen der Risikoaversion westlicher Kriegführung die Unbedingtheit ihres Todeswillens entgegen und finden dafür begeisterte Anhänger. Der »suicide bomber« ist die feindliche Komplementärfigur des Drohnenpiloten: „Auf der einen Seite das vollkommene Engagement, auf der anderen die absolute Distanzierung.“ Während im Selbstmordattentat „der Körper des Kämpfers vollständig mit seiner Waffe verschmilzt, garantiert die Drohne die radikale Trennung der beiden“.19 Der postheroische Traum einer sauberen Kriegführung gebiert heroische Ungeheuer.
Die Diagnose des postheroischen Zeitalters bedeutet daher keinesfalls ein Ende heroischer Anrufungen. Solange politische oder religiöse Mächte auf die Bereitschaft zum Selbstopfer angewiesen sind und sie schüren, wird man Helden suchen und finden. Der Streit darüber, ob militärischer Heroismus antiquiert ist und wir in der Ära des Postheroismus angekommen sind, führt deshalb nicht weiter. Schon die Frage ist falsch gestellt. In Abwandlung des bekannten Buchtitels von Bruno Latour20 müsste man stattdessen konstatieren: Wir sind nie heroisch gewesen. Wir sollten es immer nur sein. Und viel zu oft wollten wir es auch.
Anmerkungen
1) John Sifton: A Brief History of Drones. The Nation, 27.2.2012.
2) Asawin Suebsaeng: Drones – Everything You Ever Wanted to Know But Were Always Afraid to Ask- Mother Jones, 5.3.2013.
3) Jane Mayer: The Predator War – What are the risks of the C.I.A.’s covert drone program? The New Yorker, 26.10.2009.
4) Daniel Klaidman (2012): Kill or Capture – The War on Terror and the Soul of the Obama Presidency. New York: Houghton Mifflin, S.41.
5) Vgl. Nils Markwardt: Drohnenkrieg – Überwachen und vernichten. DIE ZEIT, 27.10.2014.
6) Jo Becker and Scott Shane: Secret »Kill List« Proves a Test of Obama’s Principles and Will. New York Times, 29.5.2012.
7) Das Bureau of Investigative Journalism in London dokumentiert die Zahl der Toten und Verletzten seit 2004. thebureauinvestigates.com/category/projects/drones/drones-graphs/; Stand 2. Mai 2015.
8) Peter M. Asaro: The labor of surveillance and bureaucratized killing – new subjectivities of military drone operators. Social Semiotics. 23.2.2013, S.196-224.
9) Jane Mayer, op.cit.
10) Mark Bowden: The Killing Machines – How to Think About Drones. The Atlantic, Sept. 2013.
11) Vgl. Grégoire Chamayou (2014): Ferngesteuerte Gewalt – Eine Theorie der Drohne. Wien: Passagen Verlag, S.110. Die folgenden Ausführungen verdanken Chamayous Buch zahlreiche Anregungen.
12) Mark Bowden, op.cit..
13) Vgl. Herfried Münkler (2006): Der Wandel des Krieges – Von der Symmetrie zur Asymmetrie. Weilerswist: Velbrück.
14) Grégoir Chamayou, op.cit, S.44.
15) Ebenda, S.46.
16) Ebenda, S.112.
17) Lee Ferran: Drone »Stigma« Means »Less Skilled« Pilots at Controls of Deadly Robots. ABC News, 29.4.2014.
18) Günther Anders (1983): Über prometheische Scham. In: ders., Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 1. Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution. München: C.H. Beck, S.21-95.
19) Brégoir Chamayou, op.cit., S.95-96.
20) Bruno Latour (1998): Wir sind nie modern gewesen – Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt a. M.: Fischer TB.
Ulrich Bröckling ist Professor für Kultursoziologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Soziologie der Sozial- und Selbsttechnologien, Gouvernementalitätsanalysen und die Soziologie des Krieges und des Militärs.
Dieser Artikel erschien in FifF Kommunikation 4-2015, eine erweiterte Fassungen des Beitrags in: Achim Aurnhammer und Ulrich Bröckling (Hrsg.) (2016): Vom Weihegefäß zur Drohne. Kulturen des Heroischen und ihre Objekte. Würzburg: Ergon Verlag. Übersetzung der englischsprachigen Zitate durch R.H.. W&F dankt für die Nachdruckrechte.