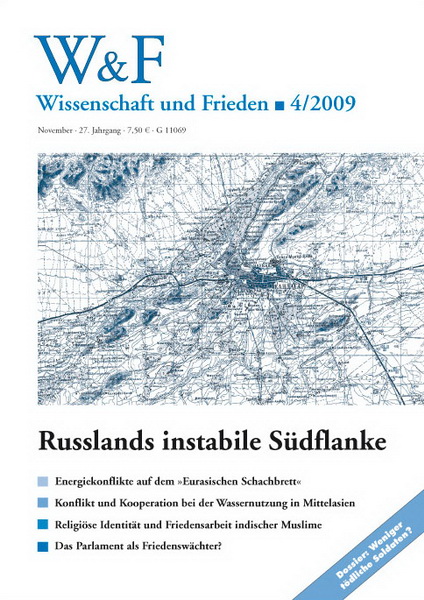Es geht keinem um Afghanistan
von Conrad Schetter
Wer sich dem deutschen Feldlager in Kundus nähert, dem steigen Erinnerungen an die Cowboy- und Indianerfilme der Kindheit hoch. Die Soldaten leben außerhalb der Stadt in einem bis an die Zähne bewaffneten Fort, das es mit der Infrastruktur einer deutschen Kleinstadt samt Post, Läden und Cafés aufnehmen kann. Angeheuerte afghanische Milizionäre bewachen den äußersten Wehrring. So müssen schon einige Hürden genommen werden, bis man in das Innere vordringt und den ersten deutschen Soldaten zu Gesicht bekommt: Von diesem Fort aus soll Sicherheit für die Bevölkerung von Kundus ausgehen, die für den Aufbau der Provinz als so unerlässlich erachtet wird – so zumindest die offizielle Begründung der Bundesregierung für die deutsche Truppenpräsenz.
Wie in jedem Indianerfilm gerät das Fort früher oder später in einen Belagerungszustand. Die Bevölkerung von Kundus, wegen deren Sicherheit man ja einst hier Palisaden errichtete, verschwindet dabei zunehmend aus dem Blickfeld. Die Bundeswehr entwickelte einen Tunnelblick, in dem sie den Showdown mit dem Gegner sucht, der pauschal als Taliban bezeichnet wird. Dieser Gegner sitzt nicht irgendwo in entlegenen Bergen, sondern direkt unterhalb des Bundeswehrlagers im Distrikt Chahar Darra. Zudem verstand es dieser Gegner in den letzten Monaten, ein um das andere Mal die Bundeswehr vorzuführen, sie in Scharmützel zu verwickeln, ihr Verluste beizubringen und dennoch unsichtbar zu bleiben. Welchen Offizier reitet da nicht die Wut, ob eines so listenreichen und zermürbenden Feindes. Dem nicht genug muss sich die Bundeswehr nun schon seit Jahren von den angelsächsischen NATO-Kollegen anhören, sich hasenfüßig im Norden des Lands zu verbarrikadieren und nicht in den Süden zu gehen, wo echter Krieg herrsche.
Die Entführung zweier Tanklaster in der Nacht vom 3. auf den 4. September, wenige Kilometer von dem deutschen Fort entfernt, gab nun die Möglichkeit, den Gegner zu stellen: Mehrere Dutzend Menschen, die auf verschwommenen Bildern dürftig als Feind identifiziert wurden, eröffneten die Chance zum Gegenangriff. Demnach sprachen die ersten Presseerklärungen der Bundeswehr von einem erfolgreichen Schlag gegen die Taliban, und glaubte Verteidigungsminister Franz-Josef Jung lange – viel zu lange – von einem glänzenden Sieg sprechen zu können.
Erst Nachrichten über zivile Opfer veranlassten die Bundeswehr, Argumente nachzuschieben, um das friedensumwobene Bild der Schutztruppe wieder herzustellen. Dies wirkte unbeholfen und unglaubwürdig: So sickerte schnell an die Öffentlichkeit, dass die Informationslage, auf deren Basis der Befehl angeordnet worden war, äußerst dünn gewesen war und dass viele Zivilisten – unter diesen auch Kinder – zu Tode gekommen waren; auch verstieß der Einsatz gegen NATO-Regeln, da Luftnahunterstützung nur angefordert werden darf, wenn sich Truppen in Bedrängnis befinden. Ebenfalls das Argument, dass nicht genügend Soldaten für das Ausrücken einer Patrouille zur Verfügung standen und man daher die Luftwaffe alarmiert habe, ist nicht stichhaltig. So konzentriert sich der Bundeswehreinsatz mit gut 900 Mann in Kundus fast ausschließlich auf den »Problemdistrikt« Chahar Darra.
Weit eher verdeutlicht die Anforderung von Luftunterstützung, dass die Lage der Deutschen um einiges prekärer ist, als es die Bundesregierung zugeben mag: Jede Nacht wird das Lager beschossen. Patrouillen fahren fast täglich auf Minen. Die Bundeswehr kann sich faktisch nicht mehr aus dem Lager herauswagen. Bislang ist es nur vielen glücklichen Umständen zu verdanken, dass nicht mehr Soldaten zu Tode gekommen sind. Welcher diensthabende Offizier will da schon seine Leute nachts rausschicken, wo doch an jeder Ecke ein Hinterhalt lauert. Diesen Zustand bezeichnet der Volksmund – abgesehen von juristischen Griffelspitzern – als Krieg.
Auch die nachgeschobene Erklärung, dass es sich um einen Akt der Selbstverteidigung des deutschen Lagers gehandelt habe, mutet unglaubwürdig an: So waren die entführten Fahrzeuge im Flussbett festgefahren. Die Gefahr eines Angriffs auf das Lager durch zu fahrenden Bomben umfunktionierte Öltanker, wie sie das Verteidigungsministerium verbreitete, ist ebenfalls bizarr. Die Zufahrtstraße zum Camp ist auf große Distanz hin kontrollierbar; gegnerische Fahrzeuge haben nicht die Möglichkeit, Fahrt aufzunehmen.
Gerade das letztgenannte Argument offenbart die Nabelschau des gesamten Einsatzes. So lässt die Begründung, dass die Sicherheit der Bundeswehr gefährdet gewesen sei, aufhorchen. Anscheinend spielt die Ausgangsbegründung für den Einsatz in Afghanistan keine Rolle mehr. Es geht eben schon längst nicht mehr um die Sicherheit der afghanischen Zivilbevölkerung, sondern nur um die der deutschen Soldaten. Dass die Öltanker etwa den belebten Marktplatz von Kundus in ein Flammenmeer hätten verwandeln können, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. Diese Betriebsblindheit scheint nicht einmal dem Pressestab der Bundeswehr aufgefallen zu sein.
Dies kann nur zweierlei bedeuten: Entweder geht die Bundeswehr davon aus, dass die Aufständischen gar kein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung darstellen – vielleicht da sie im Zweifelsfall eher mit dem Widerstand als mit der Bundeswehr sympathisiert; oder es hat sich der Bundeswehreinsatz so sehr auf das Kräftemessen mit den Aufständischen fixiert, dass die Zivilbevölkerung gar keine Rolle mehr spielt. Welche Argumentationslinie sich auch in den Köpfen der Bundeswehr durchgesetzt haben mag, man ist weit von der eigentlichen Aufgabe abgerückt und nimmt – wenn auch nach langem Zögern, dann aber mit öffentlichem Bedauern – den Tod von Zivilisten in Kauf, die es doch zu schützen gilt. Wie unter diesen Umständen in Zukunft noch Entwicklungsprojekte erfolgreich durchgeführt und das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden soll, bleibt schleierhaft. Die Bundeswehr vollzog daher in jener Nacht unwiderrufbar und für jeden Einwohner von Kundus spürbar den Schritt vom Friedensbringer zur Kriegspartei.
Die Fokussierung des deutschen Afghanistan-Engagements auf die Sicherheit derjenigen, die eigentlich Sicherheit bringen sollen, ist jedoch nicht neu; sie wurde nur durch die Luftangriffe von Kundus offensichtlich. So ist die deutsche Entwicklungszusammenarbeit vor allem darauf ausgerichtet, durch den Bau von Brücken, Schulen und Brunnen die Sicherheit der deutschen Soldaten zu verbessern. Entwicklungsmaßnahmen sind längst Sicherheitsinteressen untergeordnet. Dieses selbstreferentielle Vorgehen, das die afghanische Zivilbevölkerung weitgehend außen vor lässt, wird dann mit dem markigen Schlagwort »Keine Entwicklung ohne Sicherheit, keine Sicherheit ohne Entwicklung« propagiert.
Die Negierung der Afghanen prägt auch das politische Getöse im deutschen Wahlkampf. So dreht sich die Diskussion allein darum, ob und wann die deutschen Soldaten aus Afghanistan abziehen sollen. Auch hier erfolgt eine eigenartige Selbstbeschäftigung, die das ferne Afghanistan zur Bühne deutscher Außen- und Sicherheitspolitik degradiert. Dieser Schlagabtausch – ob durch die klare Forderung der Linken nach einem sofortigen Abzug, durch die wolkige Regierungserklärung der Bundeskanzlerin oder den jüngsten 10-Punkteplan von Außenminister Frank-Walter Steinmeier – umgeht die Debatte, worum es in Afghanistan eigentlich gehen soll: Wozu man dort Bundeswehrsoldaten benötigt? Weshalb Milliarden in das Land gepumpt werden? Internationale Politiker und Experten doktern seit Jahren an Afghanistan herum, ohne eine klare Zielsetzung entwickelt zu haben. Geht es nun um Terrorbekämpfung, um Staatsaufbau, um die Einführung von Demokratie und Menschenrechten oder – wie gegenwärtig immer stärker gepredigt – nur noch um Stabilität? Acht Jahre nach der Intervention muss die internationale Gemeinschaft mehr und mehr eingestehen, dass sie es weder verstanden hat, realistische Zielsetzungen zu formulieren, noch in einem der gerade genannten Bereiche grundlegende Fortschritte erzielt zu haben.
Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass es die Interventen kaum für nötig hielten, sich auf die afghanischen Realitäten und Bedürfnisse einzulassen – abgesehen von folkloristischen Momenten wie der Einberufung einer Loya Jirga im Juni 2002. Kaum einer fragt, welche Zukunft sich die Afghanen selbst wünschen – vielleicht da die Antwort zu unbequem ist, wenn afghanische Vorstellungen zu sehr von den eigenen abweichen. Diese Diskrepanz zwischen den ehrgeizigen Zielen, die sich die internationale Gemeinschaft gesteckt hat, und divergierenden afghanischen Wirklichkeiten wird in der gegenwärtigen Situation offensichtlich: So machen die Manipulation bei den kürzlich abgehaltenen Präsidentschaftswahlen in Afghanistan auch der deutschen Öffentlichkeit klar, dass das Land noch weit von den ambitionierten Zielen entfernt ist.
Wenn sich jedoch die Politik auf keine Diskussion über die Zielsetzung und die zu wählenden Instrumente einlassen will und die Afghanen wie Objekte und nicht wie gleichwertige und gleichberechtigte Subjekte behandelt, wie kann dies dann von den Soldaten vor Ort verlangt werden? So durchzieht die gesamte Intervention von der politischen Entscheidungsebene bis hin zum einfachen Bundeswehrsoldaten der Habitus einer zivilisatorischen Überlegenheit und die Ignoranz gegenüber afghanischen Lebenswirklichkeiten. Die Afghanen bleiben die »wilden Indianer« außerhalb des Forts, denen im besten Fall der Eigenwert einer Karl May Romantik zugesprochen wird.
Conrad Schetter ist Senior Research Fellow am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn.