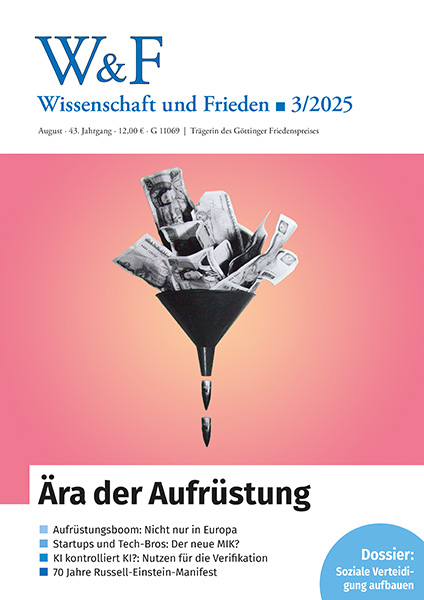Friedensarbeit in Zeiten der Klimakrise
9. Jahrestagung, Netzwerk für Friedensforschung und Konfliktbearbeitung in Österreich (NeFKÖ), Graz, 23.-25. April 2025
Unter dem aussagekräftigen Titel der diesjährigen Tagung der NeFKÖ im April 2025 trafen Friedensforscher*innen, berufliche sowie ehrenamtliche Praktiker*innen der Friedensarbeit und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft an der Universität Graz aufeinander, um über die Zusammenhänge von Klimakrise und Friedensarbeit zu sprechen.1
Die dreitägige Tagung begann am Abend im Theater im Bahnhof mit einer Keynote von Christiane Fröhlich zu »Friedensarbeit in Zeiten der Klimakrise«. Sie thematisierte, inwiefern die Klimakrise einerseits Konflikte befeuern kann und andererseits neue Möglichkeiten für Friedensarbeit hervorbringt, indem sich Gemeinschaften formen, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Anschließend an den Vortrag gab es einen regen Austausch mit dem Publikum in Form einer Fishbowl-Diskussion, mit Impulsen von Juliana Krohn und Sophia Stanger zu Schnittmengen von Friedensarbeit und Klimagerechtigkeit. Juliana Krohn sprach in ihrer Stellungnahme die Notwendigkeit an, den Dualismus von Natur und Mensch aufzubrechen. Es gelte vielmehr ganzheitlich zu denken, wie der Mensch mit der Natur im Einklang leben kann, anstatt Natur nur als Rohstoff zu sehen. Sie verdeutlichte, wie Kriege nicht nur Menschen zur Flucht zwingen, sondern beispielsweise auch die Wanderung von Zugvögeln stören und dadurch ganze Ökosysteme zu destabilisieren in der Lage sind. Sophia Stanger thematisierte, was die Friedensarbeit und die Klimagerechtigkeitsbewegung voneinander lernen können. Sie brachte dabei das strategische Bilden von Allianzen und die Konfliktsensibilität als konkrete Beispiele auf. Aus dem Publikum wurden weitere Schnittmengen von Klimakrise und Friedensarbeit aufgebracht. Beispielsweise, dass Aufrüstung auf Kosten der Umwelt gehe oder dass Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement Mittel sein können, beiden Krisen entgegenzuwirken und damit verbunden, wie und wohin sich die Friedensbewegung und die Klimagerechtigkeitsbewegung im Vergleich entwickeln und wo sie zusammenarbeiten können.
Die Tagung wurde am zweiten Tag im Afro-Asiatischen Institut Graz mit Workshops fortgeführt. Wie Frieden und erneuerbare Energien bei Gewalt gegen Aktivist*innen in Südamerika zusammengedacht werden können, thematisierte Julia Sachseder. Mit Degrowth und sozial-ökologischen Transformationsstrategien beschäftigte sich der Workshop von Josef Mühlbauer, während Fragen des Zusammenhangs von Renaturierungsprozessen und praktischer Konfliktarbeit bei Sophia Stanger und Wolfgang Weilharter im Zentrum standen. Wie Demokratiearbeit gleichermaßen Klimaschutz und Friedensförderung unterstützen kann, wurde mit Arno Niesner vertieft.
Nicht fehlen durfte der anschließende Raum für Netzwerkarbeit. Viele NGOs, Zentren und Initiativen stellten sich vor (u.a. Friedensbüro Salzburg, UNESCO Österreich, Austrian Center for Peace, Grazer Initiative für Frieden und Neutralität, Empowerment for Peace, Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung der Universität Klagenfurt, Caritas, Bertha von Suttner Friedensakademie, attac, das Aktionsbündnis für Frieden, aktive Neutralität und Gewaltfreiheit) und boten Raum für Austausch.
Solidarisch gegen die Wurzeln globaler Krisen
Der dritte Tag der Tagung stellte primär die Vernetzung von Friedensaktivismus und Klimaaktivismus ins Zentrum und erkundete gemeinsame Handlungsmöglichkeiten. Dazu waren Vertreter*innen der Klimagerechtigkeitsbewegung eingeladen (Fridays for Future, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion und Letzte Generation). In diesem Austausch zeigte sich besonders, dass auch bei der diesjährigen NeFKÖ-Tagung verschiedene Generationen aufeinandertrafen, indem nicht nur die Altersspanne durch die im Raum anwesenden Personen sichtbar war. Auch trafen verschiedene Lebenswelten mit unterschiedlichen Sprachgewohnheiten und Prioritäten im Aktivismus aufeinander. Was beide Aktivismusbereiche verbindet, so die gemeinsame Analyse, sind die begrenzten Kapazitäten der aktiven Personen, was einerseits für mehr Zusammenarbeit spräche, andererseits auch dagegen, weil Netzwerkarbeit viele Ressourcen benötigen kann. Ein Thema, was bisher die Zusammenarbeit erschwert habe, sei die Frage der Medienresonanz bei gemeinsamem Aktivismus: Eine aktivistische Gruppe befürchtete, dass kontroverse Meinungen – etwa zu aktuellen Friedensthemen – ihre Außenwirkung in der Gesellschaft schädigen könnten. Aus diesem Grund seien sie sehr vorsichtig, um weiterhin ein breites gesellschaftliches Publikum erreichen zu können. Wichtiger sei es daher – darin waren sich viele einig – einen gemeinsamen Ursprung der Krisen benennen zu können, gegen die alle kämpfen: Hier wurden etwa der Kapitalismus oder das Patriarchat genannt. Eine Zusammenarbeit könnte auf dieser Basis stattfinden und gemeinsame Handlungsspielräume eröffnen. Es brauche auch eine gemeinsame Sprache für die Zusammenarbeit, die alle Generationen, Personen auf dem Land und in der Stadt sowie Menschen aus verschiedenen Lebenswelten und Aktivismusbereichen verstehen könnten.
Zugleich wurde thematisiert, dass mehr Konflikte eingegangen und Diskussionen gewagt werden könnten, so dass Gespräche zwischen Gruppen der unterschiedlichen Aktionsfelder auch stattfinden, anstatt eine Zusammenarbeit im Vorhinein auszuschließen. Hier könne die Klimagerechtigkeitsbewegung von der Friedensarbeit lernen und Konflikte auch als etwas Positives begreifen. Konsens schien zu sein, dass Vernetzungsarbeit unterschiedliche Formen annehmen kann, aber nicht notwendigerweise nach außen getragen werden oder auf gemeinsame Kampagnen hinauslaufen müsse. Jedenfalls wurde im Austausch die gegenseitige Wertschätzung für die unterschiedlichen Arten des Aktivismus betont. Gemeinsam stellten die Anwesenden auch große Diskrepanzen zwischen der Theorie und Praxis der begleitenden Wissenschaft und dem entsprechenden zivilgesellschaftlichen Engagement fest, die zumindest problematisiert, wenn nicht eigentlich überwunden werden sollten.
Zum Abschluss der Tagung hielt Maximilian Lakitsch einen Kurzvortrag über die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes der Klimakrise und des Friedens in Aktivismus, Politik und Forschung. Er betonte, dass Gewaltstrukturen multiple Krisen hervorrufen, die den Menschen und die Natur gleichermaßen betreffen. Insgesamt hat die diesjährige Tagung des Netzwerks für Friedensforschung und Konfliktbearbeitung in Österreich viele Handlungsspielräume zwischen Klimaaktivismus und Friedensarbeit aufgezeigt. Sie war in diesem Jahr erstmalig bilingual (deutsch und englisch), sicherlich ein wesentlicher Faktor, um Friedensarbeit in Österreich stetig vielfältiger und intersektionaler zu betreiben. Die nächste Tagung soll im Herbst 2026 in Salzburg stattfinden, voraussichtlich mit einer Vertiefung zum Thema Friedensbildung.
Anmerkung
1) Ich danke Claudia Brunner für ihr konstruktives Feedback und David Scheuing für das sorgfältige Redigieren dieses Textes.
Selina Manneck