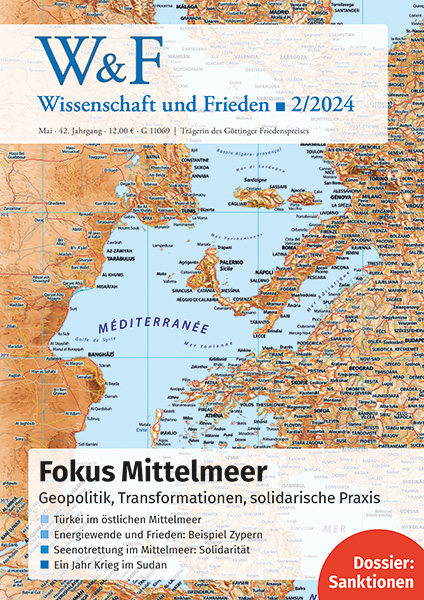Friedenspsychologie in unfriedlichen Zeiten
Eine Artikelserie
von Stefanie Hechler, Frank Eckerle, Ruth Ditlmann, Klaus Harnack und Klaus Boehnke
In der im November 2023 veröffentlichten Ausgabe 4/2023 von W&F zum 40. Jahrestag des Ersterscheinens findet sich ein programmatischer Artikel von Ulrich Wagner mit dem Titel »Wir brauchen Friedenspsychologie! Aber wie soll die aussehen?« (S. 32ff.) Auf der W&F-Geburtstagsfeier selbst, am 6.-7. Oktober 2023, gab es ein gut besuchtes Rundgespräch zum Thema »Quo Vadis Friedenspsychologie?« unter Beteiligung der für diesen Text Verantwortlichen.
Die Reihe kurz vorgestellt
Beginnend mit diesem Heft stellen nun eine Reihe von Friedenspsychologinnen und -psychologen ihr Verständnis davon vor, welche Formen aktuelle empirische Forschung in der Friedenspsychologie annehmen kann. Sie stellen sich damit der von Ulrich Wagner aufgeworfenen Frage, wie Friedenspsychologie im Sinne psychologischer Friedensforschung denn aussehen kann und sollte. Die Serie soll aber auch als Inspiration für Angehörige anderer Disziplinen dienen, die sich mit ähnlichen Fragen z.B. von normativer Positionierung der Forschenden oder Fragen von Diversität beschäftigen.
In diesem Heft legen Stefanie Hechler und Thomas Kessler ihre Überlegungen dazu vor. Ihr Beitrag ist ein Forschungsbericht über die Auswirkungen von Medienberichten auf Vorurteile gegenüber migrantischen Gruppen. In den betrachteten Studien wurde das Ausmaß von Gewalt oder Freundlichkeit gegenüber Minderheiten in realen und fiktiven Medienberichten variiert. In Anlehnung an »klassische« Befunde der Sozialpsychologie hängt das Ausmaß der Feindseligkeit, wie es sich z.B. in Fragebögen zeigt, nicht nur von der Wahrnehmung »der Anderen« ab, sondern es spielen auch intragruppale Prozesse eine entscheidende Rolle, d.h. wie „wir uns gegenüber den anderen positionieren“. Der Beitrag zeigt, wie experimental-psychologische Forschung im Labor zusammen mit Umfrageforschung Verschiebungen in sozialen Normen beleuchten kann. Er liefert ein Beispiel dafür, wie geteilte Informationen das Zusammenleben von sozialen Gruppen beeinflussen können. Das friedenspsychologische Forschungsthema ergibt sich aus Sicht der Autorin aus der Kontextualisierung grundlegender psychologischer Prozesse in konfliktgeladenen öffentlichen Debatten.
Im nächsten W&F-Heft (3/24) wird dann Frank Eckerle aus einem Projekt berichten, das demonstriert, dass Friedenspsychologie nicht die Befriedung, sondern die Befreiung der Gesellschaft zum Ziel haben sollte. Anhand vorhandener und eigener aktueller Forschung skizziert er, wie präfigurative Proteste und direkte Aktionen im Kontext der Klimabewegung dazu beitragen können, ideologische Legitimationen des neoliberalen Status quo aufzubrechen. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Frage, ob das Erleben solcher präfigurativer Experimente als Teilnehmer*in oder Beobachter*in Teil eines Bewusstseinsbildungsprozesses ist, und somit zur Politisierung gegen Ungerechtigkeit und Individualisierung führen kann.
Im letzten Heft des Jahrgangs 2024 schließt sich ein Beitrag von Ruth K. Ditlmann unter dem Titel »Die psychologische Wirkung von Erinnerungsprojekten zum Holocaust« an. In diesem Beitrag stellt sie kurz drei Studien vor, die mit quantitativen Methoden die psychologische Wirkung von bekannten Erinnerungsformaten untersuchen. In einer Langzeitstudie zum Thema zeigt sich zum Beispiel, dass in Berliner Wahlbezirken der Anteil an Stimmen für die AfD sinkt, nachdem dort Stolpersteine platziert wurden. Danach setzt sie sich anhand der vorgestellten Studien mit der Frage der Normativität auseinander, die beim Thema Erinnerungsarbeit eigentlich unumgänglich ist. Sie fragt sich, welche normativen Ziele in den sozialpsychologischen Theorien, mit denen sie arbeitet, versteckt sind, wie die quantitative Messung in angewandter Forschung diese Ziele sichtbar macht, und inwiefern man sich als empirisch Forschende zu den Zielen bekennen muss, die man misst.
Im ersten Heft des Jahrgangs 2025 wird es dann um einen Themenkomplex gehen, der sowohl in der Friedensbewegung als auch in der Friedenspsychologie gerne negiert wird – die ökonomische Psychologie. Der Beitrag von Klaus Harnack wird sich unter dem Arbeitstitel »Psychologisch-hyperpersonalisierte Bankgeschäfte – Ein Möglichkeit für die finanziellen Inklusion im Globalen Süden?« mit finanzpsychologischen Ansätzen beschäftigen, die finanzielle Inklusion vorantreiben sollen, besonders im Globalen Süden, in dem mehr als ein Viertel aller Menschen keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen hat. Finanzielle Inklusion gilt als eine zentrale Stellschraube im Kampf gegen Armut und hier sind psychologisch gestaltete Ansätze besonders vielversprechend, die ein bedürfnisorientiertes Bankwesen ermöglichen. Forschungsergebnisse aus der Behavioral Finance, dem zielorientierten Bankwesen, als auch Ansätze aus dem Nachhaltigkeitsbanking werden hierfür dargestellt und eingeordnet werden.
Im zweiten W&F-Heft des Jahrgangs 2025 berichtet Klaus Boehnke dann abschließend von seiner seit 1985 laufenden Längsschnittstudie »Life under nuclear threat« (LuNT). Die LuNT-Studie wurde im Jahre 1985 mit der Befragung einer großen Stichprobe von damals 14-jährigen in Kooperation mit der Friedensnobelpreisträger-Organisation IPPNW begonnen. Sie hat inzwischen insgesamt 12 Befragungswellen (im Abstand von jeweils 3 ½ Jahren) erlebt. Nach wie vor nehmen etwa 200 Personen, mittlerweile im Durchschnitt 53 Jahre alt, an der Befragungsstudie teil. Eine so lange laufende Studie legt es in besonderem Maße nahe zu reflektieren, ob und wie die persönlichen Werte des Verfassers bzw. der Zeitgeist das Studiendesign beeinflusst haben. Inhaltlich wird der Beitrag von Klaus Boehnke vor allem aufzeigen, welche Ängste und Hoffnungen die Befragten seit 1985 in besonderem Maße bewegt haben.
Das Forum Friedenspsychologie ist bemüht, die skizzierte Reihe auch nach ihrem aktuell avisierten Ende weiter fortzusetzen und ruft bereits jetzt ihre Mitglieder auf, sich bei den Verfasser*innen dieses Textes zu melden, um zusammen die Fortsetzung der Reihe in Angriff zu nehmen.