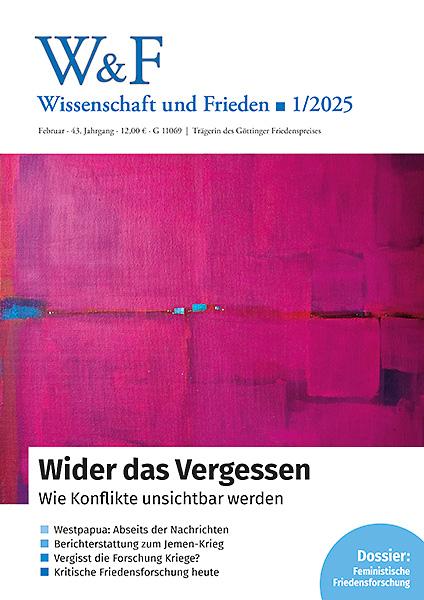Gerechtigkeit im Zeitalter planetarer Herausforderungen
Internationale Konferenz, EnJust Netzwerk, Universität Hamburg, 21.-23. November 2024
Die fünfte internationale »EnJust«-Jahreskonferenz zum Thema »Environmental Justice in the Age of Planetary Peril: Concepts, Agencies, Mobilizations« fand in diesem Jahr in Kooperation mit dem Institut für Geographie der Universität Hamburg statt. Rund 100 Teilnehmende aus 20 verschiedenen Ländern, u.a. aus Mexiko, Indien, Kolumbien, Italien, den USA und Deutschland, kamen für drei Tage im Warburg-Haus und im Hauptgebäude der Universität Hamburg zusammen. Einige Programmpunkte, wie die Keynote-Vorträge von Rita Floyd (University of Birmingham) und Andrew Baldwin (Durham University), waren öffentlich zugänglich.
Die Konferenz widmete sich der Frage, welche Handlungsspielräume und Entfaltungsmöglichkeiten sich für Umweltgerechtigkeitsbewegungen im Zeitalter planetarer Gefahren und Unsicherheit ergeben und welche Konzepte für ihre Analyse nötig sind. Insbesondere die sich zuspitzende Klimakrise und damit einhergehende Dringlichkeitsappelle nach schnellen und wirksamen Lösungsansätzen bergen – so eine der Leitthesen der Konferenz – die Gefahr, bestehende Ungleichheiten und Machtverhältnisse auf globaler Ebene zu verfestigen und zugleich Gerechtigkeitsforderungen zu untergraben. So sind Dekarbonisierungsbestrebungen, wie etwa die Energiewende, häufig in Diskurse des technologischen Lösungsglaubens und neoliberaler Governance eingebettet, die wiederum dazu beitragen, einen postfossilen Extraktivismus und »Grünen Kolonialismus« zu fördern und zu legitimieren.
Dies zeigt sich beispielsweise, wenn vermeintlich ungenutzte Flächen und Ressourcen im sogenannten »Globalen Süden« für den oft als alternativlos dargestellten Bedarf an »sauberer Energie« der kapitalistischen Zentren des »Globalen Nordens« genutzt werden und es dabei zu Landraub oder Vertreibungen kommt. Gleichzeitig verleihen der Klimawandel und seine direkten und indirekten Folgen, wie der Meeresspiegelanstieg oder Migrationsbewegungen, überkommen geglaubten Vorstellungen von nationaler Sicherheit und territorialer Abschottung neuen Auftrieb. Diesen Strategien des technologischen Solutionismus und der Versicherheitlichung stehen jedoch eine ganze Reihe von Bewegungen gegenüber, die den Klimawandel als eine grundlegende Gerechtigkeitsfrage begreifen und für eine sozial-ökologische Transformation und alternative Formen der Nachhaltigkeit kämpfen. Dieses Spannungsfeld zwischen Dringlichkeit, Sicherheit und Gerechtigkeit stand im Mittelpunkt der zahlreichen Panels, Interventionen, Vorträge und Diskussionen.
Damit knüpfte die »EnJust«-Konferenz 2024 unmittelbar an die Vorjahreskonferenz in Chiapas, Mexiko, an, die den Blick auf bestehende und neue Gerechtigkeitskonzepte gerichtet und deren politische Umsetzbarkeit diskutiert hatte. Angesichts zunehmender Bedrohungen planetaren Ausmaßes und einer grundsätzlichen Infragestellung etablierter Mensch-Natur-Verständnisse, die in jüngster Zeit im Zuge der Diskussion um das Anthropozän bzw. den sogenannten »planetary turn« enormen Auftrieb erhalten hat, ging es bei der diesjährigen Konferenz jedoch noch stärker um die Frage der Angemessenheit bestehender Gerechtigkeitskonzepte und die Notwendigkeit neuer Ansätze und Theorien, die die planetaren Wirkmächte und Bedrohungen besser abbilden können.
Gerechtigkeitskonzepte und Ansätze für eine gerechte Transformation
Die diesjährigen Keynote-Vorträge hielten Andrew Baldwin (Durham University) und Rita Floyd (University of Birmingham). Andrew Baldwin hob in seiner Keynote zu »Racial Futurism« hervor, wie Sicherheitsdiskurse in der Klimapolitik Machtverhältnisse verändern und dabei häufig auf Kosten sozialer Gerechtigkeit gehen. Rita Floyd beleuchtete unter dem Titel »Achieving Climate Justice via Securitization?« die Risiken, aber auch Chancen, die eine sicherheitsbasierte Herangehensweise für die Erreichung von Klimagerechtigkeit bieten kann.
Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Sessions lagen unter anderem auf Transformationskonflikten, Wissenspolitiken, Klima-Gerichtsverfahren, Energiewendeprozessen sowie Wassergerechtigkeit. Häufig ging es um die Frage, wie bestimmte technologische oder politische Maßnahmen, wie z.B. der Ausbau von Energienetzen oder extraktiven Industrien, soziale Spannungen in betroffenen Gemeinschaften hervorrufen und dadurch Widerstand erzeugen – etwa in der Session »Mega-Projects and Infrastructural Violence«. Diskutiert wurde aber auch, unter welchen Umständen Forderungen nach Umweltgerechtigkeit dazu beitragen können, Konflikte zu entschärfen, die durch Ressourcenkonflikte und Umweltzerstörung entstehen. Beispiele für diese Verbindung wurden unter anderem in den Sessions zu »Environmental Peacebuilding« diskutiert.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit technokratischen und neoliberalen Ansätzen zur Bekämpfung von Umweltproblemen und des Klimawandels wurden auf der Konferenz auch alternative Strategien für eine gerechtere Transformation erörtert. Dies galt insbesondere für die Forderung nach einer umfassenden Einbeziehung nicht-menschlicher Akteure und planetarer Kräfte in Gerechtigkeitskonzepte und Rechtsrahmen, etwa in Form des Ansatzes einer »planetaren Gerechtigkeit« (»planetary justice«) oder der Institutionalisierung eines »Erdsystemrechts« (»earth system law«). Postkoloniale Perspektiven spielten dabei eine zentrale Rolle: Viele Teilnehmer*innen plädierten für eine tiefgreifende Dekolonisierung der Umweltgerechtigkeit und betonten die Notwendigkeit einer größeren epistemischen und ontologischen Vielfalt in entsprechenden Studien und Klimaschutzmaßnahmen.
Besonders hervorzuheben ist der inter- und transdisziplinäre Ansatz der Konferenz, der mit kreativen und experimentellen Formaten (wie aktivistischen Interventionen, Filmdokumentationen und künstlerischen Performances) eine große Vielfalt an Perspektiven einzubinden ermöglichte. Dies regte dazu an, komplexe Fragestellungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Beispielsweise zeigte der Workshop von Rebecca Bratspies (CUNY School of Law in New York) und Charlie LaGreca Velasco (Joe Kubert Art School), wie Kunst als Mittel zur Umweltbildung und -mobilisierung genutzt werden kann.
Umweltgerechtigkeit und Frieden
Die »EnJust«-Konferenz 2024 hat gezeigt, dass Umweltgerechtigkeit nicht nur eine Frage der Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit ist, sondern auch ein Schlüssel für Frieden und Konflikttransformationen. Die konzeptionelle und politische Verknüpfung von Umweltgerechtigkeit und Friedensforschung wurde auf verschiedenen Ebenen diskutiert und in Verbindung mit den derzeitigen ökologischen Herausforderungen gesetzt. Gleichzeitig fand ein intensiver Austausch über die Entwicklung innovativer Ansätze für gerechtere und friedlichere Zukünfte statt. Umweltkonflikte, wie sie durch den Klimawandel und extraktive Praktiken entstehen, können nur durch eine gerechte Verteilung von Ressourcen und eine umfassende Beteiligung der Betroffenen nachhaltig gelöst werden. Die Verbindung von lokalen und globalen Perspektiven sowie die Einbeziehung aktivistischer Bewegungen, die die Idee der Umweltgerechtigkeit überhaupt erst hervorgebracht haben, sind dabei von zentraler Bedeutung. Bestärkt durch die Diskussionen auf der Konferenz in Hamburg versteht sich das »EnJust«-Netzwerk auch weiterhin als eine Plattform, die den Dialog zwischen Wissenschaft, Aktivismus und Kunst fördert und die Stimmen derer stärkt, die von Umweltzerstörung, Extraktivismus und Kolonisierung betroffen sind.
Die nächste internationale »EnJust«-Konferenz wird voraussichtlich im Sommer 2026 stattfinden (mehr Informationen: enjust.net)
Kim Nierobisch und Benno Fladvad