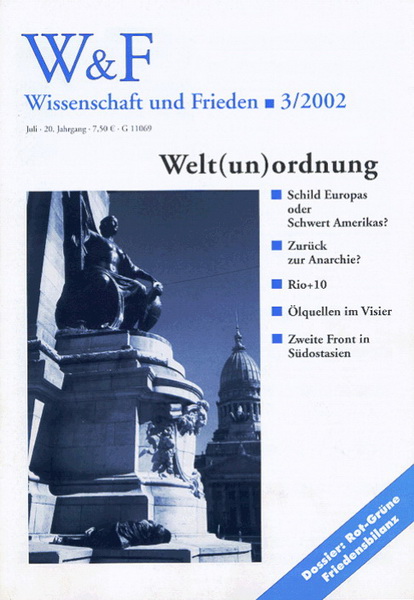Greenpeace und das neue Paradigma der Gewalt
von Wolfgang Lohbeck
Die Zeiten, als Greenpeace-Aktivisten gegen die französischen Atomtests im Pazifik kreuzten, als Greenpeace-Fahnen ein nicht weg zu denkendes Element jeder Friedensdemo waren, liegen ein paar Jahre zurück. Ändert sich das wieder? Wolfgang Lohbeck über die Diskussion bei Greenpeace nach dem 11. September und über Zusammenhänge zwischen Umwelt- und Friedensbewegung.
Die Feststellung, die Welt habe sich seit dem 11.9. verändert, gehört inzwischen zum Repertoire der Gemeinplätze. Doch was hat sich verändert? Auch vor dem 11.9. war unsere Welt dominiert vom Gewaltprinzip, galt durchweg das Recht des Stärkeren, auch vor diesem Datum waren – ob im Wirtschaftsleben oder im Kino – die Vorbilder diejenigen, die sich ihr »Recht« nahmen und die nicht lange fackelten. Aber eines war anders. Es gab eine Art allgemeine Übereinkunft darüber, dass es des Dialogs bedarf, um die jeweiligen Vorstellungen von dem, was »das Recht« ist, gegeneinander abzuwägen und dass es nicht angeht, dass sich jeder sein vermeintliches Recht nach Gutdünken nimmt.
Dieser Grundkonsens wurde offensichtlich erschüttert. Krieg ist für viele wieder ein legitimes, ja normales Mittel der Politik geworden. Die in Ansätzen vorhandene Kultur der politischen Konfliktlösung wurde zerstört, der »Kampf gegen den Terror« zum Vorwand für strategische Machtpolitik. Vor dem Hintergrund der erneuten Einteilung der Welt in Gut und Böse vollzieht sich ein Wertewandel, Gewalt und Rücksichtslosigkeit gewinnen an Dominanz, ein Rückfall in – fast möchte man sagen, barbarische – Ideologien und Verhaltensweisen vormittelalterlicher Prägung.
Dass die verbliebene Supermacht schon früher wenig Interesse und noch weniger Verständnis für die Ansichten Anderer hatte, ist bekannt. Inzwischen werden fast nach Belieben internationale Verträge und Absprachen, ob ABM-Vertrag oder Klimaabkommen, ohne Argumente, nur aufgrund der eigenen Stärke, aufgekündigt oder ignoriert. Ein Verhalten, das früher eher dem eines »Schurkenstaates« würdig war.
Entscheidungsträger hierzulande versuchen die »militärischen Maßnahmen« (das Wort Krieg wird vermieden) zu rechtfertigen: Man müsse dabei sein, um Mitsprache zu haben. Führende Vertreter der Partei, die aus der Friedens- und Umweltbewegung hervorgegangen ist und nun Regierungsverantwortung trägt, verunglimpfen Friedensengagierte und Pazifisten als realitätsblinde Gesinnungstäter (Staatssekretär Vollmer in der FR vom 07.01.02).
Es ist kein Zufall, dass sowohl Greenpeace wie auch die Friedensbewegung in der Vergangenheit nicht allein für den Frieden respektive den Umweltschutz aktiv waren. Die »Umwelt-Organisation« Greenpeace hat nicht umsonst »peace« im Namen, und die Friedensbewegung fühlte sich immer auch der Ökologie verpflichtet. Es ist schwer vorstellbar, für den Frieden aktiv zu sein, aber gleichgültig gegenüber der Umwelt, und das gilt auch umgekehrt.
Mit dem »peace« im Greenpeace- Namen verbinden sich denn auch zahlreiche der bedeutendsten und inspirierendsten Aktionen der Greenpeace-Geschichte. Zum Beispiel der Flug des Heißluftballons Trinity in west- östlicher Richtung über die Mauer und der damit verbundene Protest gegen die Rüstungsspirale, der Marsch von Greenpeace-Aktivisten durch das amerikanische Atomtestgelände in Nevada, die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die französischen Atomtests im Pazifik, die Evakuierung von Strahlenopfern von der durch US- Nukleartests verseuchten Pazifik-Insel Quajalein nach Rongelap.
In den letzten Jahren hat sich der Schwerpunkt der Arbeit aber verschoben, weg vom »peace« zugunsten des »green«. Friedensarbeit, Aktivitäten gegen Rüstung und Waffensysteme (Landminen) oder Nuklearpolitik sind etwas in den Hintergrund getreten. Die Gründe sind weder strategischer noch ideologischer Natur. Aber auch bei Greenpeace gibt es so einfache Geschehnisse wie den Weggang wichtiger Mitarbeiter und den damit verbundenen Verlust kollektiven Gedächtnisses. Hinzu kam die immer drängender werdende akute und unabweisbare Brisanz anderer, vorwiegend Verbraucher orientierter Themen, etwa das Vordringen der Gentechnik in den Bereich von Landwirtschaft und Lebensmittel, oder die Chance, mit beispielhaften technischen Lösungen, wie dem »Greenfreeze«, dem ersten FCKW/ FKW- freien Kühlschrank der Welt, der (technischen) Entwicklung eine andere Richtung zu geben. Greenpeace hat versucht, diese Chancen aufzugreifen und hat auf neue thematische Herausforderungen wie die Gentechnik oder das drohende Verschwinden der großen Urwälder reagiert – und dabei zeitweise die Entwicklung der Gesellschaft zu immer höherer Gewaltbereitschaft und zur Militarisierung der Politik aus dem Auge verloren.
Mit der Opposition gegen Rüstung und Krieg verbindet sich aber ein wesentlicher, unverzichtbarer Anteil der Greenpeace-Identität. Greenpeace stand und steht nicht nur für einen anderen Umgang mit der Natur, sondern für eine andere, nicht auf Gewalt gründende Form des Umgangs mit uns selbst. Das von Greenpeace für das eigene Selbstverständnis ehern verteidigte Prinzip der Gewaltfreiheit hat eine viel umfassendere Bedeutung als den Verzicht auf Gewalt im eigenen Handeln. Gewaltfreiheit bedeutet für Greenpeace nicht mehr und nicht weniger als die Einsicht in die (Überlebens-) Notwendigkeit einer Kultur des Dialogs. Wo versucht wird, Konflikte nicht mit Dialog, sondern mit Gewalt zu lösen, wo das Recht des Stärkeren gilt und wo Ideologien der Gewaltverherrlichung das Handeln beherrschen, da hat auch die Umwelt keine Chance; da wird Umweltschutz zum Reparaturbetrieb und damit letztlich zum Verlierer. (Dass auch der Dialog eine Grenze hat, da wo Verbrechen – ob terroristische oder Umweltverbrechen – geahndet werden müssen, steht auf einem anderen Blatt).
Zu den Kriegsfolgen gehören immer auch schwere Umweltschäden. Doch die Natur ist, auch ohne Krieg, wehrlos den Übergriffen der menschlichen Zivilisation ausgeliefert. Wenn da das »Recht des Stärkeren« stillschweigend geduldet oder offen zum Prinzip erhoben wird, kann es keinen Respekt vor dem Leben geben. Wenn Umweltschutzarbeit in einer Gesellschaft, die von struktureller Gewalt geprägt ist – ob in Form grenzenloser Wirtschaftsmacht oder in Form der Akzeptanz des Krieges –, nicht schnöde Reparaturarbeit sein soll, muss die Gewalt als allgegenwärtiges Phänomen thematisiert werden. In einer Gewalt-Gesellschaft ist Umweltschutz zwangsläufig politisch.
Wer glaubt, Greenpeace habe sich in seinen Anfängen doch auch nur um den Schutz der Wale gekümmert, irrt. Es ging auch um die Wale, aber nur »auch«. Viel mehr als um die Wale ging es um den Kampf gegen die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur, um den fehlenden Respekt vor dem Leben, letztlich um den Kampf gegen Gewalt. Das war Greenpeace und das ist es im Kern heute noch. Deshalb wird der Frieden, der Dialog als Möglichkeit zur Konfliktlösung und zur Prävention von Gewalt und Krieg, Greenpeace nie gleichgültig sein.
Spannen wir den Bogen vom »Terror« zum Umweltschutz. Terrorismus, die Gewalt der »Anderen«, ist heute in der Diktion der Herrschenden das Synonym für Gewalt schlechthin. Für sie ist derjenige, der physische Gewalt ausübt, der »Böse« schlechthin. Sie verschweigen, dass diese Form der Gewalt nur eine ist, die sichtbarste zwar, aber nicht einmal die bedrohlichste.
Sie wollen nicht sehen –oder nicht zugeben-, dass physische Gewalt auch Reaktion auf subtilere, umfassendere Formen von Gewalt, auch Antwort auf strukturelle Gewalt, sein kann. Sie wollen nicht sehen, dass oft erst durch die »Gewalt von Oben«, durch die Ausübung von Macht, der Boden bereitet wird, auf dem Terrororganisationen ihre Kämpfer rekrutieren. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus betreiben sie brutalste Interessenpolitik. (Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es ist keine Frage, dass Terrorismus geahndet werden muss, die Grenzen des Dialogs sind da, wo Verbrechen begangen werden. Das ist kein Widerspruch zum Prinzip der Gewaltfreiheit, aber Terroristen gehören in die »Obhut« der Strafverfolgung – wie Umweltverbrecher übrigens auch).
Es sind die gleichen Politiker, die im Militär das Allheilmittel im Kampf gegen den Terrorismus sehen, und tatenlos bleiben bei der Vergiftung der Welt mit Milliarden Tonnen Kohlendioxyd und der Verseuchung von Nahrungsmitteln durch Chemiegifte, sie werten die Interessen der Industrie höher als die Gesundheit der Menschen. Wer Umweltschutz nicht als Reparaturbetrieb, sondern als eine grundsätzlich andere Einstellung zur Natur und zum Leben sieht, kann nicht die Wurzel der Umweltzerstörung, die Bereitschaft zur Gewalt, ignorieren.
Greenpeace kann es also nicht gleichgültig sein, wenn sich schleichend, aber unaufhörlich, die Akzeptanz aller erdenklichen Formen von Gewalt erhöht. Zu einem sinnvollen Umweltschutz gehört, dass Greenpeace sich auch des Friedensthemas wieder stärker annimmt. Das kann auf sehr verschiedene Weise geschehen.
Dazu gehört zunächst der Versuch einer aufrichtigen Diskussion. Und was den »Kampf gegen den Terror« angeht, so bedarf es, wie Jochen Hippler in der FR schrieb, schon fast „übermenschlicher Anstrengungen zur Blauäugigkeit“, um diesen unter Verweis auf zweifellos vorhandenen »Kollateralnutzen« schönzureden. Ein konkreterer Schritt wäre die Einführung eines obligatorischen Friedens- und Mediationsdienstes, der sich aus der Überzeugung speist, dass Friedenssicherung nicht nur auf Rüstung und Waffen beruht. Die kritische Auseinandersetzung mit der Berichterstattung in den Medien und ihre Überprüfung auf Plausibilität und Wahrheit („Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst“) ist dringend angesagt, genauso wie das Ringen um mehr Transparenz bei Waffenproduktion und -export.
An vorderer Stelle steht auch das Bemühen um die Bewahrung demokratischer Errungenschaften und Konventionen. In diesem Zusammenhang wäre sicher ein kleiner, aber bedeutsamer Schritt die Aufhebung des Fraktionszwanges bei Abstimmungen über Krieg und Frieden und den Einsatz der Bundeswehr. Hier darf es nicht um die Demonstration politischer Stärke oder um »Geschlossenheit« gehen, hier muss das Grundgesetz gelten, nachdem jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verantwortlich ist.
Frieden und Umweltschutz sind nicht voneinander zu trennen, keines von beiden kann für sich allein errungen werden. Wer Frieden will, dem kann der Zustand der Umwelt nicht egal sein und umgekehrt: Wer die Umwelt retten will, kann dies nur, wenn er gleichzeitig versucht, die Spirale der Gewalt zu stoppen.
Wolfgang Lohbeck ist bei Greenpeace Deutschland verantwortlich für »Sonderprojekte«