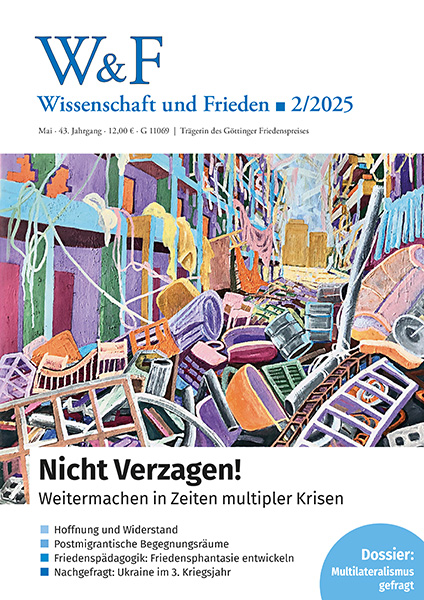Hoffnung und Widerstand
von Werner Wintersteiner
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Hölderlin
Wenn es Mitternacht wird …
»Wenn es Mitternacht wird im Jahrhundert« war der Titel eines Romans des Freigeists, Revolutionärs und sowjetischen Dissidenten Victor Serge, den er 1939, in einem der düstersten Momente des Jahrhunderts, verfasst hat. Der Roman, der die Exzesse des Stalinismus zum Gegenstand hat, erschien zum Zeitpunkt des Hitler-Stalin-Pakts, als der von den Nazis ausgelöste Weltkrieg bereits unmittelbar bevorstand.
»Wenn es Mitternacht wird im Jahrhundert« ist auch der Titel eines aktuellen Essays von Edgar Morin, in dem er Bilanz zieht über die heutige Zeit. Die Wahl des gleichen Titels ist nicht bloß eine Referenz an den Autor, sie ist vor allem ein Hinweis auf die Grundüberzeugung, die Morins ganzen Text durchzieht: Die heutige Situation ist nicht so aussichtslos, wie es scheint. Die Überwindung des Stalinismus und der historische Sieg über den als allmächtig geltenden Faschismus/Nationalsozialismus, an dem Morin als Kämpfer der résistance seinen Anteil hatte – errungen von denen, die nicht aufgegeben haben – sind für ihn Beispiel und Beleg für seine Schlussfolgerung: Es zahlt sich auch heute unbedingt aus, aufzustehen und Widerstand zu leisten.
Diese trotzige Zuversicht (sie trotzt allem Anschein, sie trotzt der Masse der Verzagten und sie trotzt den Gegner*innen) ist selbst eine der wesentlichsten Voraussetzungen für einen möglichen Erfolg. Denn, wie Morin fortfährt: „Die Bastionen des Widerstands befinden sich in den Köpfen der Menschen. Der erste und grundlegende Widerstand ist der Widerstand des Geistes.“ (Morin 2024)
Um diesen Widerstand zu mobilisieren, brauchen wir zweierlei: sowohl kaltblütige Analyse wie zugleich leidenschaftliches Handeln – und dazu noch einen Schuss Utopie. Viele sehen nur einzelne Aspekte, oder wollen nicht mehr sehen. Wir können aber auf den globalen Blick nicht verzichten. Wir dürfen uns nicht einspinnen in unsere eigene Situation in Europa, die uns am schlimmsten erscheint, obwohl sie es objektiv nicht ist. Wir sollten vielmehr erkennen, dass unser Pessimismus aus einem gerüttelt Maß eurozentrischer Wehleidigkeit besteht. Wann werden wir von der Resilienz derer lernen, die das, was wir ein normales Leben nennen, gar nicht kennen, und die dennoch nie aufgegeben haben? So hat etwa der Radiomacher Pascal Muhindo Mapenzi aus dem kriegsgebeutelten Kongo bereits die Verunsicherung von uns Europäer*innen durch die Covid-Pandemie ebenso nüchtern wie sarkastisch kommentiert: „Es muss schlimm sein für sie. Sie sind ja nicht gewohnt, dass ihr Leben bedroht ist.“ (Raupp 2020)
Als Partei des Friedens, die sich sowohl Kriegstreibern wie Rüstungsfanatikern entgegenstemmt, haben wir durchaus ein Potential, relevante Teile der Bevölkerung zu erreichen. Das werden wir aber verspielen, wenn wir die Mär von der Ausweglosigkeit nachbeten, aus der uns nur Aufrüstung und Kriegsbereitschaft herausführen könnten. Man könnte direkt eine Gleichung aufstellen: Pessimismus = Hang zu schnellen Gewaltlösungen, Optimismus = Bereitschaft zu Friedenslösungen, die langsamer wirken als Gewalt.
Das „Evangelium des Untergangs“
Aber sind diese Überlegungen nicht blauäugiger Optimismus? Zweifelsohne gibt es diese Blauäugigkeit, d.h. einen Voluntarismus, der nicht bereit ist, sich der Realität zu stellen. Daraus kann aber keine Hoffnung erwachsen, sondern bloßer Illusionismus. Edgar Morin hingegen drängt uns dazu, genau hinzuschauen. Kaltblütig stellt er fest: „Wir gehen wahrscheinlichen Katastrophen entgegen.“ (Morin 2024) Und er stellt die Frage, ob diese Feststellung ein Katastrophismus ist, also eine panikartige Übertreibung der Realität. Nein, gibt er sich selbst die Antwort, das zu behaupten, hieße das Übel exorzieren zu wollen und sich in einer illusorischen Sicherheit zu wiegen. In Wahrheit, so Morin, ist die Krise viel schlimmer, als wir wahrnehmen, wenn wir uns nur auf die aktuellen Kriege in der Ukraine und in Palästina, auf die tollwütige Politik von Donald Trump und auf die Klimakatastrophe fokussieren. Die Polykrise, so Morin, ist eine anthropologische Krise – eine Krise der Menschheit, die es nicht schafft, ihre volle Menschlichkeit zu entfalten. Damit macht er uns erst recht bewusst, wie groß die Herausforderung ist. Was uns helfen könnte, sie zu bewältigen, nennt er das „Evangelium des Untergangs“. Damit meint er: Alle klassischen Vertröstungen wie Heilsreligionen, große Ideologien, die von der zwingenden Notwendigkeit des historischen Fortschritts ausgehen, sind ebenso widerlegt wie der menschliche Wahn, der an die Beherrschung der Natur glaubt. Wir stehen somit vor der Erkenntnis, dass es auf uns selbst ankommt – bei Strafe des Untergangs. Diese Erkenntnis, so die Hoffnung, könnte ungeahnte Kräfte mobilisieren.
Für Hoffnung gibt es natürlich niemals eine Garantie. Für sie gilt, was Kafka über den Fortschritt gesagt hat – er glaube an den Fortschritt, aber er glaube nicht, dass dieser schon eingetreten sei. Sonst wäre es ja kein Glaube. Das Prinzip Hoffnung ist also immer auf die Zukunft gerichtet, und damit auf eine Ungewissheit. Doch die Pessimist*innen irren sich, wenn sie meinen, daraus ein Argument gegen die Hoffnung machen zu können. Denn ihr »negativer Zukunftsglaube« ist ebenso ungewiss. Die einzig sichere, empirisch belegte Aussage, die man bezüglich der Zukunft treffen kann, lautet: Es wird etwas Unerwartetes geschehen. In den Worten Morins: „Auch die Tunnel haben ein Ende, das Wahrscheinliche ist nicht das Sichere, und das Unerwartete ist immer möglich.“ (ebd.)
In dieser Erkenntnis liegt die Hoffnung, es könnten sich neue, bislang noch nicht gedachte Möglichkeiten auftun. Freilich kann manches auch unerwartet schlimmer werden. Gerade deshalb brauchen wir einen „strategischen Optimismus“ (Herbert Kelman).
Strategischer Optimismus
Der Begriff » strategischer Optimismus« geht auf Herbert Kelman zurück, der – als Kind von den Nazis aus Wien vertrieben – in den USA zu einem der Begründer der modernen Friedensforschung wurde. Verschmitzt meinte er, wenn er sich allzu optimistisch gebe, würden ihn seine akademischen Kollegen nicht ernst nehmen, da Pessimismus für sie Ausweis einer kritischen Haltung sei. Als »strategischem Optimisten« werde ihm hingegen auch eine kritische Grundeinstellung zugebilligt.
Aber diese Anekdote soll den eigentlichen Kern des Gedankens nicht verdecken. Strategischer Optimismus ist eine ernsthafte Strategie. Sie versucht die Realität, wie schlimm sie auch sei, anzuerkennen, sich davon aber nicht in die Verzweiflung treiben zu lassen, sondern unablässig nach Auswegen zu suchen. Es handelt sich in der Tat um „eine Strategie, die darauf abzielt, alle denkbaren Friedensmöglichkeiten ausfindig zu machen und aktiv zu verfolgen, was dazu beitragen kann, dem allgegenwärtigen Pessimismus, der in tief verwurzelten Konflikten vorherrscht, und den negativen selbsterfüllenden Prophezeiungen, die er hervorruft, entgegenzuwirken“ (Kelman 2010, 384).
Im Sinne der Methodik des strategischen Optimismus müssen wir, so meine ich, auch die heutige Situation befragen: Was lehrt sie uns, was wir bisher nicht wussten? Welche Grundüberzeugungen stellt sie in Frage, die wir neu überprüfen müssen? Welche Friedensstrategien haben wir vernachlässigt, welche neuen Strategien müssen wir erfinden?
Der Möglichkeitssinn
Aber warum eigentlich überhaupt so viele Argumente für den Optimismus anführen? Wer das Geschäft des Friedens betreibt, ist ohnehin Utopist*in. Die ebenso großartige wie säkulare Aufgabe der Abschaffung des Krieges und der qualitativen Reduktion der gesellschaftlichen Gewalt kann nicht ohne die Hoffnung, die aus utopischem Denken erwächst, angegangen werden. Insofern sind wir alle abhängig von dem Regen, „der aus den Wolken von lebendigen Utopien” kommt (Eppler 1981). Anders gesagt: Wir brauchen neben dem »Wirklichkeitssinn« auch etwas, das man mit Robert Musil »Möglichkeitssinn« nennen kann. So „ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. […] Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven.“ (Musil 1970) Doch ohne diese Freiheit, diese relative Unabhängigkeit vom Wirklichkeitssinn geht es nicht – gerade nicht in Zeiten von Umbrüchen, Krisen und Katastrophen.
Und es ist auch bemerkenswert, dass gerade Menschen, die selbst Krieg und Verfolgung erlebt haben, oft die stärksten Hoffnungskräfte zu mobilisieren vermochten, wie etwa Simone Weil oder Viktor Frankl. Robert Jungk, der von den Nationalsozialisten ins Exil getrieben wurde, hat mit der Etablierung der Zukunftsforschung die Hoffnungssuche sozusagen systematisiert. „Wie denn ohne Hoffnung? Ohne Atem kein Leben, ohne Licht kein Tag, ohne Erwartung kein Handeln. Wer das Wunder sucht, wird es nicht auf den alten, ausgetretenen Pfaden finden. Wer Rettung herbeisehnt, kann sie nicht bei denen finden, die aus träger Gewohnheit auf sinkenden Schiffen verharren“ (Jungk 1992, 17). So ein sinkendes Schiff ist, so meine ich, der gegenwärtig grassierende, uralte Rüstungswahn, der verhindert, dass wir kreative Friedenslösungen entwickeln.
Próxima Estación: Esperanza
Nicht zufällig ist das zweite Album des kosmopolitischen Sängers Manu Chao nach einer Haltestelle der Madrider Metro Linie 4 benannt. Im Titelsong wird die U-Bahn Ansage wiedergegeben, die sich im Kontext des sozialkritischen Liedes aus einer simplen Ortsangabe in einen Aufruf zum mutigen Agieren verwandelt: „Próxima Estación: Esperanza“ (nächster Halt: Hoffnung). Das sollte auch unser Motto sein. Denn die Hoffnung kann nur aus dem Widerstand gegen die untragbaren Zustände kommen, wie auch der Widerstand nur aus der Hoffnung kommen kann.
Literatur
Eppler, E. (1981): Wege aus der Gefahr. Reinbek: Rowohlt.
Jungk, R. (1992): …Damit wir nicht untergehen…. Linz: edition sandkorn.
Kelman, H. C. (2010): Looking back at my work on conflict resolution in the Middle East. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 16 (4), S. 361-387.
Morin, E. (2024): S’il est minuit dans le siècle. La première et fondamentale résistance est celle de l’esprit. La Tour-d‘Aigues: Éditions de l’Aube.
Musil, R. (1970): Der Mann ohne Eigenschaften. Hamburg: Rowohlt.
Raupp, J. (2020): Coronavirus löst im Kongo Angst vor Hungerrevolten aus. Der Standard, 19.5.2020, S. 7.
Univ.-Prof. i.R. Dr. Werner Wintersteiner ist Gründer und ehemaliger Leiter des Zentrums für Friedensforschung und Friedensbildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Österreich). Seine jüngste Veröffentlichung: Werner Wintersteiner (Hrsg.) (2025): „Mehr Sicherheit ohne Waffen“. Zur Aktualität von Hans Thirrings Friedensplan. Wien: Promedia. Kontakt: werner.wintersteiner@aau.at / wernerwintersteiner.at