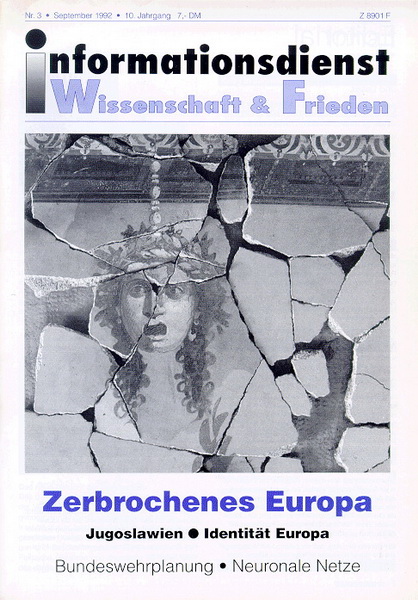Jugoslawien zum Beispiel
Die Friedensbewegung am Ende – Eine Nestbeschmutzung
von Werner Wintersteiner
„Warnung: Die Lektüre dieses Artikels kann ihr Wohlbefinden gefährden. Er ist absolut einseitig, ungerecht und polemisch.“ (Der Autor) Dieser Aussage schließt sich die Redakteurin an. Aber trotzdem oder gerade deshalb ist der Artikel hier zu lesen. Reaktionen von Leserinnen und Lesern sind willkommen.
In alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, pflegten wir das, was einfach geschah, als Fortschritt der Menschheit zu bezeichnen. Und wir, wir waren auch noch wer. Wir wußten, daß der Fortschritt auf unserer Seite ist, und sonnten uns in dem guten Gefühl, den Wind der Geschichte im Rücken zu haben. Der einzelne ist fehlbar, die GROSSE IDEE nicht. In Momenten der Bescheidenheit dachten wir demütig: Wie traurig, daß die GROSSE IDEE in uns nur so unvollkommene Verteidiger findet. Sonst hätte sie sich schon längst um die ganze Welt verbreitet, wo sie doch so klar und richtig ist, und DER FRIEDEN wäre eingekehrt. Aber sonst war die Lage ausgezeichnet, einfach deshalb, weil sie so beschissen war. Möge die Welt untergehen, so bleibt uns doch das Bewußtsein, daß wir ihren Untergang rechtzeitig vorhergesagt haben. Und wir haben uns ihm auch heldenhaft widersetzt. Die anderen gehen in Schmach unter, wir aber mit fliegenden Fahnen. Uns trifft keine SCHULD. Die Welt: Sie bestand aus Guten und Bösen. Auf diese einfache Formel ließ sich unser ach so komplexes Weltbild reduzieren: Die Feinde des Friedens und die Freunde des Friedens. Natürlich gab es – Augenaufschlag: leider! – auch in unseren Reihen faux amis, welche uns eine Supermacht als Verbündete einreden wollten, die Sowjetunion. Mit der simplen Argumentation, daß diese schwächer sei, daher die Rüstungsspirale nur nachziehe und eigentlich den Frieden brauche, ergo an ihm interessiert sei, um ihre schwache Ökonomie nicht noch mehr zu belasten. Nein, so naiv und einäugig wie diese Leute waren wir natürlich nicht, wir waren sozusagen die richtige Friedensbewegung. Wir sind von Anfang an gegen die beiden Supermächte aufgetreten, haben uns dem Blockdenken widersetzt, Ost und West verändern wollen, das geteilte Europa überwinden, die Atomkriegsgefahr bannen und dergleichen Heldentaten mehr.
Jetzt ist das geteilte Europa überwunden, jedenfalls mehr, als wir es uns je träumen haben lassen, die Atomkriegsgefahr ist gebannt, jedenfalls die Gefahr, die wir uns vorgestellt haben, wir haben gegen die faux amis recht behalten – warum sind wir dann so traurig?
Sozialismus als Mythos
Vielleicht wollten wir die Veränderung, die wir so lautstark propagiert haben, im Grunde unseres Herzens doch nicht. Vielleicht sind wir selber mehr mit dem alten System verhaftet, als wir es wahrhaben wollen. Wir haben den Sozialismus inhaliert, tiefer, als wir es gemerkt haben. Nicht aus Sympathie für den Stalinismus oder aus Blindheit für die Unfähigkeit des Systems, sondern weil wir für uns einen Mythos brauchten. Zur Rettung dieses letzten Mythos der Moderne, des Sozialismus, übernahmen wir heroische intellektuelle und moralische Anstrengungen, von denen wir bis heute gezeichnet sind. Natürlich, das muß man zu unserer Ehre sagen, haben wir nicht den häßlichen realen, sondern den schönen idealen in unseren Herzen getragen. Das war unsere HEIMAT. Der Sozialismus gab uns die Idee, daß die Geschichte einen Sinn und ein Ziel hat. Und damit die Vorstellung, daß UNSERE ARBEIT sinnhaft und zielführend ist. Denn wir waren die Sinnträger der Geschichte und hatten als solche automatisch, unschuldig sozusagen, mehr recht als alle anderen Menschen. Wir waren die unerbittlichen Rächer der Enterbten wir Robin Hood, unverletztlich wie die Hüter des Heiligen Gral und Auserwählte wie die Zeugen Jehovas. Wenn es aber diesen Sinn nicht gibt, wenn der Fortschritt nicht der Wind der Geschichte in unserem Rücken ist, sondern – mit Walter Benjamin – ein Sturm, der uns verkehrt in eine ungewisse Zukunft bläst, dann sind auch wir Friedensbewegte bloß eine Partei unter anderen Parteien. Unsere Anliegen mögen ehrenhaft sein, »richtiger« und automatisch durchsetzbarer als die Ziele unserer Gegner sind sie nicht mehr. Wo sollen wir künftig unsere Kraft hernehmen, wenn man uns unsere Allmachtsphantasien weggenommen hat?
Wir haben uns an die Blockkonfrontation mehr gewöhnt, als uns bewußt war. Innerhalb der Starre der Verhältnisse waren wir scheinbar die einzigen, die auf Veränderung drängten, die beweglich waren. Jetzt haben wir unser Beweglichkeits-Monopol verloren – schlimmer noch, die anderen, die etablierten Politiker haben uns – nach dem Ende des Patts der Ost-West-Konfrontation – mit ihrer neu gewonnenen politischen Mobilität längst überholt. Wir hatten Visionen, sie hatten keine. Jetzt haben sie welche, und wir keine. Sie reden jetzt von der »neuen Weltordnung« (natürlich wissen wir alle, was sie darunter verstehen), statt daß wir diesen Begriff besetzt hätten und unsere diesbezüglichen Utopien entwickelten.
Wir waren die, die immer laut NEIN gerufen haben. So waren wir wichtig. Was sollen wir jetzt tun, da unser NEIN sinnlos geworden ist? Wir waren die moralische Instanz, das Gewissen. Etwas anderes haben wir nicht gelernt. Was sollen wir jetzt tun, wo es nicht um Moral, sondern um Machbarkeit geht, auch die Machbarkeit des Friedens? Jetzt braucht es Techniker des Frieden-Machens, nicht nur Moral-Apostel. Nicht Heilsbringer sind mehr gefragt, sondern Pragmatiker der Konfliktlösung. Und ironischerweise eignen sich viele ehemalige »Techniker« der Kriegs-Diplomatie, wenn sie richtig eingesetzt werden, besser dazu als die Idealisten des Friedens. Profi bleibt Profi. Das tut weh. Oder eigentlich: Das sollte doch weh tun, so weh, daß wir über unsere Schwächen nachzudenken beginnen.
Retardierendes Moment: Der Golfkrieg. Wir konnten noch einmal mit gutem Gewissen gegen die USA (»Hauptfeind der Menschheit«) losziehen: Kein Blut für Öl. Wir konnten uns noch einmal in voller, wenn auch nicht alter, Größe emporrichten, den Kriegstreibern unser NEIN entgegenschleudern, »machtvolle Demonstrationen« abhalten; wir fanden Unmengen von Anschauungsmaterial für die beliebte Idee von der Manipulation durch die Medien, und mit dem Zorn des Gerechten haben wir die Quertreiber in den eigenen Reihen, die am Krieg etwas Gutes fanden, als Häretiker gebannt. Doch halt – wie war denn das mit Israel? Haben wir da nicht etwas übersehen? Haben wir nicht auch allzulange unkritisch die arabische Zionismus-Kritik übernommen? Und sind dann selber über die Raketen auf Tel Aviv erschrocken, mit denen Saddam Hussein die Verbindung zwischen seiner Kuweit-Aggression und dem »palästinensischen Befreiungskampf« herstellen wollte? Spät, aber doch haben wir da gerade noch die Kurve gekratzt, nicht alle von uns, ehrlich gestanden.
Die Ohnmacht während des Golfkriegs
Auf jeden Fall hat der Golfkrieg sehr widersprüchliche Gefühle in uns wachgerufen. Wir haben uns gleichzeitig bestätigt und vollkommen isoliert gefühlt, wir haben gleichzeitig unsere Bedeutung und unsere vollkommene Ohnmacht gespürt. Vielleicht hätten wir uns dieser Ohnmacht mehr stellen sollen. Stattdessen haben wir sie »überspielt« durch die Verzweiflung über die »unsolidarische« Haltung der prominenten Friedensaktivisten und Intellektuellen, von denen wir es nicht erwartet hätten, daß sie den Golfkrieg befürworten. War das wirklich Ausdruck der steigenden Tendenz, den Krieg wieder als Mittel der Politik zu akzeptieren? Jedenfalls hatte die Macht des Faktischen wieder einmal über unseren berechtigten und doch etwas lächerlich wirkenden Protest gesiegt. Mit „Wetten, daß Goethe den Wahnsinn verböte“ war eben kein Frieden zu machen.
Und dann kam das Kriegsende und damit auch das Ende dieser Friedensbewegung. Die Leute hatten sich verlaufen, dabei ging's jetzt erst los: Zerfall und immer wieder aufflackernde Kämpfe in der Sowjetunion, Zerfall und Krieg in Jugoslawien, „demokratische Unterdrückung“ der antidemokratischen Bewegung in Algerien usw.. Im Gegensatz zu den »seligen Zeiten des Kalten Krieges« gab es nicht mehr die Kriegsgefahr, sondern die Gefahr von Kriegen. Es gab nicht bloß die Gefahr von Kriegen, sondern gefährliche Kriege, an vielen Orten gleichzeitig, sinnlos, atavistisch und sogar in Europa. Gegen wen sich wenden? Und gegen wen zuerst? Wo bleibt die EINE FRAGE, das Hauptkettenglied, das man anpacken muß, damit alles ins richtige Lot kommt? Längst ist dem ARMEN VOLK (per definitionem unwissend und aufzuklärend), das sich immer nur auf eine Frage konzentrieren kann, der Überblick verloren gegangen. Aber auch wir, die – Möchtegern- Avantgarde – sind überfordert.
In dieser neuen Situation bleiben uns ein paar Optionen: Am besten, wir vergessen möglichst schnell diesen Lebensabschnitt, verwenden unser Wissen um die Bedrohtheit der Welt, um uns selber behaglich einzurichten für die letzten Tage. So beweisen wir wenigstens, daß wir uns ein gewisses Maß an Genußfähigkeit bewahrt haben. Wenn wir aber lieber beweisen wollen, daß wir zum HARTEN KERN gehören, dann wenden wir uns rastlos einer neuen Frage zu. Egal welcher. Das erspart uns das Nachdenken. Auf jeden Fall richten wir uns alle Fragen so zurecht, daß unser altes Weltbild noch halbwegs ungeschoren davonkommt. Ein Musterbeispiel dafür ist die Haltung der Friedensbewegung zu Jugoslawien.
Jugoslawien
„Friedensbewegung – Die Versager“ wirft uns die Presse unsere „peinlich passive Haltung zum Krieg in Jugoslawien“ vor, mit der wir, „die traditionellen Friedensapostel“ uns „praktisch selbst disqualifizieren“ 1. Die Friedensbewegung bleibt „stumm“ (Hans Rauscher) usw.
Wo bleibt die …?, Warum tut die … nichts? Die … hat versagt! Natürlich geht uns diese Feuerwehr-Rolle schon lange auf die Nerven. Kein Mensch schert sich normalerweise um die Friedensbewegung, man wird belächelt und verspottet, von den Medien bestenfalls denunziert, schlimmer: meist überhaupt ignoriert. Wenn dann wieder ein Krieg »ausbricht«, wie es so schön heißt, kommen die obigen Vorwürfe, hämisch – um zu beweisen, daß die Friedensbewegung ohnehin sinnlos ist, oder einäugig oder was man ihr sonst vorwerfen will. Die Frage, was mit der Friedensbewegung los ist, stellen aber auch ernsthaft besorgte Leute, die gerne ihre Verantwortung delegieren, und für die die Friedensbewegung in Kriegszeiten das personifizierte eigene schlechte Gewissen darstellt. Diese Leute sind zu bequem, selbst der freiwilligen Feuerwehr beizutreten und schieben alles auf eine Berufsfeuerwehr, die aber bitte nicht aus Steuergeldern finanziert werden darf! Sollen sie selber schauen, wo sie ihre Ausrüstung hernehmen, aber wehe, sie versagen im Brandfalle. Selber schuld, warum wollen sie auch Feuerwehrleute sein!
Es ist zweifelsohne leicht, diese Haltung zurückzuweisen und gute Gründe anzuführen, daß wir eben (z.B. in der Jugoslawienkrise) nicht mehr zustandegebracht haben. Wir können auf unsere geringe Infrastruktur und die mangelnden materiellen Ressourcen hinweisen, darauf, daß wir ein kleines Häuflein Freiwilliger sind, die eben nicht mehr leisten können. Wir können auf einige GUTE TATEN, z. B. Beratung und Aufnahme von Deserteuren, Proteste gegen das neue Asylrecht, Friedenskonferenzen, Spendenaktionen hinweisen. Es leuchtet auch ein, daß es schwer ist, sinnvoll in gewohnter Weise – Demonstrationen usw. – zu reagieren, wenn es keinen klaren Gegner, sondern eine verwirrende Fülle von Widersprüchen, Szenarien und Gegnern gibt, wo wir zwar einige Hauptbanditen ausmachen können, aber kaum jemanden, der einen weißen Hut trägt. Das enthebt uns jeder SCHULD, nicht aber der intellektuellen Anstrengung, nachzudenken, warum das denn so ist und welche konkreten Ursachen für die erschreckende Passivität der Friedensbewegung in der Jugoslawienfrage bestehen.
Natürlich muß man jede Bewegung an ihren objektiven Möglichkeiten messen und kann nicht verlangen, daß eine Friedensbewegung einen Krieg verhindert. Was aber die Qualität der neuen sozialen Bewegungen ausmacht, ist ihre Funktion als Seismograph und Kassandra. Und gerade als »Frühwarnsystem« hat diesmal die Friedensbewegung versagt. Es war nicht so, daß – wie etwa beim 2. Golfkrieg oder den westlichen Waffengeschäften mit Saddam Hussein – bloß niemand auf unsere Kassandrarufe hören wollte, es hat einfach kaum welche gegeben. Darüber hinaus müssen wir zugeben, daß wir in wesentlichen politischen Fragen im Zusammenhang mit Jugoslawien hilflos sind, oder auch ganz geteilter Meinung, und daß uns der Ansatzpunkt für ein wirkliches »Eingreifen« eigentlich fehlt.
Tödliche Vorurteile
Wenn wir uns nicht darauf zurückziehen wollen, daß die objektiven Bedingungen schrecklich und zum Verzweifeln sind – was ja stimmt, aber nicht die ganze Wahrheit ist – dann bietet vielleicht unsere Hilflosigkeit in der Jugoslawienfrage einen Anlaß zu einem zweifachen grundsätzlichen Nachdenken: darüber, welchen Anteil wir selbst an unserem Versagen haben und außerdem darüber, wie unter den heutigen Bedingungen eine erfolgreiche Friedensbewegung aufgebaut und strukturiert sein müßte; einer Bewegung, der es mehr um den Frieden geht als „um die Verteidigung eines über die unerwarteten Fährnisse der Zeit möglichst unbeschädigt hinwegzurettenden Selbstbildes“ 2.
„Schuld ist der (deutsche) Imperialismus“
Wir sind es gewohnt, die Opfer (die Guten) und die Täter (die Bösen) genau zu unter-scheiden, um uns auf die Seite der Guten, der Opfer zu schlagen. Offenbar untersuchen wir aber dazu nicht die konkrete Situation, sondern entscheiden nach sehr allgemeinen Merkmalen: Täter sind immer große, imperialistische Staaten, Opfer sind kleine Staaten, vornehmlich der 3. Welt. Je größer die Großmacht, desto böser. Je kleiner das Opfer, desto vertrauenserweckender. (Daß wir damit auch in der Vergangenheit nicht immer ganz richtig lagen – Kambodscha zum Beispiel – haben wir längst vergessen.) Um den konkreten Bezug zum eigenen Land herzustellen, appellierten wir immer an unsere eigenen Machthaber, damit sie die Opfer, nicht die Täter unterstützen. Ein gesundes Mißtrauen gegen unsere Regierung, die Vermutung, daß sie eher auf Seiten der Täter steht, hat sich in der Vergangenheit ebenfalls bewährt.
In vielen Konflikten war es tatsächlich leicht möglich, einen »Hauptfeind« zu isolieren und nach bekanntem Muster die Komplicenschaft der eigenen Regierung zu entlarven. Vietnam, Nicaragua, auch der Golfkrieg scheinen noch im Kopf so mancher unserer Kommentatoren herumzuspuken, wenn sie ihre Jugoslawien- Kommentare schreiben. Heraus kommt dann ungefähr sowas: Der erste außenpolitische Erfolg – den Ausdruck »Sieg« mieden die Wohlerzogenen – des vereinigten Deutschland war die Aufspaltung Jugoslawiens.(…) Schließlich sind sie (die deutschen Politiker) ja Spezialisten für die Befriedung des Balkans, und das nicht erst seit Genscher & Mock.3
Die westdeutschen Imperialisten mit ihren österreichischen Handlangern haben also das arme Jugoslawien zerrissen, historische Anspielung: nicht zum ersten Mal. Das klingt sehr links und zeugt von einem kritischen Geist (das soll es ja wohl vor allem), aber es ist schlichtweg falsch und absurd. Ist es nicht typisch für uns, daß wir immer das Bedürfnis haben, uns abzugrenzen – von Großmächten, von (konservativen) Politikern? Nicht der Sache, sondern der Unterscheidung wegen, um unser Bild von uns selbst zu bewahren? Wenn wir uns aber so unbedingt in der Jugoslawienfrage abgrenzen wollen – warum tun wir es von Deutschland und nicht etwa von der noch viel größeren Großmacht USA – wie im Golfkrieg? Wenn wir schon so gerne Kapitalismus-Kritik leisten, wieso haben wir nie die mafiosen geschäftlichen Verbindungen von hohen amerikanischen Politikern (z.B. Präsident Bushs außenpolitischem Berater Lawrence Eagelburger) mit serbischen Firmen angeprangert, die wohl einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die fatale amerikanische Jugoslawienpolitik gehabt haben?4
„Die Serbenfeindlichkeit unserer Medien“
Unser zweites Liebkind ist die Kritik an unseren Medien und ihrer einseitigen Berichterstattung. Diese Kritik ist zweifelsohne wirklich nötig, und gerade gegenüber der Kronen-Zeitung mit ihrer „Jugo“-Hatz sind wir doch allemal im Recht, wenn wir die „Serbien-muß-sterbien“-Mentalität angreifen. Aber: Machen wir es uns nicht zu leicht? Natürlich muß eine Presse kritisiert werden, die antiserbisch und prokroatisch ist, präziser, eine Presse, die Serbien angreift, nicht weil Serbien Aggressor und Kroatien das Opfer ist, sondern weil Serbien Serbien ist, also böse – der direkte Rechtsnachfolger des Schimpfworts „Yugo“ – und weil Kroatien katholisch, konservativ, ex-habsburgisch – also gut ist. Natürlich müssen wir die unheilige Allianz bekämpfen, die Slawophilie und Deutschnationalismus hierzulande eingegangen sind. Aber bitte doch nicht so, daß wir zum Zeitpunkt, wo serbische Truppen gerade beginnen, Sarajewo zu beschießen, kein Wort der Kritik finden, aber stattdessen mit Tucholsky-Zitaten die historische Kontinuität von deutscher Serbienfeindlichkeit nachzuweisen versuchen.5
Wenn wir Serbien gegen seine falschen Gegner in Schutz nehmen und Kroatien vor seinen falschen Freunden bewahren, so dürfen doch wir nicht aufhören, die serbische Aggression (nicht die Serben schlechthin) zu verurteilen und die kroatischen (und bosnischen) Opfer (nicht die kroatische Regierung und den kroatischen Nationalismus) zu unterstützen. Derartig diffizile Unterscheidungen sind uns aber offenbar einfach zu anstrengend. Oder haben wir bloß Angst, nicht auf der »richtigen« Seite zu stehen und drehen einfach die Vorurteile des main-stream um, ohne zu bemerken, daß dabei nichts herauskommt als – neue Vorurteile?
„Schade um unser schönes Jugoslawien“
Nicht nur bei Peter Handke finden wir den Mythos eines nicht-entfremdeten, guten, weil selbstverwalteten Sozialismus, einer multikulturellen, weil nicht einheitlichen nationalen Gesellschaft. Aber Handke gibt wenigstens zu, daß er nicht von Politik spricht, wenn er seine jugoslawischen Träume spinnt.6 Was anderes ist es, wenn wir als Linke oder Friedensbewegung schematisch behaupten, jede Loslösung sei negativ, jedes Festhalten am Gesamtstaat hingegen positiv. Bei unserer Idealisierung Jugoslawiens haben wir nicht gemerkt, wie lange schon – etwa durch die Unterdrückung der Albaner im Kosovo – die multikulturellen Möglichkeiten verspielt worden sind, so verspielt, daß eine slowenische Friedensforscherin sogar meint: „Es ist kein großes Wunder, daß es jetzt zum Krieg gekommen ist, sondern es ist ein großes Wunder, daß der Friede über 40 Jahre aufrechtzuerhalten war.“ 7 Aber wir wissen schließlich alles besser, und wir wissen vor allem eines ganz genau: „Der Nationalstaat ist überholt“ – also was wollen sie denn? Die, die auf Teufel komm raus einen eigenen Staat anstreben, können nichts Gutes im Schilde führen. Daß sich die, die »übrig bleiben«, gegen die Abspaltung »wehren«, hat somit unsere Billigung oder Duldung. Zumindest solange es nicht zu »Gewaltexzessen« kommt. So kann man mit guten Vorsätzen auf den Lippen den Weg zur Hölle antreten. „Unter dem Vorwand das Erwachen des Nationalismus zu bekämpfen, haben wir es für gut befunden, Opfer und Aggressor auf dieselbe Stufe zu stellen. So haben wir den Aggressor ermutigt, der, weil er ungestraft bleibt, sich berechtigt glaubt, alles mit Waffen zu regeln und in jede Region, wo es ihm beliebt, Tod und Vernichtung hinzutragen.“ 8
Daß die nationale Aufspaltung des »Vielvölkerstaates« keineswegs nur nationale Ursachen hat, ist offenbar auch etwas, was uns entgangen ist. Wie überhaupt unser so prinzipienfester Anti-Nationalismus einmal hinterfragt gehört. Wir setzen jede nationale Bestrebung, aber auch jede im nationalen Gewand daherkommende demokratische Bestrebung mit Nationalismus gleich. Zugegeben, die Unterscheidung ist nicht immer leicht zu treffen, aber warum machen wir es uns so leicht? Natürlich erleben wir heute in Jugoslawien – wie auch anderswo – eine »künstliche« Nationalisierung, der wir hilflos gegenüberstehen. Ein Teil dieser Hilflosigkeit besteht schon in der Verwunderung über diese Künstlichkeit. Jede Konstitutierung einer Nation ist ein Postulat, eine Willensentscheidung, genauso wie die Entscheidung zum Vielvölkerstaat Jugoslawien in bewußter Absicht erfolgte und nicht »natürlich« war. Ob sie zu bejahen, zweckmäßig, von mir aus »fortschrittlich«, ist, läßt sich nur daran ermessen, ob sie mehr Demokratie, Wohlstand für ihre BürgerInnen erwarten läßt und daran, wie und durch wen sie überhaupt zustande kommt.
So gesehen sollten wir einmal die »nationalistische« Abspaltung Sloweniens, demokratisch erfolgt, die niemanden bedroht, die aber uns soviel Bauchweh macht, vergleichen mit der »internationalistischen« Haltung Serbiens, das in Kroatien wie in Bosnien einen nichterklärten Eroberungskrieg führt. Unserer „Ja, derfen's denn das“-Attitüde hat der slowenische Schriftsteller Drago Jancar berechtigterweise entgegengehalten: „Zuerst war die Begeisterung, dann war Verwunderung: Was machen die dort im Postkommunismus überhaupt? Nach der Verwunderung kam das Entsetzen: Jeden Augenblick schwappt es zu uns über. Und dann Wut: Die dort drüben und die dort unten. Sie wollen alles haben, was wir haben, Demokratie, materiellen Wohlstand, europäische Kultur, Nationalstaat.“ 9
„Tudjman=Milosevic“
Die faktische Gleichsetzung von Opfern und Tätern ist sicher unser schlimmster Fehler, und wir haben ihn wieder einmal mit besten Absichten begangen. Was liegt näher als der Vergleich und die Gleichsetzung zweier unsympathischer, undemokratischer, nationalistischer Führer der beiden Kriegsparteien? Es ist richtig, daß beide sich auf die Konfrontation und den Krieg eingestellt haben, es ist richtig, daß beide von der heiligen Nation und historischem Auftrag faseln, daß beide sehr unglaubwürdige Demokraten sind. Aber ebenso richtig ist, daß Tudjman und Milosevic unterschiedliche politische Figuren in unterschiedlichen politischen Systemen sind. Wieder einmal bleiben wir »internationalistische« Linke, die wir uns dem Kampf gegen den Nationalismus (Ersatz für den Kampf für den Sozialismus) verschrieben haben, Gefangene unserer eigenen Kategorien. Wir ignorieren, daß es in diesem Krieg – wie in jedem – nicht allein um Nationalismus, sondern um Macht und Geld geht, daß auch dieser Krieg als ein für manche sehr einträgliches Geschäft betrachtet werden muß10. Und wir sind lange – zumindest bis zum Krieg in Bosnien – auf den »internationalistischen« Schmäh hereingefallen, mit dem die großserbischen Ambitionen mit Blick auf das internationale Publikum gerechtfertigt werden. Wir geißeln, zurecht, aber in absurder Einseitigkeit, den kroatischen Nationalismus, weil er sich der traditionellen faschistischen oder faschistoiden Symbolik bedient, auf die wir Linke sozusagen konditioniert sind wie der Hund auf den Knochen. Wir übersehen, in tragischer und schuldhafter Verkennung, den serbischen Militarismus, weil wir gewohnt sind, die Sprache dieses sozialistisch-internationalistisch argumentierenden Nationalismus als fortschrittlich zu erkennen. Wir bemühen uns – zurecht – um ein systemisches Denken und versuchen beiden Konfliktparteien ihr Maß an Schuld zuzuweisen, daß es zum Krieg gekommen ist, aber wir übersehen dabei eine »Kleinigkeit«: Serbien hat Kroatien überfallen und nicht umgekehrt, Serbien hat Bosnien überfallen und nicht umgekehrt. Die faktische Gleichsetzung der beiden Kontrahenten bewahrt uns das »revolutionäre Gewissen«, aber es bedeutet, daß wir faktisch Täter gegen Opfer unterstützen. „Da man aber den Konflikt vorwiegend als einen ethnisch-nationalen wahrzunehmen pflegt, und deshalb eine Parallelisierung der nationalistischen Führer betreibt, ist einer sachliche Analyse der Kriegspartei bis in die Gegenwart hinein der Weg versperrt geblieben. (…) Milosevic wurde von der Weltöffentlichkeit nicht als die treibende Kraft der Krise und als Kriegstreiber identifiziert.“ 11
„Die Anerkennung kann die Probleme nicht lösen.“
Ein weiterer grundsätzlicher Fehler ist unsere Verweigerung einer bestimmten politischen Ebene. Scheinbar prinzipienfest lehnen wir die Ebene der »hohen Politik« ab und merken nicht, daß wir damit eine bestimmte »hohe Politik«, und zwar eine sehr gefährliche, kriegsbegünstigende, unterstützen. Wir sagen zum Beispiel: „Die Anerkennung hat gar nichts gelöst.“ Was soll das?“ 12 Natürlich kann eine Maßnahme allein überhaupt nichts lösen. Soweit ist der Satz bloß eine Binsenweisheit. Aber warum haben wir zuerst ständig betont, daß die diplomatische Anerkennung der neuen Republiken schädlich wäre (Herbst '91), um dann, als sie bereits erfolgt war, darauf hinzuweisen, sie könne „die Probleme nicht lösen“ (Frühjahr 1992)? Ignorieren wir damit nicht ein wichtiges Feld der Politik? Warum haben wir uns nie gefragt, welche Folgen die Nicht-Anerkennung auf den Zerfall Jugoslawiens hatte? Wieso haben wir die Augen davor verschlossen, daß die Nicht-Anerkennung eine permanente Ermutigung Serbiens dargestellt hat, seine Aggression vorzubereiten und durchzuführen? Denn es ist wohl heute kaum mehr zu bezweifeln, daß die Unterstützung der USA und Westeuropas besonders ab dem Frühjahr 1991 für die legitimistisch argumentierende Zentralregierung in Belgrad sehr zur Eskalation des Konflikts beigetragen hat.
Katzenjammer
Jetzt, nach dem Beginn des totalen Kriegs in Bosnien, hat uns wohl alle der große Katzenjammer erfaßt und wir spüren endlich, daß wir schief liegen. Doch auch jetzt noch hinken wir hinter den Großmächten hinterher, die ihre eigenen Wege der Befriedung gehen. Wir haben jede Initiative verloren. Halbherzig sprechen wir uns für internationale Maßnahmen aus, gleichzeitig fürchten wir – zurecht – auch ihre negativen Folgen.
Die Internationalisierung des Konflikts ist eine völlig richtige Maßnahme und wurde etwa von der slowenischen Friedensbewegung schon seit Mitte 1991 gefordert. Wir haben die Bedeutung einer Delegitimierung des jugoslawischen Bundesstaates aber viel zu lange als Nationalismus verkannt. Damals hätte internationaler Druck auf die Zentralregierung mit Wirtschaftssanktionen immerhin einiges bewirken können. Heute hingegen ist die Situation so zugespitzt, die Kämpfe haben solchen Haß verbreitet und die Armeen und bewaffneten Banden sind dermaßen unkontrollierbar geworden, daß auch Sanktionen nur mehr eine begrenzte Wirkung haben.
So liegt es in der Logik der Internationalisierung durch Staaten, daß als nächstes schärfere Interventionen, d.h. militärische, ins Auge gefaßt werden. Werden wir das, was wir im Golfkrieg so verurteilt haben, nämlich eine ausländische Militäraktion, nun am Balkan wieder erleben? Werden wir uns diesmal der »Macht des Faktischen« beugen? Wieviele von uns sympathisieren jetzt – hinter vorgehaltener Hand oder offen – mit einer »Operation Balkansturm«, weil sie ihnen als einziges Mittel scheint, den totalisierten Krieg in Bosnien und Kroatien aufzuhalten?
Das zeigt deutlich, daß wir als Friedensbewegung die Initiative verloren haben. Wir haben uns als Schönwetter-Bewegung erwiesen, die nicht viel helfen kann, wenn es brenzlig wird. Offenbar fehlen uns Konzepte und Vorschläge für eine »positive Internationalisierung«, bei der die Gefahr vermieden wird, die Spirale der Gewalt nur noch weiter zu drehen.
Angetreten sind wir, die »neue Friedensbewegung«, mit der optimistischen und frechen Losung: „Der Frieden ist zu wichtig, um ihn den Politikern zu überlassen.“ Gemeint haben wir vor allem die Gefahr eines Atomkriegs, eine Gefahr, die natürlich auch heute nicht gebannt ist. Aber wir haben ganz übersehen, daß auch »normale« Kriege – seit Wegfall des atomaren Patts umso leichter – stattfinden können, und offensichtlich in nächster Zeit immer häufiger stattfinden werden. Unsere Kritik am »abstrakten« Atomkrieg war – trotz aller Berechtigung – von einem eher unpolitisch-idyllischen Friedensbegriff geprägt, die »großen Friedensdemonstrationen« waren letztlich unpolitische Volksfeste der GUTEN LEUTE. Aus unserer Losung, die ja auf politische Einmischung zielte, ist oft etwas ganz anderes geworden: „Der Frieden ist uns zu heilig, um ihn als Politiker anzugehen.“
Unberechtigte Hoffnungen
Jetzt, wo Kriege in unserer Nachbarschaft stattfinden, ist es mit Friedensbewegung in einem viel unmittelbareren Sinn ernst geworden. Wo bleiben die zum Frieden »bewegten« Leute? Wieso, verdammt, haben sie sich gerade jetzt verlaufen, wo es nicht mehr darum geht, Gesinnung zu zeigen, sondern Hand anzulegen? Wir brauchen heute eine Friedensbewegung notwendiger denn je. Aber wenn wir etwas erreichen wollen, so müssen wir »den Frieden« und »die Friedensbewegung« entmystifizieren, »entmoralisieren«, von ihrer ideologischen »Aufladung« befreien:
1. Wir müssen uns verabschieden von unserem alten, romantischen Friedensbegriff, der mit unserer »fundamentalistischen« Kritik am Kapitalismus korrespondierte. Frieden war nur jenseits der bestehenden Gesellschaftsordnung denkbar. Was sich so revolutionär gab, war in Wirklichkeit – linkes Biedermeiertum: „Gefühlsmäßig wird Friede immer noch mit konfliktfreien, idyllischen, familialen, sicherheitsspendenden Kleingruppenerlebnissen identifiziert. Gerade diese Grundgefühle sind aber gegenwärtiger Friedensarbeit, wie mir scheint, eher hinderlich.“, warnte Peter Heintel schon vor etlichen Jahren die Friedensbewegung, um zu betonen, „daß nämlich erst durch Organisation konkret Friede erreicht werden kann, Friede also weniger ein durch humanistische Appelle oder moralische Forderungen erreichbarer Idealzustand ist, sondern harte Organisationsarbeit im Detail voraussetzt.“ 13 Das bedeutet also gerade nicht Aufgabe des kritischen Geistes, sondern im Gegenteil eine Politisierung der Friedensarbeit.
2. Wir müssen Werturteile, die hauptsächlich unser Selbstbild als BESSERE MENSCHEN aufrechterhalten, ersetzen durch konkrete politische Analysen der konkreten Situation. Das können wir nur, wenn wir insgesamt unser Selbstbild vom BESSEREN MENSCHEN aufgeben und uns als Pragmatiker des Friedenschließens begreifen. Wir brauchen deshalb nicht alle hohen Ideale auf den Müll zu werfen, die Arbeit ist auch so mühsam und frustrierend genug, daß wir der Ideale als Leitsterne und Orientierung bedürfen.
3. Wir müssen auch politische Felder, die uns nicht sympathisch sind, die aber eine entscheidende Rolle haben, endlich besetzen. Während es uns selbstverständlich ist, Vorschläge für staatliche Politik im nationalen Rahmen zu äußern, haben wir es bisher weitgehend abgelehnt, über internationale Konzepte für staatliche Politik nachzudenken. Unsere Haltung geht meist nicht über »Hände weg« hinaus: „Nein zur EG“ (gute Gründe), „Nein zur UNO-Aktion im Irak!“ (gute Gründe), „Nein zur diplomatischen Anerkennung der neuen Staaten“ (gute und weniger gute Gründe), „Nein zu (militärischen) Interventionen am Balkan“ (gute Gründe) usw. Doch so bleiben wir immer in der Defensive. Stattdessen sollten wir Konzepte für die Internationalisierung von Konflikten und für internationale Organe zur Konfliktlösung entwickeln. Solche Utopien und pragmatischen Vorstellungen stünden einer Friedensbewegung wohl an. Ähnlich wie es am Ausgang des Mittelalters darum ging, das alte Fehderecht durch die deutsche Landfriedensordnung zu ersetzen, die ein gewisses Gewaltmonopol der (lange sehr schwachen) Zentralregierung durchsetzte, geht es heute darum, das Gewaltmonopol der einzelnen Staaten einzuschränken zugunsten internationaler Organismen, die eine pazifizierende (wenn auch nicht wirklich friedensstiftende) Aufgabe übernehmen müssen.
Wie problematisch das einzelstaatliche Gewaltmonopol auch von einer ganz anderen Seite her ist, zeigt ebenfalls das jugoslawische Beispiel. Internationale Organisationen wie die UNO, eine Gemeinschaft von Staaten, haben keinerlei Möglichkeit des Eingreifens, wenn eine Zentralregierung »staatsfeindliche Umtriebe« bekämpft, z.B. die ihrer Völker, die eigene Wege gehen wollen. Jeder Versuch der EG, der KSZE, der UNO wurden von der (serbisch dominierten) jugoslawischen Regierung – völlig in Übereinstimmung mit internationalem Recht – als „Einmischung von außen“ interpretiert und zurückgewiesen.
Statt diese Fragen zu diskutieren und über bessere Möglichkeiten, auch in regionalem Rahmen, nachdenken, beklagen wir die Schwächen der UNO, oder noch schlimmer, wir entlarven ihr Versagen und ihren Mißbrauch durch die Großmächte. Damit ignorieren wir einfach die Aufgaben, die anstehen. Wenn sie nicht von demokratisch legitimierten Instanzen wahrgenommen werden, dann passiert es eben, daß die stärksten »Fürsten« sich als selbsternannte »Weltgendarmen« aufspielen. Natürlich war die von uns so scharf verurteilte Militärintervention gegen den Irak weder Lösung noch Vorbild, aber sie war die pervertierte Lösung, die die Idee des Richtigen noch in sich trug und wohl auch deshalb so viel Zustimmung gefunden hat. Der richtige Kern war, daß internationale Gemeinschaften gewaltsames Vorgehen gegen einzelne Mitglieder der Gemeinschaft nicht dulden sollten. Von diesen Überlegungen aus gewinnt auch unsere Forderung für eine weltweite Abrüstung ein größeres Gewicht. Besser eine stark bewaffnete Weltpolizei als Atomarsenale der Großmächte und Massenvernichtungswaffen für jeden besseren Kleinstaat.
4. Prinzipiell richtig ist der Gedanke, daß „der Krieg als soziale Institution nicht militärisch, sondern nur kulturell, d.h. durch Veränderung der Denk- und Verhaltensmuster zu überwinden“ 14 ist. Er darf aber nicht als Argument gegen die Suche nach politischen Lösungsmöglichkeiten aktueller Probleme ausgelegt werden. Vor allem müssen wir sehen, daß die »Zivilisierung« von Staaten über die Einführung demokratischer Strukturen hinaus eine elementare Voraussetzung für den Frieden ist. Diese Entwicklung der »zivilen Gesellschaft«, d.h. parteiunabhängiger Strukturen von Bürgerinitiativen, nicht nur der Friedensbewegung, ist nach wie vor unser wichtigstes Feld. Wir sollten uns, meine ich, nicht als Alternative, aber als entscheidendes Korrektiv der Parteien-Demokratie verstehen. An diesem Ziel ist die österreichische Friedensbewegung schon einmal, in den 80er Jahren, gescheitert. Sie war viel stärker als in anderen Ländern von politischen Parteien ideologisch und organisatorisch abhängig und wurde beinahe aufgesogen. Das sollte uns eine Warnung sein. Die wenigen Bewegungen, die heute noch bestehen, sind alle durch Partei-Unabhängigkeit gekennzeichnet und durch das mehr oder weniger konsequente Bemühen um Professionalisierung der Arbeit. Wir brauchen viel mehr Leute, die beruflich für Frieden und Konfliktlösung arbeiten, die auf verschiedensten Ebenen praxisbezogene Friedensforschung und Friedensarbeit betreiben. Gerade das Beispiel Jugoslawien zeigt, wie dringend solche Fachleute heute gebraucht werden, die Methoden und Wege gewaltfreier Konfliktlösung vorstellen und entwickeln können. Wir haben keine.
5. Stärkere internationale Vernetzung der Friedensbewegungen: Traditionell wurde dabei von Westeuropa der Osten, der Balkan vernachlässigt. Heute sollten wir wissen, wie explosiv die Situation in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ist. Die Zusammenarbeit gerade mit den VertreterInnen der zivilen Gesellschaft dieser Länder kann vielleicht verhindern helfen, daß sich das jugoslawische Paradigma ausbreitet. Trotz ihrer bürokratischen Struktur ist die Helsinki Citizens Assembly (HCA) eine der wenigen internationalen Organisationen, die sich dieser Probleme annimmt. Die österreichischen Gruppen (und offenbar ist es in den meisten westeuropäischen Ländern ebenso) scheinen sich aber eher abzuwenden, wenn man den enttäuschend schwachen Besuch der zweiten HCA-Versammlung im März 1992 in Bratislava zum Maßstab nimmt.
Mit anderen Worten: Was ansteht, ist nichts Geringeres, als daß sich Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Wenn uns das gelingt, will ich gerne vom Fortschritt des Menschen überzeugt sein. Bis dahin bleibt mir bloß der Glaube, ganz im Sinne von Franz Kafka, der einmal gemeint hat: „An Fortschritt glauben heißt nicht glauben, daß ein Fortschritt schon geschehen ist. Das wäre kein Glauben.“ 15
Der Artikel wird erscheinen in der Zeitschrift AUFRISSE, Heft 3/1992, einem Doppelheft zum Thema „Untergehendes Jugoslawien“ Verlag für Gesellschaftskritik, Kaiserstraße 91, A-1070 Wien.
Anmerkungen
1)) Peter Seipel, in: Wiener 1/92 Zurück
2)) Winfried Thaa. Die Unfähigkeit zu handeln. In: Kommune 4/1992, S. 40ff, hier S. 42 Zurück
3)) Mirko Messner. Die Spezialisten. In: Tango 15 (15.4.1992), S.3 Zurück
4)) Vgl. dazu Ivo Skoric. The Army Against The Country: A Story About The War in Croatia. In: The Intruder 5/1992, S.6-7, sowie: Dunja Melcic. Der Durchbruch der Weltpolitik und die schwierigen bosnischen Verhältnisse. In: Kommune 4/1992, S.14 ff Zurück
5)) Aufmacher der Wochenzeitung „Ulenspiegel“ 173, 20. April 1992 Zurück
6)) Vgl. Interview mit Peter Handke „Durchs Reden zugrunde gerichtet“. In: Profil 19/1992, S.96/97 Zurück
7)) Vlasta Jalusic, Was hat „Jugoslawien“ zusammengehalten? In: alpe adria 6/1991, S.9ff Zurück
8)) Pascal Bruckner. Survivrons-nous à la Jougoslavie? In: Le monde, 28.5.1992, S.2 Zurück
9)) Zitiert aus Drago Jancar. Bericht aus dem Neunten Land – Trugbild oder Wirklichkeit. In: Kommune 2/1992, S.58ff Zurück
11)) Dunja Melcic: Der totale Krieg als Endphase »Jugoslawiens«. In: Kommune 5/1992, S.22ff Zurück
12)) Karl Kumpfmüller. Interview in: TANGO 6(11.2.1992), S.1-2 Zurück
13)) Peter Heintel: Emotion und Organisation. In: Dialog, Beiträge zur Friedensforschung 8(1/1987), S.29ff Zurück
14)) Gerald Mader, Eröffnungsrede der Internationalen Sommerakademie in Schlaining, 5.7.1991, zitiert nach alpe adria 4/1991, S.26. (Die Polemik richtet sich ausdrücklich nicht gegen den Autor dieses Satzes.) Zurück
15)) Franz Kafka: Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg. Zitiert nach: Josef Mühlberger (Hrg.): Franz Kafka. Die kaiserliche Botschaft. Graz/Wien (Stiasny-Bücherei) 1960, S.83 Zurück
Werner Wintersteiner ist Herausgeber der friedenspolitischen Zeitschrift alpe-adria, Obmann des Vereins „Alpen-Adria-Alternativ“, Rathausgasse 8, A-9500 Villach.