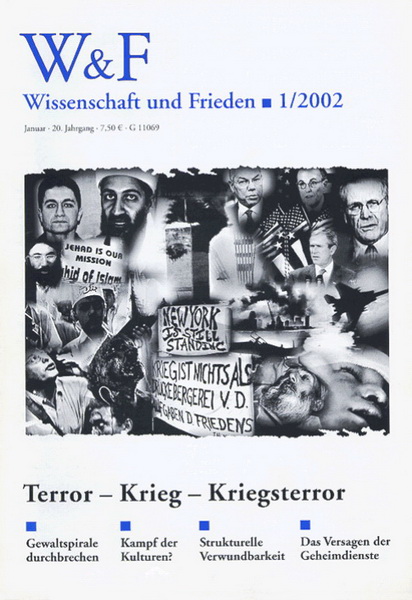Kampf gegen Terror – (k)eine Chance für Friedenspolitik?
von Wolfgang R. Vogt
Die Attentate vom 11.9.2001 werfen viele Fragen auf: Wie konnte es zu diesen Anschlägen kommen? Haben die Sicherheitsdienste versagt? Was sind die Ursachen für den Terrorismus – was die Motive der Terroristen? Wie steht es um die Verwundbarkeit offener Gesellschaften? Wie ist dem Terrorismus wirksam zu begegnen? Markiert der Trümmerberg des »Ground Zero« eine Stunde Null für eine neue, gerechte und nachhaltige Friedens- und Zukunftsgestaltung in der Weltgesellschaft? Oder fällt die Welt zurück in finstere Zeiten von Kriegen zwischen dem »Guten« und dem »Bösen«, den »Gläubigen« und den »Ungläubigen«, dem »Okzident« und dem »Orient«? Kommt es zu neuen Kreuzzügen und weiteren Märtyrertaten oder sogar zum Kampf der Kulturen und Religionen?
Wie auch immer diese Fragen beantwortet werden, eines ist schon jetzt klar: Die Terrorattacken haben die Agenda der Weltpolitik von Grund auf verändert. Die Welt ist – wie die »coalition of the willing« zeigt – durch die Terrorakte zu einer enger zusammenstehenden Gefährdungs- und Überlebensgemeinschaft geworden.
Die Terrorakte haben aber nicht nur die brisante Lage unserer Welt aufgedeckt, sie müssen auch Anlass sein für ein Nachdenken über eine konsequente Politik zur Lösung der globalen Probleme. Für eine nachhaltige, gerechte Friedenspolitik sind Strategien in problemgemäßer und zukunftsfähiger Weise zu konzipieren und zielorientiert zu realisieren. Das setzt eine Analyse der derzeitigen Kontroversen über Ziele, Art und Ausmaß der Reaktionen auf die Terrorattacken und vor allem der durch die Gewaltakte aufgebrochenen Dilemmata voraus.
Kontroversen und Dilemmata: Wie ist internationaler Terrorismus zu bekämpfen?
Nach einer Schockstarre in den Tagen nach den kaltblütigen Terroranschlägen ist inzwischen eine öffentliche Diskussion im Gange. In den Medien werden Informationskämpfe und Meinungskriege nach den üblichen Mustern geführt. »Armchair«-Strategen jedweder Couleur trommeln auf der einen Seite der Meinungsfront entweder für eine deutsche Beteiligung an dem Krieg gegen die Taliban und das Terrornetz von Al Qaida, oder warnen auf der anderen Seite als Kritiker mit großer Betroffenheit vor den unberechenbaren Folgen von Militäreinsätzen.
Wie immer werden diese Auseinandersetzungen als Grundsatz-Debatten ausgetragen. Sie bringen zwar emotionalisierte und fixierte, polarisierte und dramatisierte Standpunkte hervor, sind aber im Sinne einer überlegten, differenzierten Strategie für die Lösung der anstehenden Probleme nur bedingt nützlich und nicht gerade Anzeichen für eine entwickelte Diskurskultur. Durch die Verknüpfung der Sachfrage (Militäreinsatz) mit der Machtfrage (Koalitionserhalt) – die Bundeskanzler Schröder durch die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag herbeigeführt hat – wurde eine klärende Austragung der tiefen Differenzen in der Sache und ein sinnvoller Diskurs über die Dilemmata, die dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus immanent sind, unterbunden.
Für eine erfolgreiche Überwindung des Terrorismus und eine nachhaltige Entwicklung von Sicherheit und Frieden müssen differenzierte und nicht polarisierte Antworten auf die grundlegende Frage gefunden werden: Welche Dilemmata verbergen sich hinter den aufkochenden Kontroversen mit ihrem Kriegsgeschrei und Einsatzgerede, Sicherheitsstreben und Friedensverlangen? Ohne eine vorbehaltlose Aufarbeitung der Dilemmata im Kampf gegen den Terrorismus besteht die Gefahr, dass die Politik keine angemessenen Strategien für eine Friedensgestaltung mit Zukunft entwickelt.Die Einschätzungs-Kontroverse: Auslöser – Ursache – Wirkung?
Mit perfidem Kalkül haben die Terroristen für eine neue Definition der Situation und der Gefährdungspotenziale auf unserem Globus gesorgt. Die Kluft zwischen der Nicht-Wahrnehmung und der Wirklichkeit des zerrissenen und widersprüchlichen Zustandes der Weltgesellschaft wurde deutlich. Das öffentliche Bewusstsein in den Industriegesellschaften, das die ungerechten Verhältnisse in der Welt immer wieder mit Erfolg – trotz aller Informationen und Schreckensbilder – übersehen oder verdrängt hat, ist unvermittelt mit den harten Realitäten von Armut und Reichtum, Wohlstand und Elend, Hunger und Überfluss, Macht und Unterdrückung konfrontiert worden.
Unter diesem Blickwinkel ist die entscheidende Frage die nach Ursachen und Wirkung: Sind die Terroranschläge (wie John Galtung meint) als Reaktionen auf jahrzehntelange Demütigungen (also als Auswirkungen) zu begreifen, als Folge der großmächtigen Außen- und Sicherheitspolitik der USA, die durch Dominanzbestrebungen und zahlreiche Kriegsbeteiligungen charakterisiert ist? Sind sie Anzeichen für eine versäumte Weltinnenpolitik und Ausdruck für die strukturellen Gewaltverhältnisse der gespaltenen Welt? Oder sind die Grund-Ursachen letztlich im Islam zu suchen, in der Angst vor (westlicher, kapitalistischer, demokratischer, säkularer) Aufklärung, Modernisierung und Globalisierung, wie sie in der Reform-, Lebens- und Menschenverachtung des islamistischen Fundamentalismus erkennbar ist? Welche Wirkungszusammenhänge gibt es zwischen diesen Ursachenkomplexen? Von der Beantwortung dieser Fragen hängt ab, welcher Ansatz für die Bekämpfung des Terrorismus gewählt wird.
Das Dilemma der Politik besteht darin, es nicht wieder nur bei einer kurzfristig erforderlichen Symptombehandlung der Krise zu belassen (direkte Terrorismusbekämpfung), sondern die Strategien auf eine langfristig angelegte, differenzierte Ursachenbeseitigung durch eine nachhaltige und umfassende Friedensgestaltung zu konzentrieren, obwohl westliche Demokratien mit Blick auf die Wahlen strukturell eher Kurzzeitreaktionen und Symbolhandlungen präferieren.Definitions-Kontroverse: Kriegsführung oder Verbrechensbekämpfung?
Allgemeiner Konsens ist: Terror-Verbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben, weil sonst jegliche Tabugrenze fällt und die Stärke des Rechts gegenüber der Gewalt des Terrors unterliegt. Eine wichtige, weil folgenreiche Definitionsfrage ist jedoch, ob die Terrorgefahren durch Kriegsführung oder durch Verbrechensverfolgung zu bekämpfen sind. US-Präsident Bush hat vom „ersten Krieg des 21. Jahrhunderts“ gesprochen, von einem »neuen Krieg« mit anderen Dimensionen, gegen ein weltweites Netzwerk in über 60 Staaten, gegen teilweise unbekannte, verdeckt agierende Gegner und mit einer vermutlich jahrelangen Dauer. Seine ungezügelte Kriegsrhetorik in den Tagen nach den Terroranschlägen, die die Begriffe Krieg und Kreuzzug verwendete, die von einem Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen sprach und die Welt in Freunde und Feinde teilte, hat der Logik und Dynamik des Krieges den Vorrang vor einer Logik der Verbrechensbekämpfung gegeben.
Die Kritiker des Krieges argumentieren demgegenüber, dass die Verteidigung gegen den Terrorismus der Logik der Verbrechensbekämpfung folgen müsse, d. h., es geht darum die Täter zu identifizieren, ihre individuelle Verantwortung festzustellen und sie nach Recht und Gesetz zu bestrafen. Sie fordern, die zivilen und rechtsstaatlichen Methoden und Mittel zur Verhinderung und Überwindung von Terror-Gewalt und Verbrechen strikt und konsequent anzuwenden und dafür die internationale Gerichtsbarkeit auszubauen.
Der Ausbau einer internationalen (Straf-)Gerichtsbarkeit ist ein ebenso überfälliger wie notwendiger Schritt, um die bisher noch unterentwickelten Strukturen, Mechanismen und Prozeduren einer Weltinnenpolitik im Sinne einer Globalisierung des Rechtsstaates entscheidend voranzubringen. Auf diese Weise könnte das Dilemma zwischen einer interessengeleiteten Krisenbewältigung durch die Macht des Stärkeren zugunsten einer prinzipienorientierten Stärkung des Rechts zwar nicht aufgelöst, aber positiv entschärft werden. Eine multilaterale Verrechtlichung würde unilateralistischen Tendenzen und Interessen von Großmächten und ihrer rabiaten Durchsetzung mit militärischer Gewalt entgegenwirken.Verwundbarkeits-Kontroverse: Dominanz oder Dialog?
Die Terroranschläge haben in dramatischer Weise die strukturelle Verwundbarkeit der offenen, pluralistischen Gesellschaften offenkundig gemacht. Selbst die Supermacht USA ist – trotz ihrer High tech-Rüstung – nicht gefeit vor Überraschungsangriffen auf ihre zentralen Status- und Identitätssymbole (World Trade Center und Pentagon). Die stilbildenden Illusionen der USA von ihrer Unverwundbarkeit und ihrer Übermächtigkeit wurden durch das in sich zusammen Sinken der Twin Towers auf eine äußerst symbolhafte Weise zertrümmert. Der Bio-Terror mit Anthrax hat in einer zweiten Terrorwelle – deren Urheber bisher nicht bekannt sind – viele Amerikaner in Angst und Schrecken versetzt, tief in ihren Alltag eingegriffen und ein bisher nicht bekanntes Gefühl der realen, überall und jederzeit lauernden Bedrohung erzeugt.
Künftig haben die Menschen in den USA – und auch andernorts – mit dem »Trauma 11.9.2001« zu leben. Sie müssen sich mit dem »Siegfried-Syndrom«, d.h. mit der eigenen strukturellen Verwundbarkeit individuell und kollektiv auseinandersetzen. Der US-Patriotismus »We are the greatest!« ist in seinem Kern – auch wenn demonstrative symbolische Akte das überspielen – ebenso erschüttert worden wie die neoliberale Philosophie vom »American way of life«. Die Globalisierung westlicher kultureller Verhaltensweisen – insbesondere US-amerikanischer – empfinden viele Gesellschaften und Menschen in anderen Teilen der Welt als Bedrohung ihrer eigenen, oft Jahrhunderte alten Traditionen und Kulturen. Sie fürchten um ihre oft durch die Religion geprägte Identität, fühlen sich unter ständigen Modernisierungs- und Globalisierungsdruck gesetzt und nicht selten durch die Dominanz und Arroganz westlicher Macht-, Wirtschafts- und Kulturexpansion bedroht und erniedrigt.
Das Dilemma der Organisation von Frieden zwischen höchst unterschiedlich entwickelten Regionen und Kontinenten, Kulturen und Religionen stellt sich als die zentrale friedenspolitische Aufgabe im 21. Jahrhundert. Die westlichen Gesellschaften werden zu entscheiden haben, ob sie sich vorrangig durch militärische Mittel und wirtschaftliche Macht gegen die Risiken und Gefahren einer zerklüfteten und krisenhaften Welt behaupten oder ob sie den globalen Herausforderungen mit verstärkten Bemühungen um Dialog und Ausgleich, Kooperation und Entwicklung, d.h. mit einer grundlegend veränderten Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik begegnen wollen.Innere Sicherheits-Kontroverse: Sicherheit oder Freiheit?
Die brutale Regie der Terrorattacken hat existenzielle Grundfragen nach den zukünftigen Lebensentwürfen, Sicherheitskonzepten und Friedensvisionen der westlichen Welt zur Entscheidung gestellt. Nicht akzeptabel ist – nicht nur in diesem Zusammenhang – eine Verbreitung von Feindbildern. Feindbild-Konstruktionen verstärken nicht nur die vorhandenen Ängste, sondern führen zu einer weiteren Verrohung der Affekte und einer Radikalisierung der Aktionen. Sie verhindern differenziertes Wahrnehmen: Statt mäßigend einzuwirken, werden Vorurteile geschürt und verfestigt. So erhöhen sich die Gefahren und es kommt zur Verhärtung der Fronten.
Die Vielfalt der Kulturen und ihrer Menschen in unserer multikulturellen Gesellschaft und Welt ist vor allem als eine Bereicherung und nicht als eine Bedrohung unseres Lebens zu begreifen. Damit es nicht zu einem sog. Kampf der Kulturen kommt, Menschen mit ihren eigenen Identitäten und Traditionen nicht diskriminiert oder assimiliert werden, sind Toleranz und Dialog von grundlegender Bedeutung für die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Menschen und Kulturen. Dialog baut Brücken zur Verständigung, öffnet das Verständnis für die Sichtweisen, Sorgen und Wünsche der/des Anderen und ist die Voraussetzung für faire, konstruktive Konfliktbearbeitung. Toleranz kann es jedoch nicht gegenüber Intoleranz und Gewalt geben, da diese das Prinzip der Liberalität zur Durchsetzung fundamentalistischer Ziele, extremistischer Programme und radikaler Systeme missbrauchen. Gewalttätigen Angriffen gegen die Prinzipien von Toleranz und Dialog ist mit rechtsstaatlichen Methoden und Mitteln rechtzeitig, angemessen und konsequent entgegenzutreten.
Gegenwärtig besteht allerdings eine eindeutige Tendenz zur Dramatisierung der inneren Sicherheit (Schily- und Schill-Politik). Die verabschiedeten Sicherheitspakete haben Schritte in Richtung »Überwachungsstaat« und »gläserner Mensch« eingeleitet und praktisch alle BürgerInnen einem Generalverdacht und damit einer immer engeren Überprüfung aussetzt. Diese Gesetzesverschärfungen sind ohne tiefer gehende Diskussionen durch die demokratischen Zustimmungsorgane (Bundestag/Bundesrat) gepeitscht worden und ohne überzeugende Begründung ihrer konkreten Dienlichkeit für die frühzeitige Erkennung und Erfassung von Terroristen.
Die Politik darf die Ängste vieler Menschen nicht ignorieren und die Belange der Sicherheit nicht vernachlässigen. Ein leichtfertiges Hinnehmen erkannter Sicherheitsdefizite bei der Terrorismus-Bekämpfung wäre ebenso unverantwortlich wie ein alarmistisches und instrumentelles Ausspielen der Sicherheitsbelange auf Kosten der allgemeinen Freiheitsansprüche. Beide Einstellungen würden den Zielen der Terroristen ungewollt Vorschub leisten. Das in einem Rechtsstaat immer vorhandene Dilemma einer ausgewogenen Abstimmung von Freiheitsbelangen und Sicherheitserfordernissen ist unter dem Eindruck der Terrorgefahren durch die verabschiedeten Sicherheitspakete deutlich zu Lasten der Freiheitsrechte entschieden worden.Kriegsgewalt-Kontroverse: Befürwortung oder Ablehnung?
Das Grundprinzip der Gewaltlosigkeit wird in Krisen- und Kriegszeiten mit dem Ausnahmeprinzip zielgerichteter, kontrollierter und legitimierter Gegen-Gewalt konfrontiert. Deshalb kommt es bei der schwierigen Diskussion über diese äußerst heikle Gewaltfrage immer wieder zum erbitterten Prinzipienstreit, der von beiden Seiten nicht selten auch mittels wechselseitiger Diskriminierungen (Kriegstreiberei vs. Friedensträumerei, Falken vs. Tauben) ausgetragen wird.
FundamentalpazifistInnen halten schon das Zulassen einer Diskussion über die Zulässigkeit von legaler Gewalt durch die Politik zur Bekämpfung von illegaler Gewalt für einen bedenklichen Tabubruch und eine moralische Zumutung. Überzeugte Vertreter pragmatisch-politischer Abwägungen sehen in der Anwendung militärischer Gewalt ein normales Machtmittel der Politik, das in Krisen- und Kriegszeiten von einem souveränen Staat zum Zwecke der Friedenssicherung einzusetzen und nicht in Frage zu stellen ist. Die über Grundsätzliches streitenden Kontrahenten sind im Gewalt-Dilemma gefangen, denn je nachdem führt sowohl das strenge Nein, als auch das strenge Ja zu neuen Opfern. Wird durch ein Nein auf die Anwendung polizeilich-militärischer Mittel verzichtet und wirken andere Mittel nicht oder nicht schnell genug, kann der Terror weitere Gewaltattacken vorbereiten, die noch mehr Opfer fordern. Wird die Terrorgewalt durch ein Ja zur Gegengewalt bekämpft, gibt es neue Täter und neue unschuldige Opfer.
Grundsätzlich sind politische Entscheidungen und Handlungen – wie jedes menschliche Verhalten in zivilisierten Lebensgemeinschaften – an den Prinzipien der Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit zu orientieren. Das gebieten die Grundsätze der Friedensethik, erfordern die Artikel der UN-Charta sowie der Verfassung. Bei der Verfolgung oder Erfassung skrupelloser und selbst zum Märtyrertod entschlossener Terroristen stellt sich allerdings unerbittlich und unausweichlich die Frage, ob, wann und wie präventiv oder notfalls repressiv eingesetzte Gegen-Gewalt – wenn auch als extremste und allerletzte Form der Selbstbehauptung und Lebenssicherung – erforderlich sowie moralisch und rechtlich legitimiert ist.
Das komplizierte Gewalt-Dilemma ist nicht durch ein einfaches Ja oder Nein zu beantworten. Um zu einer moralisch verantwortbaren, rechtlich gesicherten und rational begründeten Entscheidung in der Gewaltfrage zu kommen, ist für mich die gewissenhafte Überprüfung der Positionen und Argumentationen anhand folgender Kriterien erforderlich:
- vorrangiger Einsatz nicht-militärischer (politischer, diplomatischer, wirtschaftlicher) Mittel,
- Mandatierung und Kontrolle durch den UN-Sicherheitsrat,
- penible Einhaltung völker- und verfassungsrechtlicher Regeln,
- Einbettung polizeilicher-politärischer Operationen (im Extremfall kann auch Militär herangezogen werden) in ein umfassendes zukunftsgerichtetes politisches Gesamtkonzept,
- Einsätze nur in engster Bindung an ein genau definiertes Ziel,
- strikte Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit der Mittel,
- sorgfältige Abwägung der Folgen aller Interventionen (vor allem auch der ungeplanten so genannten Kollateralschäden),
- jederzeitige Möglichkeit zum Abbruch der Einsätze im Falle erwiesener Erfolglosigkeit oder Unverhältnismäßigkeit (Exit-Option),
- reale Vorstellungen und Programme zur konkreten Implementierung und Gestaltung von Frieden in der Post-Konflikt-Phase,
- Bereitstellung von Mitteln für humanitäre Hilfe.
Bombardements aus sicherer Entfernung und großer Höhe unter Verwendung von Streubomben und auf Ziele in oder in der Nähe von Städten widersprechen in eklatanter Weise einer Reihe der genannten Kriterien. Eine solche Bombenstrategie fordert in kurzer Zeit möglicherweise mehr Todesopfer unter der Zivilbevölkerung als die barbarischen Terrroranschläge. Hier offenbart die Spirale der Gewalt ihre grausame Vernichtungsdynamik: Opfer werden zu Tätern und je länger dieser Destruktionsprozess anhält, desto ähnlicher und schuldhafter werden alle Beteiligten. Dieses moralische Dilemma kann auch durch einen militärischen Sieg und anschließende Jubelfeiern nicht aus der Welt geschaffen werden.
Bei Fragen von Krieg und Frieden geht es um existenzielle Entscheidungen über Leben und Tod von Zivilisten und Soldaten, Zerstörungen von Kultur und Natur. Dass eine Debatte über den Einsatz militärischer Mittel zu sehr kontroversen Auseinandersetzungen führt, ist ein Gütezeichen demokratischer, zivilisierter Gesellschaften. Diese Kontroversen offenbaren das ethische Dilemma und die moralische Ambivalenz des Einsatzes militärischer Gewaltmittel bei der Konfliktbearbeitung, das gilt in besonderer Weise bei der Überwindung von Terrorismus. Wichtig für eine verständigungsorientierte Diskurskultur ist die Versachlichung der Gewaltdebatten durch eine Prüfung der vorgebrachten Argumente anhand eines strikten Kriterienkatalogs, der gemeinsam zu erarbeiten ist.Paradigmen-Kontroverse: Machtlogik oder Friedenslogik?
Weder eine Politik uneingeschränkter, kriegsbereiter Solidarität, die ihr Militärangebot den USA quasi aufgenötigt hat, wird den neuen Herausforderungen gerecht, noch eine Politik uneingeschränkter, friedensseliger Moralität, die in jeglicher Bereitstellung eines Militärkontingents – und sei es für Sicherungs- und Versorgungsaufgaben – eine existenzielle Grundsatzfrage mit angeblich unzumutbaren Risiken ausmacht. In beiden Politikansätzen werden nur die jeweils genehmen »halben Wirklichkeiten« wahrgenommen, werden die nicht erwünschten anderen Hälften der vielschichtigen Realitätsbedingungen geflissentlich übersehen. So gibt es Friedensfreunde, die die Gefahren, die vom internationalen Terrorismus ausgehen, unterschätzen und die Möglichkeiten, die den Methoden ziviler Konfliktbearbeitung innewohnen, überschätzen. In umgekehrter Weise missachten Kriegsbefürworter die »Kollateralschäden« eines Krieges (bezogen auf die Zivilbevölkerung der betroffenen Gebiete, auf benachteiligte Völker und auf die zivilen internationalen Strukturen), sie überschätzen die Möglichkeiten der militärischen Konfliktaustragung, während sie die vielfältigen Instrumente ziviler, nicht-militärischer Konfliktbearbeitung in ihrer friedensstiftenden Bedeutung unterbewerten und ihnen zu wenige Mittel zuweisen.
Begründet wird die Bereitstellung von maximal 3.900 Soldaten der Bundeswehr von der rot-grünen Regierungskoalition vor allem mit den eigenen deutschen Sicherheitsinteressen, der Verpflichtung zur »Bündnistreue« gegenüber der NATO, der UN-Resolution zum Kampf gegen den Terrorismus, dem Hinweis auf die gewachsene Verantwortung Deutschlands in der Welt und der geschuldeten Dankbarkeit gegenüber den USA. Tatsächlich scheint hinter dem auftrumpfenden Kanzlerwort von der »uneingeschränkten Solidarität« gegenüber den USA ein ganz anderer, bisher nur angedeuteter und nicht weiter thematisierter Politikentwurf zu stehen. Offensichtlich nutzt Gerhard Schröder die durch den Terroranschlag ausgelöste Krise um eine neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zu platzieren. Die Krise scheint ihm als geeignete Gelegenheit um Deutschland machtpolitisch an der Seite der USA und nahezu gleichberechtigt mit Großbritannien und Frankreich zu etablieren. In dem er ultimativ die Vertrauensfrage im Parlament mit der Zustimmung zur Bereitstellung deutscher Truppenteile für den »Krieg gegen den Terror« verknüpfte, presste er gleichzeitig den partei- und koalitionsinternen Kritikern und Bedenkenträgern ihre Zustimmung zur ersten Beteiligung deutscher Soldaten an Kampfeinsätzen »out of area« ab.
In seinem – sicherlich mit Außenminister Fischer abgestimmten – Politikkonzept wird der Einsatz von Militärgewalt als normales Mittel der Politik eines wieder voll souveränen Staates angesehen. Damit wird die bisherige Haltung außen- und sicherheitspolitischer Zurückhaltung in militärischen Fragen endgültig aufgegeben. Eine paradigmatische Politikveränderung wird konsequent fortgesetzt, die die vorherige Regierung mit Sanitätssoldaten in Kambodscha, Minenbooten im Golfgebiet, Awacs-Aufklärern über der Adria, Versorgungssoldaten in Somalia und Blauhelmkontingenten in Bosnien begonnen hatte und die durch die jetzige Regierungskoalition mit ihren militärischen Engagements in den Balkankonflikten – Kosovo, Mazedonien, Afghanistan – systematisch fortgesetzt wurde. Damit besiegelt die rot-grüne Koalition unter Kanzler Schröder jene machtpolitische Neuorientierung der schwarz-gelben Regierung unter dem damaligen Kanzler Kohl, die nach der Wiedervereinigung den militärischen Faktor »step by step« in das Repertoire politischer Handlungsoptionen deutscher Politik eingeführt hat.
Das Dilemma dieser außen- und sicherheitspolitischen Neuorientierung liegt in einer erzwungenen Entscheidung für eine »normalisierte« Außen- und Sicherheitspolitik, die sich militärischer Gewaltmittel bedient, wenn es ihren Interessen dient. Damit wird der (nach dem Zweiten Weltkrieg bewährten) Politik machtpolitischer Zurückhaltung eine Absage erteilt, damit wird bewusst eine militärgestützte Renationalisierung vorangetrieben, die den Erfordernissen und Verlautbarungen einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik mit zivilem Antlitz entgegensteht, damit wird die Chance für eine konsequente Zivilisierung der Weltinnenpolitik verspielt.Globale Zivilisierung – eine Vision für die Friedens- und Zukunftsgestaltung im 21. Jahrhundert
Die Attentate haben klar gemacht, dass alle Mitglieder der Weltgesellschaft in einer krisen- und gewaltträchtigen Gefährdungsgemeinschaft leben, die nur durch gemeinsame Anstrengungen eine Überlebensgemeinschaft werden kann. Um die Krise als Chance zu nutzen, wäre ein friedenspolitischer, zivil orientierter Perspektivenwechsel der Mächtigen bezüglich der Problemlagen, Krisengebiete und Konfliktfelder erforderlich. Insofern ließe sich der Terrorangriff auf die USA als eine historische Zäsur begreifen, die eine Weichenstellung für die Ausrichtung der Politik und für die Entwicklung in der Zukunft darstellt: Dem Kult der Gewalt könnte eine Kultur des Friedens als Zivilisierungskonzept für die Weltgesellschaft des 21. Jahrhunderts entgegengestellt werden.
Die Politik des »Westens« müsste alle ihr möglichen Anstrengungen unternehmen, um ihre Potenziale in gewaltmindernder, konfliktregulierender und friedensstiftender Absicht entschieden für die Entwicklung und Gestaltung einer gerechten, fairen Weltfriedensordnung und eine Welt kooperierender Friedenskulturen einzusetzen: ohne Dominanz und Arroganz, sondern durch interkulturellen Dialog und präventive Konfliktarbeit, friedfertige Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung.
Eine neue Friedenspolitik ist nur durchsetzbar mit einer sich den neuen Herausforderungen stellenden und präzise argumentierenden Friedensbewegung und einer kritischen Friedensforschung. Letztere hat bereits unter den bislang eher bescheidenen Bedingungen differenzierte Strategien und Programme für die Zivilisierung der gesellschaftlichen Bereiche, geografischen Regionen und verschiedenen Politikfelder entwickelt. Wenn die Politiker in unserem Lande den Frieden mit angemessenen, zivilen Mitteln konsequent voranbringen wollen anstatt dem militärischen Faktor immer wieder neue Aktionsfelder zu eröffnen, dann müssen sie diese Arbeiten endlich abrufen und eine weitere Professionalisierung der Gewalt-, Konflikt- und Friedensforschung unterstützen.
Dr. Wolfgang R. Vogt ist Vorsitzender von Wissenschaft und Frieden e.V. und Vorstandsmitglied im Pax-Forum für Friedenskultur e.V.