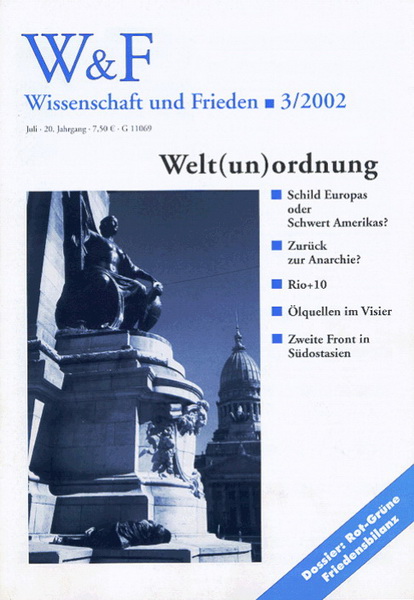Kein Frieden auf dem Erdgipfel?
USA bereiten sich auf einen nachhaltigen Krieg vor
von Jürgen Scheffran
Im Juni 1992 trafen sich in Rio de Janeiro Tausende Vertreter von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zum »Erdgipfel« für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Conference on Environment and Development, UNCED). Viele fuhren mit großem Enthusiasmus und hohen Erwartungen nach Rio, kamen jedoch meist ernüchtert wieder. Zu groß waren die Divergenzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, zu stark die Widerstände etablierter Interessen und Machtstrukturen, zu offenkundig die Abneigung der US-Regierung unter George Bush (sen.) gegen Einschränkungen des Wirtschaftswachstums und der politischen Handlungsfreiheit der USA. Angesichts dieser Konfliktlage verwundert es nicht, dass viele Kompromissformeln unverbindlich und vage blieben, und konkrete Entscheidungen in die Zukunft verschoben wurden. Dennoch war im Nachhinein UNCED 1992 eines der wichtigsten internationalen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Letztlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass die globalen Umweltprobleme alle Nationen dieses Planeten bedrohen und somit nur gemeinsam und kooperativ lösbar sind. In wenigen Wochen startet in Johannesburg der nächste Gipfel, von vielen Rio+10 genannt. Jürgen Scheffran zu dem Erreichten und Nichterreichten, zu den Problemen und Chancen.
176 Staaten einigten sich in Rio auf das gemeinsame Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (sustainable development), das Lösungen für die brennenden ökologischen und sozialen Probleme der Erde in Aussicht stellte. Ohne Rio hätte es keine Erdcharta gegeben, keine globale und lokale Agenda 21, keine Biodiversitätskonvention und auch keine Klimarahmenkonvention, nebst Kyoto-Protokoll. Diese Abkommen gelten bis heute als Eckpfeiler der internationalen Umweltpolitik. Ein wichtiger Schritt zur Institutionalisierung war die Gründung der Kommission für Nachhaltige Entwicklung (CSD), die im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) angesiedelt ist und die Umsetzung des globalen Aktionsprogramms der Agenda 21 überwachen und vorantreiben soll.
Der Rio-Prozess
Das Ergebnis von Rio war ein hart erkämpfter und zerbrechlicher Kompromiss, der Nord und Süd Zugeständnisse machte. So wurden dem Süden Wachstumsspielräume zugebilligt, ohne Verpflichtungen in der Klimapolitik übernehmen zu müssen. Der Norden bekannte sich erstmalig zu seiner Verantwortung als Hauptverursacher der globalen Umweltzerstörung und stimmte grundsätzlich einem Transfer von Technologien und Finanzmitteln zu. Die Agenda 21 richtet sich nicht nur an Regierungen, sondern gerade auch an die Zivilgesellschaft, die ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten soll.1
Wichtiger noch als der Erdgipfel war der daraus hervorgehende Nachfolgeprozess, allen voran die Serie internationaler Konferenzen, auf denen das Spektrum von Umwelt und Entwicklung abgearbeitet und neue internationale Umweltverträge abgeschlossen wurden, wie die Wüstenkonvention. Bestehende Vereinbarungen wurden durch Protokolle ergänzt, wie das Cartagena-Protokoll der Biodiversitätskonvention und das Kyoto-Protokoll der Klimarahmenkonvention. Mit dem Kyoto-Protokoll von 1997 wurden erstmals konkrete Emissionsminderungen bei Treibhausgasen vereinbart, die bei der Konferenz in Bonn im Juli 2001 aber abgeschwächt wurden, um ein Scheitern zu verhindern.
Gemäß der Devise »Global denken – lokal handeln« strahlte der »Geist von Rio« auf die lokale und kommunale Ebene aus und bringt bis heute Umweltschützer, Gewerkschafter und Menschenrechtler an einen Tisch mit Unternehmern, Politikern und Kirchenvertretern, um das Konzept der Nachhaltigkeit »vor Ort« in die Tat umzusetzen. In wachsendem Maße werden Nichtregierungsorganisationen (NGO) in die Umsetzung der lokalen Agenda 21 einbezogen, nehmen teil an UNO-Konferenzen und haben die Möglichkeit, auf Entscheidungsprozesse und Verhandlungen Einfluss zu gewinnen.
Schwachpunkte und Defizite
Trotz einiger Erfolge, ist zehn Jahre nach Rio der internationale Verhandlungsprozess festgefahren. Schon die Zwischenbilanz zum fünften Jahrestag von Rio 1997 war ernüchternd. Obwohl Regierungsvertreter und NGOs in Nord und Süd die andauernde Umweltzerstörung und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich anprangerten, konnte die Sondersitzung in New York sich nicht einmal auf eine gemeinsame politische Erklärung einigen.
Im Herbst dieses Jahres steht wieder ein Erdgipfel an, der »Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung« in Johannesburg. Schon der häufig verwendete Untertitel »Rio+10« zeigt, dass es hier weniger um Durchbrüche für zukunftsweisende Konzepte und konkrete Vereinbarungen geht, als vielmehr um die Bilanzierung und Zelebrierung des bisher erreichten. Von der Aufbruchstimmung in Rio ist nichts mehr zu spüren. Nachhaltige Entwicklung bleibt ein Schlüsselwort, doch droht der Begriff zu einem Lippenbekenntnis in Positionspapieren von Staaten, Firmen und NGOs zu verkommen. Zwar gibt es eine Vielzahl von Katalogen für nachhaltige Indikatoren, es fehlen jedoch klar definierte und allgemein anerkannte Maßstäbe, wie die zugrundeliegende Zielsetzung mit Inhalt gefüllt und umgesetzt werden kann. So lässt sich der Begriff für die unterschiedlichsten Zwecke instrumentalisieren. Johannesburg droht eine Harmonieveranstaltung zu werden, auf der zwar Dialoge gepflegt werden, jedoch kein Streit.2
Dass die Debatte um Nachhaltigkeit an Ausstrahlungskraft verloren hat, ist auch selbstverursacht. Der ursprünglich ganzheitliche Ansatz, der soziale, ökologische und ökonomische Interessen ausbalancieren wollte (repräsentiert durch das »Nachhaltigkeitsdreieck«), ist durch die Aufspaltung in sektorale Einzelprozesse und den Wettstreit partikularer Interessen weitgehend verloren gegangen. Jeder kämpft in seinem Bereich und verliert das übergeordnete Ziel aus dem Auge. Die soziale und selbst die ökologische Dimension hat gegenüber der ökonomischen Dimension an Bedeutung verloren, wobei die wirtschaftlichen Aspekte oft auf »nachhaltiges Wachstum« beschränkt werden, so als sei die dem Ausdruck innewohnende Widersprüchlichkeit kein Thema mehr. Dass Entwicklung weit mehr bedeutet als ein steigendes Bruttosozialprodukt, gerät so wieder in Vergessenheit.
Dass die sozio-politische Komponente gegenüber der ökonomischen an Bedeutung verlieren konnte, ist vor allem auch eine Folge der wirtschaftlichen Globalisierung, die der politischen Internationalisierung zuwider läuft. Der Shareholder übertrumpft den Stakeholder, die einst beschworene globale Partnerschaft der Völker wird dem Konkurrenzkampf der Volkswirtschaften geopfert. Schneller als die Herausbildung einer Weltpolitik und einer Weltgesellschaft erfolgt die Herausbildung des Weltmarkts. Öffentliche Güter, allen voran die natürliche Umwelt, werden entweder privatisiert oder, wenn sie nicht genug Profit erwarten lassen, privaten Interessen geopfert. Zwar ist der Rio-Prozess noch nicht gescheitert, doch ist seine Durchsetzung erheblich schwerer geworden.
Hinzu kommt, dass im vergangenen Jahrzehnt der Zustand der Umwelt sich weiter verschlechtert hat und damit der politische Handlungsspielraum eingeengt wird. Die Trends, die das Worldwatch-Institut zur Jahrtausendwende festgestellt hat, sind beunruhigend. Verwiesen sei hier nur auf die Degradation von Wasser, Wäldern und Ackerland, die Gefährdung der Artenvielfalt und die Überfischung der Meere. Trotz verbleibender Unsicherheiten über das genaue Ausmaß des Katastrophe lassen sich die »harten« Fakten nicht einfach wegdiskutieren, wie dies der dänische Statistiker Björn Lomborg3 versucht. Auch gesellschaftliche Trends weisen in die falsche Richtung, etwa das anhaltende Wachstum der Weltbevölkerung, die hohe Arbeitslosigkeit, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die Konzentration ökonomischer Macht, der Einfluss der globalen Finanzmärkte und die Fundamentalisierung vieler Gesellschaften als Reaktion auf die Globalisierung.Besonders schwer wiegen die Probleme und Folgeschäden des Klimawandels für die Menschheit. In ihrem jüngsten Bericht weisen die Experten des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) auf unkalkulierbare Risiken und tiefgreifende Veränderungen im Naturhaushalt der Erde hin.4 Überschwemmungen und Dürren, Wassermangel und vermehrte Waldbrände, schwindende Gletscher und Meeresspiegelanstieg, Stürme und wechselnde Ozeanströmungen sind Katastrophen, die viele Menschen betreffen. Nicht weniger schwerwiegend sind die schleichenden Veränderungen, wie Ernteausfälle, Verlust von Artenvielfalt, Zunahme von Hunger und Armut. Diese treffen vor allem Entwicklungsländer des Südens, die aufgrund ihrer naturräumlichen Bedingungen und den schlechteren Anpassungsmöglichkeiten verwundbarer gegenüber einem Temperaturanstieg sind als die Industrieländer, aber am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind.
Abrüstung und Konversion – Kein Thema auf dem Erdgipfel
Ein Thema, das in Johannesburg wohl keine Rolle spielen wird, wie seinerzeit schon in Rio, ist die Frage von Krieg und Frieden, von Militär und Sicherheit, von Terror und Gewalt, von Abrüstung und Konversion. „Was in Rio fehlt: Das Thema Militär und Umwelt“, monierte im Sommer 1992 Michael Renner vom Worldwatch-Institut in der Frankfurter Rundschau. Er beklagte, dass die enormen Kosten und Risiken des militärischen Sektors und die Chancen von Abrüstung und Rüstungskonversion für die Lösung globaler Probleme beim Erdgipfel ausgeblendet worden seien.
Dabei gab es durchaus Vorschläge, die Agenda zu erweitern. Anfang 1991 hatte ich die Gelegenheit, in New York als Berater einer Studie der UNO-Abrüstungsabteilung (Department for Disarmament Affairs) mitzuwirken, in der die Möglichkeiten und Optionen untersucht wurden, militärische Ressourcen für den Umweltschutz und zur Katastrophenhilfe einzusetzen. In Vorbereitung des Erdgipfels von Rio sollten Vorschläge erarbeitet werden, wie die erhoffte Friedensdividende aus dem Rüstungsbereich der Lösung globaler Probleme zugute kommen könne. Experten aus den USA, Russland, China, Brasilien, Ghana und Schweden stellten eine Reihe von Vorschlägen zusammen, etwa die Umwidmung von Rüstungsbudgets und Personal, von Ausrüstung und Know-How (z.B. Umgang mit toxischen und radioaktiven Stoffen), von Forschung und Entwicklung bis hin zu konkreten technischen Geräten (Computer, Fahrzeuge, Flugzeuge, Satelliten).5
Herrschte bei der Nutzung entsprechender Ressourcen aus dem Militärsektor noch weitgehende Einigkeit, so traten Divergenzen vor allem da auf, wo es um die Institutionalisierung und die Frage des Zugriffs auf natürliche Ressourcen ging. Die schwedische Botschafterin Maj Britt Theorin, die die Expertengruppe leitete, setzte sich für das Konzept einer international agierenden Grünhelmtruppe ein. Widerspruch kam von dem brasilianischen Wissenschaftler Celso Lafer (der 1992 Außenminister Brasiliens wurde), der auch die Ansicht kritisierte, den Amazonasurwald als Erbe der Menschheit zu betrachten, wohl aus der Befürchtung, den Regenwald eines Tages gegen eine internationale Intervention verteidigen zu müssen. Als Kompromissformel einigten sich die Experten auf eine Bezeichnung, die weniger militärisch klang und die Hilfsfunktion betonte (environmental relief team).
Die Ergebnisse der Expertenstudie wurden mit einiger Zeitverzögerung veröffentlicht und fanden nicht wie geplant Eingang in den Erdgipfel von Rio. Den USA und anderen Staaten war das Thema wohl zu heikel. Es hätte den Blick auf die negativen Folgen von Rüstung und Krieg für Umwelt und Entwicklung gelenkt und Hoffnungen auf eine Friedensdividende in diesem Bereich geweckt. Sicherlich mag es auch gute Gründen gegeben haben, den Erdgipfel nicht zu überfrachten und einen Minimalkonsens nicht zu gefährden. Letztlich war aber die völlige Ausblendung der Thematik ein Fehler.
Immerhin entwickelte sich aus der Initiative der UN-Abrüstungsabteilung eine Serie von internationalen Konferenzen, auf denen die Möglichkeiten für Rüstungskonversion thematisiert wurde. Ein Ausfluss der Bemühungen war die Gründung des Internationalen Bonner Konversionszentrums (BICC). Bekanntlich floss die Friedensdividende nicht in die Lösung globaler Probleme, sondern über Steuersenkungen vorwiegend in private Taschen. Zudem bekam die Debatte eine zunehmend problematische Wendung, als auf der ersten Konferenz Anfang 1992 in Bochum der damalige Umweltminister Klaus Töpfer gemeinsam mit Maj Britt Theorin das Konzept der Grünhelme öffentlich vorstellte, ohne es hinreichend gegenüber dem Militär abzugrenzen (was eine Voraussetzung für echte Konversion ist). Kritiker polemisierten folgerichtig gegen den Einsatz militärischer Operationen zum Schutz der Umwelt und befürchteten eine Ausweitung des militärischen Aufgabenbereichs.
Dass die Befürchtungen berechtigt waren, zeigte sich, als das Pentagon unter Clinton 1996 im Rahmen des Konzepts »präventiver Verteidigung« eine eigene Abteilung für Umweltsicherheit einrichtete, und somit das Militär sich Umweltaufgaben einverleibte, statt konvertiert zu werden.6 Auch in der NATO und in Deutschland wurde der Einsatz des Militärs an der Umweltfront diskutiert. Solche reaktiven Strategien dienen der Interessendurchsetzung und Risikominimierung für die ökonomisch und militärisch besser gerüsteten Staaten und verschärfen das Konfliktpotential noch.
Bushs Agenda für den nachhaltigen Krieg
Verglichen mit der Situation Anfang der neunziger Jahre, als der gerade beendete Kalte Krieg noch Hoffnung stiftete, findet der Johannesburg-Gipfel in einer völlig veränderten Weltlage statt. Sie ähnelt mehr der Situation Anfang der achtziger Jahre, als der Bericht Global 2000 des glücklosen US-Präsidenten Jimmy Carter von seinem Nachfolger Ronald Reagan in die Schublade verbannt wurde. Zwar geht es heute nicht mehr um den Existenzkampf zweier hochgerüsteter Supermächte, aber die USA unter George W. Bush (jun.) kämpfen nicht weniger verbissen gegen die Achse des Bösen. Dass einige der Feinde hausgemacht sind, interessiert dabei ebenso wenig wie das mögliche Scheitern des Rio-Prozesses und die daraus folgende Destabilisierung internationaler Sicherheit. Riskiert werden auch die potentiell riesigen Schäden durch Umweltzerstörung und Klimawandel für die USA selbst, z.B. durch die Austrocknung des Weizengürtels der USA oder die Zunahme von Überschwemmungen, Hurricans und Tornados. Folgenreich könnte auch die Ausbreitung von Seuchen in nördlichere Regionen der USA sein, was die Gesundheit oder gar das Leben von Millionen von US-Amerikanern bedrohen könnte. Hier könnte eine präventive Gefahrenabwehr weit mehr Sicherheit für die Bürger der USA bringen als der Kampf an der Front der »homeland defense« mit Militär, Geheimdiensten und Antiterrorkrieg.
Bush’s Agenda für die Welt des 21. Jahrhunderts ist nicht die eines nachhaltigen Friedens, sondern die eine „langandauernden nachhaltigen Krieges“. Die Zeitung New Europe spielt weiter mit dieser irritierenden Begrifflichkeit aus der Umweltpolitik:7 „Die Vereinigten Staaten werden ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, die NATO-Staaten unter dem Oberbefehl Amerikas zu halten, in diesem Krieg, der wahrscheinlich in mehreren Wellen ausgeführt wird und durch Elemente der Nachhaltigkeit charakterisiert wird, in dem Sinn, dass die Feinde erneuerbar sein werden und daher die Ziele in jeder Runde neu definiert werden müssen. … In einem solchen langandauernden und unbestimmten Prozess werden die „erneuerbaren“ Ziele nicht allein aufgrund krimineller terroristischer Aktivitäten gewählt, sondern auch unter Berücksichtigung politischer und finanzieller Ausgaben und des Bedarfs bestimmter Bereiche der Rüstungsindustrie. …Dieser neue Typus eines von den USA angeführten Krieges zielt darauf ab, durch eine komplizierte Abfolge von Schritten die bislang verfehlte Globalisierung auf höherem Niveau herzustellen.“
In einem solchen Krieg an allen Fronten und für alle Zeiten macht es für Bush keinen Unterschied, ob er internationale Umweltabkommen scheitern lässt, wie das Kyoto-Protokoll oder Rüstungskontrollverträge, wie den ABM-Vertrag. In beiden Fällen geht es darum, Beschränkungen der nationalen Souveränität durch das Völkerrecht abzulegen, um ungehindert agieren zu können. Dabei bedient Bush in erster Linie die Interessen seiner Klientel aus Rüstungs-, Öl- und Kernenergielobby, für die eine friedliche und nachhaltige Welt das Ende ihrer Existenz bedeuten dürfte. Ungeniert werden dabei alle Ressourcen beansprucht, die für die Sicherheit und Wirtschaft der USA wichtig sind. Nach den Terroranschlägen vom 11. September, die die Verwundbarkeit der Industriegesellschaft demonstrierten, hat in den USA das Interesse an der Ressourcensicherung gegenüber diversen Bedrohungen deutlich zugenommen.8 Sicherheits-, Umwelt- und Energiepolitik verschmelzen so zu einer seltsamen Gemengelage. In diesem Zusammenhang kann auch der Antiterrorkrieg der USA gegen Afghanistan gesehen werden, gegen ein Land an der Schnittstelle von Südasien, Zentralasien und Nahost, in einer Region mit den weltweit größten Ressourcen fossiler Energie.
Auch für Russland ist der »Antiterrorkrieg« in Tschetschenien eine willkommene Gelegenheit, sich mit Gewalt den Zugriff auf die Ölressourcen der Region zu sichern. Die geschätzten Ölreserven liegen bei 17,5 – 34 Mio. Barrel, vergleichbar zu denen der USA (22 Mio.) und der Nordsee (17 Mio.). Die natürlichen Gasreserven sind sogar noch größer. Die Tatsache, dass der »weiche Unterleib« der ehemaligen Sowjetunion reich an energetischen und teilweise auch mineralischen Rohstoffen ist, hat zusätzlich die Begierde führender Industrienationen und großer internationaler Energiekonzerne geweckt.9
Von der negativen zur positiven Kopplung
Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere die unheilvolle Verknüpfung der Globalisierung mit Terror und Krieg, bestätigt Befürchtungen, in einer unfriedlichen und von Gewalt bestimmten Welt sei nachhaltige Entwicklung nur schwer realisierbar. Umgekehrt wird es mit einer Zunahme von Ressourcenknappheit und Umweltzerstörung zunehmend schwieriger, die Bedingungen des Friedens zu sichern.10 Die fatale Negativkopplung von Umweltzerstörung, Unterentwicklung und Krieg hat durch den 11. September einen Quantensprung erfahren. Wie am Beispiel der fossilen Energienutzung und der globalen Erwärmung angedeutet, besteht die Gefahr, dass die weitere Weltentwicklung in ein sich selbst verstärkendes Negativszenario abdriftet, in dem wenige gewinnen und viele verlieren. Je weiter das Negativszenario fortgeschritten ist, desto mehr kann sich eine selbsterhaltende Kopplung von Wachstum, Macht und Gewalt herausbilden, die verbunden mit autoritären Strukturen einen nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft blockiert. Anstelle präventiver Vermeidungsstrategien gewinnt dann ein nachsorgendes Risiko- und Konfliktmanagement an Bedeutung, das erst dann greift, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Für den Rio-Prozess sind dies düstere Aussichten.
Die Welt muss jedoch nicht untätig wie ein Kaninchen auf die Schlange USA schauen. Im Unterschied zum ABM-Vertrag, bei dem der einzige Vertragspartner Russland die Kröte schluckte, haben sich beim Kyoto-Protokoll die anderen Staaten das Vorgehen der USA nicht gefallen lassen und das Abkommen im Juli 2001 in Bonn unterzeichnet. Zwar musste das Abkommen erhebliche Federn lassen, doch ist in der derzeitigen Situation, in der die USA auf nahezu allen Feldern einseitig agieren wollen, die Verteidigung des Kyoto-Protokolls ein Erfolg. Damit lässt sich ein bis dahin nicht dagewesener Mechanismus in Gang setzten, der eine Eigendynamik entfalten kann. Ein Vorbild ist die Gründung der Teststopp-Organisation in Wien, die schon seit Jahren arbeitet, ohne dass das zugehörige Abkommen ratifiziert worden wäre. Interessanterweise sah sich Bush kürzlich genötigt, die Bedeutung des Umweltschutzes für die US-Wirtschaft zu betonen, wohl aus der Befürchtung, den damit verbundenen Markt den Europäern oder Japanern überlassen zu müssen.
Eine weitere Möglichkeit zum Aufbrechen der Negativkopplung ist die Entwicklung partizipativer Konzepte zur Konfliktlösung auf lokaler, regionaler und globaler Ebene. Oft ist es gar nicht notwendig, den Umweg über globale Verhandlungsprozesse zu gehen, denn viele Probleme und Konflikte tauchen auf der lokalen oder regionalen Ebene auf und können auch nur dort gelöst werden. Umgekehrt kann eine erfolgreiche Durchsetzung solcher Konzepte Ausstrahlungseffekte auch auf die globale Ebene haben und dazu beitragen, Mehrheiten zu finden, ggf. auch ohne die USA.
Grundsätzlich ist zur dauerhaften Problemlösung der »präventive Politiktyp«, der durch Limitations- und Absorptionsstrategien auf Konfliktvermeidung zielt, besser geeignet als der»reaktive Politiktyp«, dem es im wesentlichen um eine Anpassung an die oder Reparatur der veränderten Umweltbedingungen geht. Das integrierte Konzept einer nachhaltigen Ressourcennutzung, das sich präventiv darum bemüht, die Konfliktursachen auszuschließen (durch Ressourceneinsparung, Effizienzsteigerung, angepasste Technologien, Beseitigung der Asymmetrien, Verbesserung der Kooperation, Änderung der Lebensweise, Dialog und Partizipation von Stakeholdern und Betroffenen),ist somit ein Beitrag zur Friedenssicherung.
Anmerkungen
1) Siehe weiter H. Leitschuh-Fecht, P. Stephan: »Rio + 10«. Der Count-down läuft!, in: G. Altner, et.al. (Hrsg.): Jahrbuch Ökologie 2002, München, Beck, 2001, S. 64-76.
2) Eine kritische Auseinandersetzung mit Weltumweltkonferenzen gibt H. Scheer: Klimaschutz durch Konferenzserien: Eine Fata Morgana, Blätter für deutsche und internationale Politik, 9/01, S. 1066-1073.
3) Lomborg, Björn: The scepticel environementalist, Cambridge University Press, 2001.
4) IPCC: Climate Change 2001, Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2001. Zusammenfassungen aller drei Berichte finden sich unter http://www.ipcc.ch. Die Folgen des Klimawandels und mögliche Anpassungsmöglichkeiten für die Europäische Union (EU) wurden untersucht in: M-L. Parry (Ed.): Assessment of Potential Effects and Adaptations for Climate Change in Europe: The Europe ACACIA Project. Jackson Environment Institute, University of East Anglia, Norwich, UK, 2000, Summary and conclusions unter www.jei.uea.ac.uk/projects/acacia_report.htm.
5) Potential Uses of Military-Related Resources for Protection of the Environment, Disarmament Study Series No. 25, New York, United Nations, Office for Disarmament Affairs, A/46/364, 1993. Eine Zusammenfassung findet sich in J. Scheffran, Panzer gegen die ökologische Krise?, Spektrum der Wissenschaft, Oktober 1992, 128- 132.
6) Siehe weiter J. Scheffran: Militärs an die Ökofront? Umweltpolizist USA, Wissenschaft und Frieden, 15. Jg., 4/97, S. 42-46; Abdruck in: Frankfurter Rundschau, Dokumentation, 20.4.98.
7) New Europe, 10th Year, No.473, June 16-22, 2002, http://www.new-europe.info/September2001.htm.
8) Siehe etwa die Stellungnahme von US Senator John F. Kerry, Energy Security is American Security, Washington: Center for National Policy, January 22, 2002. Zur Debatte über Energiesicherheit sei verwiesen auf: A. Makhijani, Securing the Energy Future of the United States: Oil, Nuclear, and Electricity Vulnerabilities and a post-September 11, 2001 Roadmap for Action, Washington: IEER, November 2001; A. Makhijani, The Cheney Energy Plan: Technically Unsound and Unsustainable, IEER, Sept.100, 2001.
9) D. Bimboes: Zündstoff Öl und Gas, Dossier 34, Wissenschaft und Frieden, 1999; A. Bozdag: Um Öl und Gas. Internationale Konfliktlinien im Kaukasus und in der kaspischen Region. In: Blätter für deutsche und internationale Politik,5/96, S. 587-597.
10) J. Scheffran: Leben bewahren gegen Wachstum, Macht, Gewalt – Zur Verknüpfung von Frieden und nachhaltiger Entwicklung, Wissenschaft und Frieden, 3/96, S. 5-9; J. Scheffran, W. Vogt (Hrsg.): Kampf um die Natur – Umweltzerstörung und die Lösung ökologischer Konflikte, Darmstadt: WBG / Primus, 1998.
Dr. Jürgen Scheffran ist Mitarbeiter am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und Redakteur von W&F