Birge Krondorfer, Irmtraud Voglmayr (Hrsg.) (2025): Krieg und Friedensbewegung: Feministische Perspektiven. Wien: Mandelbaum Verlag. ISBN 978-3-9913-6516-7, 210 S., 23 €.
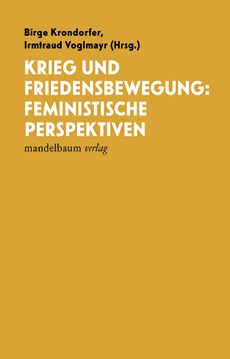
Der von Birge Krondorfer und Irmtraud Voglmayr herausgegebene Sammelband versteht sich als dringlicher feministischer Beitrag zu einer Debatte, die angesichts globaler Kriegs- und Gewaltverhältnisse aktueller nicht sein könnte: Wie lässt sich Friedenspolitik jenseits militärischer Logik denken? Der Band vereint Stimmen aus Wissenschaft, Aktivismus und Praxis und überzeugt durch eine klare Struktur: historische Perspektiven, aktuelle Analysen und theoretische Reflexionen treten in produktiven Dialog miteinander. Der Band zeigt auch, dass Feminismus als Analyse- und Handlungskategorie in der Friedensarbeit unverzichtbar ist – gerade in Zeiten globaler Gewalt ist das keine akademische Übung, sondern eine politische Notwendigkeit.
Der erste Teil des Bandes entfaltet ein Panorama feministischer Friedensarbeit im historischen Längsschnitt – von Bertha von Suttner, die von Adelheid Pichler als radikale Vordenkerin einer Politik der Abrüstung und Kooperation porträtiert wird (vgl. S. 21-30), über die Gründung der »Women’s International League for Peace and Freedom« (WILPF) 1915, als sich der antimilitaristische Kampf gegen Krieg mit feministischen Forderungen nach Demokratie, Frauenrechten und Antikolonialismus verband (vgl. S. 31-40), bis zu den Frauenfriedensbewegungen der Nachkriegszeit, die sich der Wiederbewaffnung und atomaren Aufrüstung entgegenstellten (vgl. S. 41-51). Mit der Neugründung der österreichischen WILPF-Sektion 2021 schlägt Rosa Logar schließlich den Bogen zur Gegenwart (vgl. S. 52-61) und zeigt, dass aktuelle Debatten ohne ihre historischen Wurzeln schwer einzuordnen sind.
Die historische Perspektive zeichnet die Genese feministischer Friedensbewegungen in Deutschland und Österreich nach und liefert damit den notwendigen Kontext für aktuelle Auseinandersetzungen. Zugleich macht sie sichtbar, dass die Geschichte hier vor allem aus europäischer Perspektive erzählt wird – eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, die Geschichte des Friedens internationaler zu denken.
Der zweite Teil des Bandes führt diese historischen Linien in die Gegenwart. Beiträge zu Russland und der Ukraine, zu feministischen Protesten unter autoritären Regimen, zu Solidarität oder zu Palästina und Israel zeigen, wie feministische Friedensarbeit an frühere Anliegen anknüpft und gleichzeitig neue Antworten sucht.
Heidi Meinzold eröffnet diesen Teil mit der Frage, was Pazifismus angesichts eines Angriffskrieges bedeutet, und fragt, wie sich an einer Vision gewaltfreien Friedens festhalten lässt, wenn militärische Gewalt unausweichlich scheint. Sie zeigt, wie tief die Bewegung zwischen Abrüstung und Solidarität mit der Ukraine gespalten ist und wie nötig neue Strategien sind, um der schleichenden Normalisierung von Krieg entgegenzutreten (vgl. S. 65-74).
Daran knüpft Olga Shparaga an, die die Frage nach der Legitimität von Gewalt neu verhandelt. Im virtuellen Dialog mit einem Manifest ukrainischer Feministinnen verteidigt sie das Recht auf bewaffneten Widerstand unter Bedingungen existenzieller Bedrohung. Gewalt, so ihre These, kann Teil feministischer Praxis sein, wenn sie dem Schutz von Leben dient. Gewaltfreiheit und bewaffneter Widerstand markieren bei ihr die Pole eines Spannungsfeldes legitimer feministischer Handlungsoptionen. (vgl. S. 75f.)
Wenn Gewalt und Widerstand feministisch neu verhandelt werden, stellt sich zwangsläufig auch die Frage, wie man die Frauenbeteiligung an militärischen Strukturen bewertet. Alena Strelnyk (vgl. S. 86-95) deutet die wachsende Zahl von Frauen in den ukrainischen Streitkräften als Symbol struktureller Gleichstellung: „Für ukrainische Frauen ist der Dienst in den Streitkräften ein Recht, für das ein Teil der liberalen feministischen Bewegung lange gekämpft hat“ (S. 88). Doch das eröffnet ein altes Spannungsfeld: Bedeutet »Gleichberechtigung« auch Teilhabe an Gewalt – oder liegt feministische Kraft gerade in der Verweigerung dieser Logik? Der Band erinnert daran, dass frühere Frauenfriedensbewegungen eine Integration in militärische Institutionen entscheidend ablehnten, weil sie darin keine Gleichstellung, sondern eine Normalisierung von Militarismus sahen (vgl. den Beitrag von Notz, S. 48). Offen bleibt jedoch, inwieweit sich diese Nachkriegslogik aus Westdeutschland auf die heutige Ukraine übertragen lässt.
Marina Menchikovas Beitrag über den russischen Frauenprotest gegen den Krieg (vgl. S. 96-105) zeigt, wie Aktivist*innen des »Feministischen Antikriegswiderstandes« trotz Repression kreative und mutige Formen des Widerstands entwickeln. Gerade hier wird jedoch ein weiteres Spannungsfeld sichtbar: die Frage nach der Möglichkeit und den Grenzen feministischer Solidarität unter Bedingungen tiefgreifender politischer Polarisierung. Dass es bislang keinen gemeinsamen Handlungsraum zwischen russischen und ukrainischen Feminist*innen gibt, verweist auf eine dieser schmerzhaften Bruchstellen: Die politischen Frontlinien des Krieges verlaufen mitten durch die feministische Bewegung. Umso bemerkenswerter ist daher Isabel Freys Beitrag über »Standing Together Vienna« (vgl. S. 106-115), eine Initiative palästinensischer und jüdischer Aktivist*innen, die trotz tiefer politischer und emotionaler Gräben Musik als Sprache des Friedens nutzen und so die Räume für Begegnung schaffen.
Der berührendste Beitrag des Bandes stammt von Nadine Sayegh (vgl. S. 125-133), einer in Wien lebenden Palästinenserin, die ihre Erfahrungen während des Gaza-Krieges reflektiert. Ihr Essay öffnet eine intime Dimension feministischer Friedensarbeit – die innere Auseinandersetzung mit Identität, Verantwortung und Ohnmacht. Sie lässt uns spüren, wie sich politische Gewalt ins Private einschreibt. Der Krieg ist nicht nur dort draußen, er ist auch in uns (vgl. S. 128). Ihr Essay ist eine Friedensbotschaft, die daran erinnert, dass Friedensarbeit nicht nur in politischen Arenen stattfindet, sondern auch im Inneren – im Ringen mit Schmerz, Identität und Handlungs(un)fähigkeit.
Der dritte Teil liefert das theoretische Werkzeug, das historische Linien und aktuelle Spannungsfelder feministischer Friedensarbeit zusammenführt. Patricia Konrad zeigt, dass feministische Friedens- und Konfliktforschung die epistemologischen Grundlagen klassischer Friedensforschung infrage stellt. Begriffe wie Sicherheit, Gewalt und Frieden müssen neu vermessen werden: Frieden ist dabei kein Zustand nach dem Krieg, sondern ein Prozess, der strukturelle Ungleichheit aktiv transformiert. In diesem Verständnis bedeutet Frieden nicht militärische Stabilität, sondern Schutz vor struktureller und symbolischer Gewalt – vor Armut, Diskriminierung und Ausschluss (S. 147-156). Diese Neuausrichtung wird im Band durch diverse Perspektiven konkretisiert: von der »langsamen Gewalt« militärischer Umweltzerstörung über die Verflechtung von Neoliberalismus, Autoritarismus und patriarchaler Männlichkeit bis zu Analysen von Körperpolitik, Medienmilitarisierung und sexualisierter Gewalt als kolonialem Herrschaftsinstrument.
Der Band macht somit deutlich, dass feministische Friedenspolitik sich in einem kontinuierlichen Prozess der Selbstverhandlung befindet. Gerade diese Vielstimmigkeit ist die Stärke des Bandes. Besonders wertvoll ist, dass er Widersprüche nicht glättet, sondern produktiv macht. Zugleich zeigt sich, wo die Grenzen feministischer Friedensforschung im deutschsprachigen Raum derzeit verlaufen: Die Perspektiven bleiben weitgehend im europäischen Kontext verankert, und Stimmen aus dem Globalen Süden, aus marginalisierten oder queeren Kontexten treten nur vereinzelt auf. Eine stärkere Pluralisierung feministischer Friedensdebatten – als Dialog zwischen unterschiedlichen historischen Erfahrungen und Wissensordnungen – hätte den Anspruch des Bandes noch vertieft.
Doch gerade in dieser Lücke liegt auch ein Impuls: für Selbstreflexion, Öffnung und Erweiterung feministischer Friedensarbeit über nationale und eurozentrische Grenzen hinaus. In einer Zeit, in der Militarismus als alternativlos gilt und Pazifismus als weltfremd abgetan wird, erinnert der Band daran, dass eine andere Politik möglich ist: eine, die auf Fürsorge und Solidarität setzt. Diese Vision mag utopisch erscheinen, doch gerade darin liegt ihre Kraft. Schon Bertha von Suttner wusste, dass Friedenskämpfer*innen „Optimistinnen sein müssen“, weil ihre Praxis untrennbar mit Hoffnung verbunden ist (vgl. Beitrag von Pichler, S. 29). Diese Hoffnung zieht sich wie ein roter Faden durch alle Beiträge – und macht »Krieg und Friedensbewegung – Feministische Perspektiven« zu einem wichtigen Beitrag für wissenschaftliche Debatten und politische Praxis.
Elena Smirnova ist Doktorandin am Institut für Internationale Entwicklung der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der feministischen Friedensforschung, Antimilitarismus und in dekolonialen Ansätzen.


