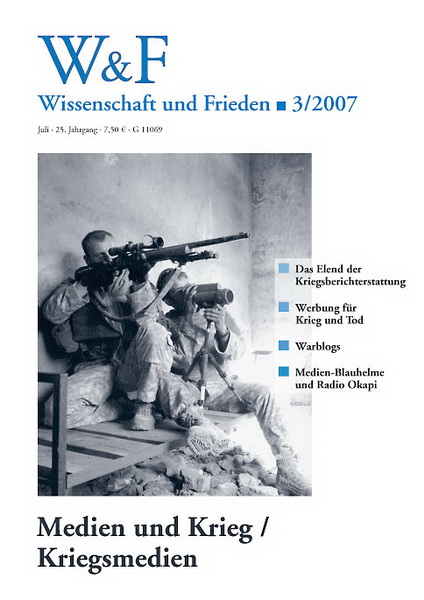Krieg und Medien
von Fabian Virchow
Täglich erreichen uns Nachrichten und Bilder von der Zuspitzung des Bürgerkrieges im Irak, von Selbstmordattentaten und militärischen Operationen der US-Armee. Dass auch in dieser Situation das Gros der irakischen Bevölkerung einen Kampf um das alltägliche Überleben führt, und dass es neben den eingangs erwähnten, die Berichterstattung dominierenden Meldungen auch andere gesellschaftlich bedeutsame Entwicklungen gibt, verschwindet dabei häufig. Auch wenn die an diesem Selektionsprozess beteiligten Agenturen, Fotografen und Journalisten in bester Absicht darum bemüht sind, den Konflikt abzubilden, so tragen sie doch zu einer spezifischen Lesart der Situation im Irak, ihrer Ursachen und möglichen zukünftigen Entwicklungswege bei.
Zwar ist in der Vergangenheit anhand so mancher symbolischen Handlung, wie etwa dem Sturz einer Saddam-Statue in Bagdad, durch eine kritische Recherche deren inszenierter Charakter und die Rolle der Medien in diesem Schauspiel deutlich geworden, hinsichtlich der uns alltäglich angebotenen Deutung von Konflikten in der Mediengesellschaft ist jedoch die von Fernsehzuschauerinnen und Zeitungslesenden aufzubringende Dekonstruktionsleistung erheblich größer. Die These, dass das erste Opfer des Krieges die Wahrheit ist, scheint plausibel, erfordert von den Medienkonsumenten jedoch eine besonders hohe Reflektionsleistung, denn es bleibt schließlich die Frage zu beantworten, welcher Nachricht tatsächlich zu trauen ist.
Ohne Zweifel haben die Medien selbst in den vergangenen Jahren ihre eigene Rolle in Krisen- und Kriegssituationen auch kritisch thematisiert. Dies gilt etwa für die Berichterstattung im Vorfeld des Angriffs auf den Irak im Jahre 2003. Dennoch halten noch immer beträchtliche Teile der Bevölkerung in den USA die von der Bush-Administration vorgebrachten Kriegsgründe für plausibel. Und leider schließt eine kritische Bewertung der eigenen Berichterstattung für die Zukunft nicht aus, dass ein Großteil der Medien erneut dem »Rally ’round the flag«-Effekt erliegen wird.
Diese Gefahr besteht selbstverständlich nicht nur in den USA, sondern – wie die Kriege »auf dem Balkan« gezeigt haben, auch in den europäischen Gesellschaften. Dies mag angesichts der Diskussionen um das »embedding« von Journalisten in Einheiten der US-Armee etwas in den Hintergrund getreten sein; Versuche des Militärs, die Berichterstattung der Medien zu kontrollieren, hat es zu allen Zeiten und an allen Orten gegeben. Die dabei von den »Öffentlichkeitsarbeitern« und PR-Spezialisten der Streitkräfte verfolgten Strategien variieren nach politischer Kultur, historischen Erfahrungen sowie den individuellen Einstellungen der (damit befassten) Soldaten. Auch eine offene Informationspolitik, wie sie von manchen in der Bundeswehr gefordert und praktiziert wird, hat ihre – nicht notwendig in der militärischen Geheimhaltung liegenden – Grenzen. Und im Grundsatz folgt sie häufig der Maxime, dass es zielführender ist, die Journalisten mit Informationen zu versorgen statt darauf zu warten, dass diese von selbst und zu Fragen recherchieren, bei denen die Bundeswehr lieber keine Öffentlichkeit möchte.
Auch wenn die Anzahl wissenschaftlicher Studien zur Berichterstattung von Medien in Konflikten und Kriegen in den vergangenen Jahren zugenommen hat, so finden sich darunter viele, die lediglich die Berichterstattung einzelner Zeitungen oder das »framing« in wichtigen TV-Sendungen analysieren, hinsichtlich der gesellschaftstheoretischen Einbettung ihrer Befunde jedoch blass bleiben. Bereits ein grober Überblick über die Forschungslandschaft zeigt, dass insbesondere Medien in West-Europa und Nordamerika zum Gegenstand der Forschung werden; bezüglich der asiatischen und osteuropäischen Gesellschaften bleiben die einschlägigen Disziplinen defizitär. Und für zahlreiche Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent lassen sich so gut wie keine Forschungsergebnisse finden, obwohl auch dort Medien – wenn auch nicht in erster Linie Printmedien – eine herausgehobene Stellung in den Verfeindungsprozessen zukommt.
Für die Friedensforschung besteht nicht nur hinsichtlich der Rolle von Medien in bisher wenig beachteten Konflikten weiterhin erheblicher Handlungsbedarf, sondern auch bezüglich personaler oder struktureller Verschränkungen medialer bzw. kultureller Angebote mit Protagonisten des Militärs bzw. – im weiteren Sinne und angesichts eines »erweiterten Sicherheitsbegriffs«– der Sicherheitsbehörden bzw. ihrer privaten »Counterparts«.
Auch wenn die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland aufgrund historischer Umstände und einer geringeren ökonomischen Potenz der Filmindustrie noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in den USA, wo die US-Streitkräfte eine eigene Stabsstelle zur Prüfung von Drehbüchern unterhalten, so lässt der fortgesetzte Einsatz von Bundeswehrverbänden doch vermuten, dass »die Bundeswehr« über bereits existierende massenkulturelle Angebote wie »Die Rettungsflieger«, »Sonja wird eingezogen« oder »Das Kommando« hinaus zum Gegenstand von Spielfilmproduktionen oder Doku-Soaps wird. Welche Erzählungen dabei präsentiert und welche Assoziationen, Bilder und Werte dabei angerufen werden, können weder der Friedensforschung noch der Friedensbewegung gleichgültig sein.
Fabian Virchow