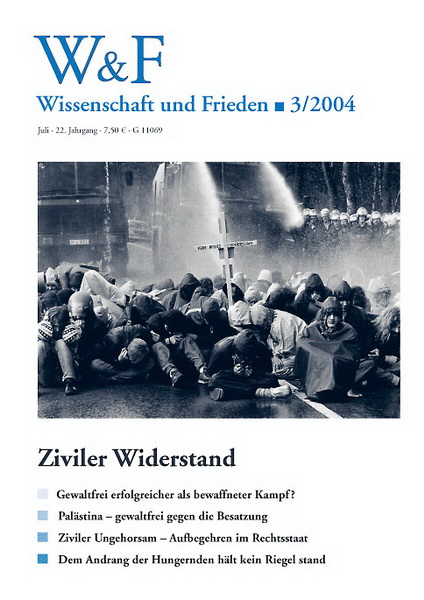Kritische Wissenschaft und Friedensbewegung
Soziologische Selbstreflexion zur Stärkung der Bewegung
von Lars Schmitt
Mit seinem Beitrag in der ersten Ausgabe von Wissenschaft und Frieden 2004 präsentierte Dieter Rucht die sozialstrukturelle Zusammensetzung der Berliner Friedensdemonstration vom 15. Februar 2002. In W&F 2-04 unterzog Peter Strutynski die Befragung und ihre mediale Aufbereitung einer kritischen Betrachtung. Lars Schmitt setzt die Diskussion fort. Sein Plädoyer: Die Ergebnisse dieser Analyse als Ausgangspunkt für eine tiefere soziologische Reflexion nutzen, die emanzipatorischen Bewegungszielen nicht gegenübersteht, sondern diese fördert.
Der Beitrag von Dieter Rucht, der sich mit der sozialstrukturellen Zusammensetzung der Berliner Friedensdemonstration vom 15. Februar 2002 befasst, wurde vom Herausgeber mit den Worten eingeleitet, eine wissenschaftliche Objektivierung ginge notwendigerweise immer mit einer „Distanzierung von diesem Prozess“ des Protestierens einher und „Regierenden [würde] möglicherweise neues »Herrschaftswissen« geliefert“. Andererseits böte diese Distanzierung Möglichkeiten der „Selbstreflexion im Interesse der eigenen Aktivierung und Effektivierung.“ Die Notwendigkeit einer soziologischen Selbstreflexion soll mit dem vorliegenden Beitrag verdeutlicht werden. Dabei stellt sich als andere Seite der Medaille aber nicht die Lieferung von Herrschaftswissen an Regierende heraus. Vielmehr geht es darum, eine Bewusstheit der Eingebundenheit von kritischer Wissenschaft und sozialer Bewegung in »Herrschaft« zu erlangen, die dann dazu dienen kann, beide emanzipatorischer und anschlussfähiger zu gestalten und den selbst gestellten Ansprüchen gerechter zu werden. Sowohl der Bedarf als auch die Skizze einer soziologischen Selbstreflexion lässt sich gut an dem Beitrag von Dieter Rucht und der entsprechenden kritischen Reaktion von Peter Strutynski entwickeln.
Heterogen in der medialen Darstellung und im Erscheinungsbild entpuppt sich die neue Friedensbewegung – so Dieter Rucht – doch als das klassische Bevölkerungssegment der neuen sozialen Bewegungen der 80er Jahre (vgl. dazu Brand/Büsser/Rucht 1986, 217 f.): weit überdurchschnittlich gebildet, politisch links, tendenziell im sozialen Dienstleistungssektor im weitesten Sinne tätig. Damit repräsentiert sie nicht breite Bevölkerungsschichten, die politische Mitte fehlt. Grundlage für diese Argumentation bietet die Auswertung der ersten 781 von 1430 Fragebögen, die nach dem Zufallsprinzip an Berliner Demonstrierende des 15.2.03 verteilt wurden. Daraus kann man ableiten, dass sich hier nicht die »sozial Abgebautesten« mobilisieren. Dieser »quantitativen« Darstellung setzt Peter Strutynski in Heft 2-2004 eine »qualitative« entgegen. Es sei, so Strutynski, keine Überraschung, dass sich die Friedensproteste sozialstrukturell so darstellen. Es gebe große Bevölkerungsteile, denen das Instrument des Demonstrierens fern liege. Dies bedeute aber nicht, dass die Proteste nicht repräsentativ seien. Im Gegenteil: ebenso große Bevölkerungsanteile – nicht nur in Deutschland, sondern auch in den am Krieg direkter beteiligten Staaten – lehnten bekanntlich den Krieg ab.
Sind diese Demonstrationsszene und die dazu vorgelegten Interpretationen nun ein Indiz für den Protestwunsch breiter Bevölkerungsteile oder für den Protest einer »sozialen Elite«?
Die Antwort lautet: Beides – und führt uns zu einer weiteren Frage, die vielleicht eine wichtigere Verbindung von Friedensbewegung und soziologischer Beobachtung thematisiert. Viele Menschen erfahren ein „alltägliches Leiden an der Gesellschaft“ (Bourdieu 1997) und haben Gründe zu protestieren. Dieses Leiden äußert sich bestenfalls in »Stimmungsbildern«, wird aber nur bei bestimmten Anlässen von einem bestimmten Bevölkerungssegment in eine als »sozialer Protest« wahrnehmbare Form umgesetzt. Woran liegt das? Oder – um es plakativ abzubilden – anders gefragt: Warum scheint der Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, Rudi Völler, mehr Menschen aus der Seele zu sprechen als Namensvetter Dutschke? Mein Deutungsangebot ist: Völler hat mit seinem »Ausbruch« gegenüber dem Sportjournalisten am 06.09.03 im Interview nach dem Länderspiel der Nationalmannschaft in Island den Konsensrahmen verlassen. Sowohl seine Wortwahl als auch die Intonation waren unüblich für dieses Setting. Damit hat er den »normalen Lauf der Dinge« kurzfristig unterbrochen. Dieser normale Lauf der Dinge – der Konsens – bedeutet aber die unhinterfragte Reproduktion des Gegebenen. Dieses Gegebene ist bekanntlich nicht neutral, sondern hierarchisch strukturiert. Chancen auf Lebensqualität (Bildung, Anerkennung, Einkommen etc.) sind sowohl global als auch auf nationalstaatlicher Ebene ungleich verteilt. Frauen haben geringere Chancen als Männer, Unterschichtkinder geringere als Akademikerkinder, Ausländer geringere als Deutsche etc. Als Beispiel dafür, dass dieses Wissen potentiell auch einer nicht-akademischen Öffentlichkeit zugänglich ist, sei die Diskussion um die Ergebnisse der PISA-Studie genannt. Der Stern titelt sogar: „Das Märchen von der Chancengleichheit“ (Stern Heft 30-2003). Die Wirkungsmächtigkeit dieses Märchens besteht darin, dass die Ungleichheit der Chancen als naturgegeben vermittelt, erlebt und durch Konsensverhalten reproduziert wird. Die unhinterfragte Reproduktion von Gesellschaft und damit der ungleichen Chancenverteilung erfährt durch das unkonforme Verhalten von Völler einen Bruch. Dies ist ein Grund für die wahrnehmbare Solidarität mit Völler, weil der normale, aber dennoch für viele benachteiligende Gang der Dinge punktuell außer Kraft gesetzt wird. Ein anderer Grund liegt darin, dass Völler – obwohl er sicherlich nicht zu den sozial Abgebauten zählt – in dieser emotionalen Situation seinen Habitus, d.h. seine soziale Herkunft »von unten« nicht verborgen hat und damit viel eher als Sprachrohr zumindest von Angehörigen der Unterschicht wahrgenommen wird als z.B. Rudi Dutschke. Was will diese Beschreibung zeigen? Sie soll einen bislang wenig berücksichtigten Zusammenhang zwischen kritischer Wissenschaft und Friedensbewegung ins Blickfeld rücken. Beide sind Teil einer hierarchisierten Gesellschaft und beide sind hierbei nicht »unten« anzusiedeln. Daher können beide nicht davon ausgehen, von unter den bestehenden Verhältnissen leidenden Menschen als emanzipatorische Medien oder als Sprachrohr wahrgenommen zu werden, obwohl sie dies vielleicht sogar aufgrund der emanzipatorischen Inhalte de facto sind. Wer sich traut, öffentlich die Stimme (oder das Plakat) zu erheben, wird als »legitim«, als privilegiert eingestuft und ist dies in der Regel ja auch (vgl. Bourdieu 1992, 174 ff.). Zudem haben – wie alle anderen Akteurinnen und Akteure – auch diejenigen des akademischen Feldes und sozialer Bewegungen die kritisierten hierarchischen Strukturen gesellschaftlichen Zusammenlebens verinnerlicht. Das heißt, dass diese Strukturen sogar auf einer körperlichen Ebene (Erfahrung) zwangsläufig zu einer »eigenen Selbstverständlichkeit« geworden sind. Das bedeutet nichts anderes, als dass eine Kritik des Gegebenen – von wem auch immer geäußert – eine Reflexion des Gesellschaftsgefüges und der eigenen Position darin und vor allen Dingen ein Bewusstsein über die Verinnerlichung dieser Position beinhalten muss, will sie nicht nur „eine Manifestation des Mehrheitswillens der Bevölkerung“ sein – wie Peter Strutynski die Demonstrationen gegen den Irakkrieg wertet –, sondern eine Manifestation der Mehrheit. Das ist leider ein großer Unterschied, der Emanzipatorisches dort suggeriert, wo aber eben auch unausgesprochene Machtverhältnisse sind. Wenn eine Gruppe von Menschen das äußert, was viele gerne hätten, heißt das noch lange nicht, dass diese Gruppe als Sprachrohr »der Bevölkerung« wahrgenommen wird. Im Gegenteil kann gerade dadurch, dass allzu leicht von der Gemeinsamkeit der Wünsche (»Nicht diesen Krieg«) auf eine Sprachrohrfunktion geschlossen wird, ein wirkliches Problem verschleiert werden. Es ist alles andere als unplausibel anzunehmen, dass Menschen sogar bei einer Befragung zugestehen würden, dass das, was eine soziale Bewegung öffentlich anprangert, eine Manifestation ihrer eigenen Meinung sei. Dies ändert aber nichts daran, dass von den gleichen Personen gleichzeitig diese Bewegung als eine Gruppe von Menschen wahrgenommen wird, die privilegierter sind als sie, die Befragten, selbst. Durch die empirisch erfassbare Gemeinsamkeit der geäußerten Anliegen gerät das aus dem Blickfeld, was nicht gemeinsam ist. Das entspricht dann keiner adäquaten Abbildung von sozialer Wirklichkeit mehr und es läuft emanzipatorischen Zielen zuwider, weil eine Gemeinsamkeit in der Kritik gegebener Verhältnisse, nur dann erzeugt werden kann, wenn man sich der Unterschiedlichkeiten bewusst wird und nicht eine gemeinsame Oberfläche schon für eine gemeinsame Lage hält. Warum muss es aber so kompliziert sein? Warum kann es nicht einfach so sein – und das wäre so schön –, dass eine Gruppe von Menschen das äußert, was viele denken und damit ein kritischer Zeitgeist zum Ausdruck gebracht wird?
Dies liegt an der Tatsache, dass es nicht gleich verteilt ist, sich legitimiert zu fühlen, die eigene Stimme zu erheben. Und mehr noch: diese Unterschiede in der Gesellschaft sind hierarchisierte Unterscheidungen, das heißt sie sind sichtbar, werden erkannt und anerkannt. Wenn man z.B. eine Rentnerin aus einem Arbeitermilieu mit der Aussage eines streikenden Studenten konfrontiert, die eine Forderung nach Abrüstung statt Sozialabbau beinhaltet, dann kann die Rentnerin dem möglicherweise zustimmen. Wird sie aber mit diesem Studenten direkt konfrontiert, nimmt sie ihn möglicherweise als eine Person wahr, die vieles hat, was ihr versagt geblieben ist: Er hat Zeit zu protestieren; Mut (eventuell sogar als Respektlosigkeit wahrgenommen) den Mund aufzumachen etc. Kurzum: Sie nimmt ihn als privilegiert wahr und nicht als Träger eines gemeinsamen Anliegens. Und sie empfindet dies möglicherweise als normal und nimmt es hin.
Was macht diese Analyse plausibel, wo ist dieses Problem zu verorten und wie ließe es sich angehen?
Dass definierbare Chancen in der bundesdeutschen Gesellschaft nach verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten ungleich verteilt sind, ist kein Geheimnis. Sucht man dieses Problem allein auf der Ebene der Verteilung, d.h. der Strukturen, dürfte die Rentnerin gar nicht wahrnehmen, dass dieser Student privilegiert ist, da sie – dies ist banal – keine Struktur vor sich hat, sondern einen Menschen. Die ungleiche Chancenverteilung muss also irgendwie an den Menschen ablesbar sein. Sucht man umgekehrt das Problem nur auf der Ebene der Akteurinnen und Akteure, wäre es gar nicht vorhanden, weil dann ja jeder Mensch einfach seine Anliegen gleichberechtigt äußern könnte. Der Schlüssel liegt darin, dass alle gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure die Verhältnisse, die sie vorfinden, verinnerlichen. Diese »lebendigen Strukturen« sind das, was Pierre Bourdieu Habitus nennt (vgl. Bourdieu 1974, 1982, 1987 sowie Krais/Gebauer 2002). Wir wachsen in einer bestimmten Umgebung mit bestimmten Eltern, in einem bestimmten Milieu, mit einer bestimmten Geschlechterzuweisung etc. auf. Wenn wir uns in der Umgebung bewegen und zurechtfinden, verinnerlichen wir sie. Dies ist nicht in erster Linie ein kognitiver Prozess, sondern geschieht v.a. auf der Basis von Erfahrungen (d.h. körperlich). Die Umgebung wird mit unserer Erkundung also ein Stück von uns selbst. Dennoch sind wir diejenigen, die diese Selbstwerdung aktiv produzieren, indem wir uns in bestimmten Umgebungen bewegen, lernen und uns selbst aktiv weitere Umgebungen suchen. Dabei bevorzugen wir aber diejenigen, die nahe bei dem sind, was wir bisher verinnerlicht haben. Mit diesem Habituskonzept lässt sich also erklären, warum Strukturen sich immer auch als Unterschiede in Menschen manifestieren und zu sichtbaren Unterscheidungen (Identitäten) werden. Dabei wird deutlich, dass Gesellschaft und Individuum sich nicht gegenüberstehen, sondern soziale und personale Identität zusammenfallen. Da nun aber das, was Menschen in ihrer Wirklichkeit vorfinden, sehr dem ähnelt, was ihre »Identitäten« ausmacht – weil diese ja aus besagter Wirklichkeit hervorgegangen sind –, wird das soziale Gefüge in der Regel als stimmig, normal, selbstverständlich erlebt. Dies erklärt, warum selbst Menschen, die von der Ungleichverteilung von Chancen negativ betroffen sind, an der Reproduktionen ihrer eigenen Unterdrückung mitwirken. Die Sozialpsychologie spricht hier von „oppression as a cooparative game“ (Sidanius/Pratto 1999). Dies bietet auch eine Erklärung dafür, dass die Rentnerin das von ihr wahrgenommene Gefüge hinnimmt, weil es zu ihr selbst passt.
Damit wird deutlich, warum eher nach der Transformation von Bewegungshandeln »nach oben« in institutionalisierte Politik gefragt wird (vgl. z.B. Raschke 2003), als nach einer Übersetzung »nach unten«. Die Hierarchie ist anerkannt.
Die emanzipatorische Wirksamkeit von Protest wird also konterkariert durch einen unsichtbar gemachten Chancenverteilungskonflikt. Diese Unkenntlichmachung wird verstärkt und damit die Wirksamkeit weiter gebremst, wenn die ungleiche Verteilung von Chancen sich hinter einer Gleichheit von Meinungen verstecken kann. Das also, was von Strutynski in Anschlag gebracht wird, um die Protestbewegung zu stärken – nämlich der Hinweis auf die Meinungsgleichheit zwischen Protestierenden und Bevölkerung –, bewirkt im Endeffekt eher das Gegenteil.
Weit davon entfernt eine fatalistische Aussage zu sein, kann diese soziologische Selbstreflexion dazu dienen, besagte Unkenntlichmachung rückgängig zu machen und damit nicht nur eine adäquatere Analyse gesellschaftlichen Zusammenlebens und sozialen Protests zu liefern, sondern – ohne normativ zu sein – eine größere Anschlussfähigkeit an Menschen herzustellen, die ein Anliegen haben, Bewegungsziele umzusetzen. Auf der Ebene von inhaltlichen Forderungen ist ein wichtiger anschließender Schritt ja bereits erfolgt, weil die Friedensbewegung z.B. nicht nur eine »abgerüstete europäische Verfassung« fordert, sondern dies mit einem sozialstaatlichen Anliegen verknüpft. Dies ist insofern als bedeutsam einzustufen, als Transnationalisierungsdiskurse einerseits und neoliberale Diskurse, die die Eigenverantwortung von Menschen für ihre Lage predigen, andererseits, eher dazu »einladen«, Protest auf die globale Weltordnung zu beziehen, als dazu, »in eigener Sache« soziale Gerechtigkeit zu fordern oder gar beides zusammen zu denken (vgl. Bonacker/Schmitt 2004).
Pierre Bourdieu hat seine Analysekonzepte, die in Form von »Wieder-Sichtbarmachung von Herrschaftsverhältnissen« auch gleichzeitig Praxiskonzepte sind, bereits selbst sowohl auf Wissenschaft als auch auf soziale Bewegung angewandt. So analysiert er z.B. an den Mechanismen männlicher Herrschaft, wie Gewalt symbolisch legitimiert und über den Gleichklang von inkorporierten und äußeren Strukturen sogar von den Beherrschten reproduziert wird. Eine Schlussfolgerung für soziale Bewegung am Beispiel der Frauenbewegung sei, dass diese – um ihr emanzipatorisches Potential und den »Scharfblick der Ausgeschlossenen« zu nutzen – ihr eigenes Denken dekonstruieren müsse, um männliches Denken zu dekonstruieren. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass auch Frauen die herrschenden Dominanzverhältnisse verinnerlicht haben (vgl. Bourdieu 1997a, 1997b, 1998a). Eine praktische Konsequenz war Bourdieus Bestreben, mit raisons d’agir (ders. 2001) eine in diesem Sinne aufgeklärte europäische soziale Bewegung zu begründen. In seinen Analysen zum akademischen Feld (ders. 1988) kommt er zu dem gleichen Ergebnis und zu der gleichen Forderung (ders. 1998b): Wissenschaft muss reflexiv sein, d.h. sie muss die eigenen Produktionsbedingungen und die eigene privilegierte Position reflektieren, will sie eine Aussage über ihren Gegenstand machen. Erst eine derartige Reflexion des eigenen Eingebundenseins in Herrschaft bietet zudem kritischer Wissenschaft die Möglichkeit, kritisch zu sein und sozialen Bewegungen die Möglichkeit, sozial zu sein, d.h. sich auf Menschen beziehen zu können, die unter gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen leiden.
Um es zusammenzufassen: Die Kritik von Peter Strutynski an der quantitativen, in Teilen tautologisch anmutenden Beschreibung und Interpretation der Berliner Friedensdemonstration vom 15. Februar 2003, wie sie Dieter Rucht vorgelegt hat, greift zu kurz, denn man hätte diese Verwissenschaftlichung von Selbstverständlichkeiten nutzen können, um diese Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Statt dessen begeht Peter Strutynski trotz seines qualitativen Herangehens einen positivistischen Fehler, in dem er aus der Gleichheit der Meinung von Demonstrierenden und „weiten Bevölkerungsteilen“ eine Einigkeit schließt und nicht auf eine sehr grundlegende Ungleichheit hinweist. Rudi D. darf eben nicht für Rudi V. gehalten werden, sondern die Habitus-Unterschiede von Protestierenden und weiten Bevölkerungsteilen müssen thematisiert werden, damit Rudi V.‘s beliebter Konsensbruch für emanzipatorische und von vielen auch befürwortete Inhalte Rudi D.‘s genutzt werden kann. Die inhaltlichen Gemeinsamkeiten der Rentnerin und des Studenten können erst dann die habituellen Unterschiede – und damit das Machtgefälle zwischen beiden – überbieten. Eine soziologische Beobachtung des Protests sollte – schon aus Gründen der Wissenschaftlichkeit – Phänomene an gesellschaftliche und verinnerlichte Strukturen zurückbinden, da sonst unter Vorspiegelung von Ungleichheiten als Gemeinsamkeiten emanzipatorisches Potenzial verschleudert wird und Sprachrohre ihr herrschendes Eigenleben führen.
Literatur
Bonacker, Thorsten und Lars Schmitt (2004): Politischer Protest zwischen latenten Strukturen und manifesten Konflikten. Perspektiven soziologischer Protestforschung am Beispiel der (neuen) Friedensbewegung, in: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen (i.E.).
Bourdieu, Pierre (1974): Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt a.M.
Ders. (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M.
Ders. (1987): Sozialer Sinn, Frankfurt a.M.
Ders. (1988): Homo academicus, Frankfurt a.M.
Ders. (1992): Rede und Antwort, Frankfurt a.M.
Ders. u.a. (1997): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz.
Ders. (1997a): Die männliche Herrschaft, in: I. Dölling und B. Krais: Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis, Frankfurt a.M., S. 153-217.
Ders. (1997b): Männliche Herrschaft revisited, in: Feministische Studien, H. 2, Jg. 15, S. 88-99.
Ders. (1998): La domination masculine, Paris.
Ders. (1998a): Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes, Konstanz.
Brand, Karl-Werner, Detlef Büsser und Dieter Rucht (1986): Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik, Frankfurt a.M. und New York.
Krais, Beate und Gunter Gebauer (2002): Habitus, Bielefeld.
Raschke, Joachim (2003): Bewegung, Reform, Protest. Blockaden und Veränderungen, Festvortrag anlässlich des 15jährigen Bestehens des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen vom 25.01.03.
Rucht, Dieter (2004): Die Friedensdemonstranten. Wer waren sie, wofür stehen sie? In: Wissenschaft und Frieden, Heft 1, 2004, S. 57-59.
Stern, Heft 30, 2003: Das Märchen von der Chancengleichheit.
Strutynski, Peter (2004): Friedensbewegung unter soziologischer Beobachtung, in: Wissenschaft und Frieden, Heft 2, 2004, S. 54-56.
Lars Schmitt ist Diplom-Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Konfliktforschung in Marburg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen: Konflikte und soziale Ungleichheit; sozialer Protest; soziologische Theorie; soziologische Konfliktmediation.