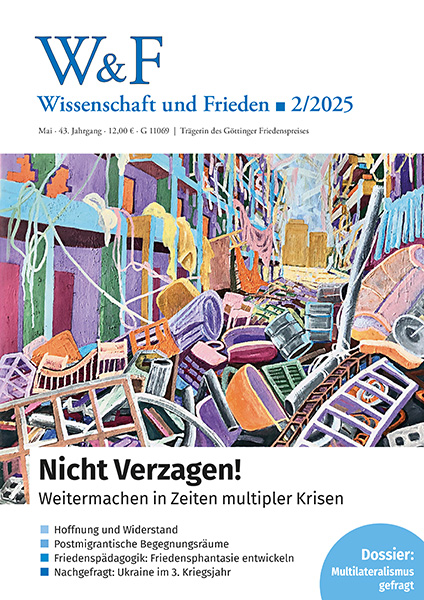Lebhaftes Ringen um den Frieden
Internationale Münchner Friedenskonferenz 2025, München, 14.-16. Februar 2025
Die Internationale Münchner Friedenskonferenz (IMFK25), die zivilgesellschaftlich organisierte Gegenveranstaltung zur Münchner Sicherheitskonferenz, fand vom 14. bis zum 16. Februar 2025 in München statt. Über 1.000 Menschen nahmen an den Veranstaltungen der Friedenskonferenz teil.
Das Auftaktprogramm der Friedenskonferenz am Freitagabend trug den Titel »Fundamente des Friedens – Das Friedensgebot des Grundgesetzes, die Friedenslogik und ihre Herausforderungen«. Der erste Beitrag zu diesem thematischen Dreiklang kam von Prof. Dr. Heribert Prantl, Rechtswissenschaftler, Journalist und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung, u.a. mit einem historischen Exkurs zum Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee im Jahr 1948. Im Anschluss sprach die emeritierte Professorin für Friedens- und Konfliktforschung (Universität Gießen) Prof. Dr. Hanne-Margret Birckenbach über Ideen dazu, wie und mit welchen Inhalten das Friedensgebot des Grundgesetzes gefüllt werden könnte. Dr. Kerem Schamberger, Referent für Flucht und Migration bei medico international, knüpfte als dritter Redner daran an und forderte hierzu: „Das Recht auf Bewegungsfreiheit zu verteidigen sehen wir als eine – vielleicht die zentrale – Aufgabe im Kampf gegen den weltweiten Autoritarismus. Es geht im Kern auch darum, ein demokratisches Europa zu verteidigen, das auf dem Universalismus der Menschenrechte fußt, Menschenrechte, die für alle gelten müssen.”
Am zweiten Tag der Konferenz richteten Francesca Albanese und Dr. Gershon Baskin unter dem Titel “Wege zur Gerechtigkeit – Völkerrecht und Dialog” den Blick auf den Krieg in Gaza. Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, sprach u.a. über den Vorwurf des Völkermords gegen Israel. Dass die israelische Regierung und ihre Verbündeten, insbesondere die deutsche Regierung, diesen Vorwurf so konsequent leugnen, führte sie auf eine mangelnde Anerkennung der Vergangenheit und des Fortwirkens von Ausbeutung, Kolonialismus und Imperialismus zurück. Während Albanese die deutsche Erinnerungskultur zum Holocaust zwar hervorhob, kritisierte sie, dass die geschichtliche und politische Aufarbeitung nicht vollständig oder hinreichend sei, da im gleichen Zuge das Recht auf Selbstbestimmung – in diesem Fall des palästinensischen Volkes – nicht anerkannt würde. Dieser Unwillen, grundlegende Herrschafts- und Machtverhältnisse anzuerkennen, führe dazu, dass bestimmte Verbrechen nicht gesehen würden. Francesca Albanese ordnete den Vorwurf des Völkermords gegen Israel damit in eine Reihe kolonialer Verbrechen ein und merkte an: „International law should be the cure to these horrors” – Das Völkerrecht sollte diese Schrecken heilen. Auffallend war, dass der Auftritt von Francesca Albanese starkes öffentliches Interesse an der IMFK25 erregte. Dies mochte der Tatsache geschuldet sein, dass ihre Auftritte im Vorfeld anderswo verhindert oder erschwert worden waren.
Albaneses Analyse, die bereits vor der hier genannten Konferenz in der deutschen Öffentlichkeit kritisch diskutiert worden war, wenn auch nicht immer mit der gebotenen Sachlichkeit, steht im Kontrast zu jener von anderen geladenen Referent*innen, wie Dr. Gershon Baskin. Er ist bekannt als Friedensaktivist und für seine Tätigkeit als Vermittler zwischen der israelischen Regierung und der Hamas. Gleich zu Beginn seines Beitrags auf der Münchner Friedenskonferenz stellte Baskin fest: „I have zero confidence in international law.” Dieses fehlende Vertrauen begründete er damit, dass die Mittel des Völkerrechts bisher kaum eine Wirkung hinsichtlich der Gewalt und der Verbrechen in Palästina und Israel entfaltet hätten. Darüber hinaus zeigte sich Baskin überzeugt, dass eine Lösung aus Palästina und Israel selbst kommen müsse. Der Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 sowie der darauffolgende Krieg und seine Verbrechen zeigten jedoch, warum eine solche Lösung so schwierig und gleichzeitig so dringend notwendig sei – könnten die Traumata auf beiden Seiten doch kaum größer sein. Für Israelis knüpften sie an, an das Trauma der Shoa, für Palästinenser*innen an das der Nakba.
In Folge der beiden Redebeiträge entwickelte sich eine bemerkenswerte Debatte um die Bedeutung und die reale Belast- und Anwendbarkeit des Völkerrechts in der Konfliktbewältigung. Auch über die asymmetrische Natur und die Unmöglichkeit einer militärischen Lösung des Konflikts wurde hitzig debattiert.
Entgegen stereotyper Bilder von Kriegsgegner*innen zeigte die Friedenskonferenz 2025 deutlich, dass ihre Debatten um Argumente und Methoden gegen Krieg und Menschenrechtsverbrechen ein diverses Meinungsspektrum abbilden und kontrovers geführt werden.
Julian Mühlfellner ist Co-Organisator der Internationalen Münchner Friedenskonferenz, Projektmitarbeiter am Helmut-Michael-Vogel-Bildungswerk e.V. und aktiv bei der DFG-VK München.