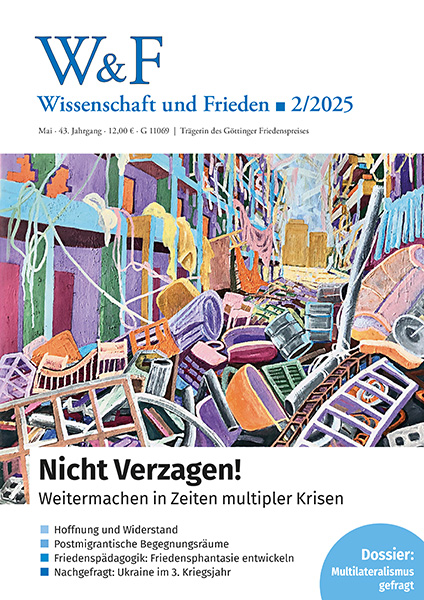Kohei Saito (2022): Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of Degrowth Communism. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-0093-6618-2, 250 S., 29,99 €.

Der japanische Ökomarxist Kohei Saito ist ein Phänomen. Beinahe über Nacht wurde seine ökonomische Utopie »How Degrowth Communism Can Save the Earth« weltbekannt (im Deutschen unter dem Titel »Systemsturz« veröffentlicht). Im Hintergrund blieb hingegen der Ende 2022 erschienene Band »Marx in the Anthropocene«. Dieser basiert auf der Intuition, Umweltbewegung und ein neu belebtes kommunistisches Projekt sollten als Postwachstumskommunismus zusammenfinden.
Saito will zeigen, dass eine solche Versöhnung von „Rot“ und „Grün“ (S. 172) in Anlehnung an das lange unveröffentlichte Spätwerk von Karl Marx möglich wird. Ein ehrgeiziges Projekt, das sich auch als Beitrag zu den Bemühungen versteht, Gerechtigkeit, Umweltschutz und Kapitalismuskritik – und somit Frieden konstituierende Elemente – zusammenzudenken (S. 4). Als Ausgangspunkt dient Saito eine plausible Beschreibung der Vielfachkrise menschlicher Gesellschaften im Anthropozän und eine Analyse der daraus resultierenden größeren Konfliktlinien. Hierzu legt Saito eine innovative Interpretation von Briefen und Notizheften des späten Marx vor, die in den letzten Jahren sukzessive vom MEGA-Online-Projekt (Marx-Engels-Gesamtausgabe) veröffentlicht wurden.
Saito will zeigen, dass die gegenwärtigen Debatten zum Anthropozän bzw. zum Mensch-Natur-Verhältnis von Marx vorweggenommen wurden und er die letzten Jahre seines Lebens damit verbrachte, seine Kapitalismuskritik zu erweitern. Neben den Klassenkampf trat die Analyse des zwischen Kapitalismus und den Kreisläufen der Natur bestehenden Konflikts, den er als »Stoffwechselriss« bezeichnete. Dieser durch die kapitalistische Akkumulationslogik erzeugte Riss im Stoffwechsel von Mensch und Natur galt ihm als weitere prägende Kraft gesellschaftlichen Wandels. Für Saito gilt es, anzuerkennen, dass sich die von Marx vorgelegte Modellierung des Mensch-Natur-Verhältnisses gegenüber vielen gegenwärtig diskutierten Ansätzen als überlegen erweise (Saito setzt sich hierzu intensiv etwa mit Jason W. Moores »world ecology«, dem »production of nature«-Ansatz von Neil Smith und Noel Castree und der »Akteur-Netzwerktheorie« Bruno Latours auseinander).
So habe Marx die konzeptionelle Grundlage für einen Postwachstumskommunismus gelegt, der davon ausgeht, dass die kapitalistische Gesellschaftsformation nicht bloß systematisch zwischenmenschliche Ausbeutung, sondern zugleich die Zerstörung gegebener ökologischer Kreisläufe bewirke. Marx habe daher schließlich – anders als Engels – das ursprüngliche Wachstumsdogma des historischen Materialismus angezweifelt (S. 182). Ausgehend von einem ontologischen Monismus erkenne Marx die grundsätzliche Unabhängigkeit der Natur vom Menschen (im Sinne des Hegelschen Nicht-Identischen, S. 92) an, analysiere das Mensch-Natur-Verhältnis jedoch mithilfe eines methodologischen Dualismus. Dies vermeide die sozialkonstruktivistische und letztlich anthropozentrische Marginalisierung der Eigenlogiken von Ökosystemen (welche gemäß Saito z.B. natürliche Grenzen als sozial konstruiert begreift), die in unserer Gegenwart hegemonial geworden ist.
Saito skizziert schließlich, entlang welcher Linien Marx die Verwirklichung eines Postwachstumskommunismus dachte und welche konkreten Praxen und Institutionen hierfür essenziell seien: Überwindung kapitalistischer Konkurrenz durch Sozialismus, genossenschaftliche Organisation des Eigentums, demokratische Organisation regionalisierter Produktionsverhältnisse, Heilung des Stoffwechselrisses statt Produktivismus.
Eine große Faszination des Bandes resultiert aus der akribischen Rekonstruktion der späten Marx-Manuskripte und der darin zum Ausdruck gelangenden Überzeugung, kapitalistische Wirtschaftsorganisation und holozänartige Ökosystemkreisläufe verhielten sich zueinander unvereinbar. Marx gelangte also bereits vor 150 Jahren zu Thesen, die in unserer Gegenwart neue Relevanz erfahren. Die Aufhebung des umfassenden Natur-Gesellschafts-Konflikts, also die Schließung des Risses zwischen Ökonomie und Ökologie könne, so Marx, nicht unter Bedingungen kapitalistischer Konkurrenz und Steigerungslogik vollzogen werden. Insbesondere die akribische Rekonstruktion der von Marx unterstellten Ursachen und Dimensionen der Risse im Mensch-Natur-Stoffwechsel sind eine große Stärke des Bandes (S. 23ff.). Hier erkennt Saito drei Dimensionen des marxschen Stoffwechselriss-Konzepts: Die erste besteht in der allgemeinen materiellen Inkompatibilität regenerativer Kreisläufe und kapitalistischer Steigerungslogik. Die zweite Dimension, der räumliche Riss, manifestiert sich z.B. in der problematischen Allokation von Bodennährstoffen (verstärkt durch den Stadt-Land-Gegensatz). Und die zeitliche Dimension beschreibt, wie kapitalistische Produktionsverhältnisse selbst einer Steigerungs- und Beschleunigungslogik unterworfen sind, die mit den Zeitlichkeiten von Naturkreisläufen uneins sind (S. 25ff.).
Gleichzeitig kann Saito mithilfe des Konzeptes der »Stoffwechselverschiebung« zeigen, dass in der kapitalistischen Gesellschaftsformation diese Konflikte nicht behoben, sondern jeweils verschoben werden. Anregend ist hieran, dass Saito unter Rückgriff auf Marx plausibel zeigen kann, dass die Steigerungslogik selbst überwunden werden sollte, um den offenbar gewordenen Konflikt im Mensch-Natur-Verhältnis zu lösen. Für Marx wie Saito gilt die Idee einer vollständigen Kontrolle von Ökosystemen durch den Menschen als illusorisch. Der Postwachstumskommunismus stellt sich somit Technologieutopismen und dem Narrativ eines Grünen Wachstums entgegen.
Das Stoffwechselmodell lässt aber auch Raum für Kritik: Man hätte sich gewünscht, dass Saito beim Skizzieren der transformativen Praxis des Postwachstumskommunismus das Stoffwechselkonzept noch einmal explizit aufgegriffen und konkreter herausgearbeitet hätte, welche Maßnahmen sich wie zur jeweiligen Stoffwechselrissdimension verhalten (S. 236-242). Daneben lässt sich kritisieren, dass Saito den mit dem titelgebenden Anthropozänbegriff eng verbundenen Anthropozentrismusbegriff nicht systematischer behandelt. So bleibt es den Leser*innen überlassen, dessen Verschiedenheit zu erkennen: Zunächst eine aus seiner Sicht kritikwürdige Position, die den Wert des Menschen über den Wert der übrigen Natur erhebt, wie er dies z.B. dem »Produktion der Natur«-Ansatz unterstellt (S. 104). Zum Zweiten plädiert Saito dafür, dass der Mensch zentraler Akteur beim Lösen der selbst verursachten ökologischen Krisen sein müsse und bezeichnet auch dies als anthropozentrisch (S. 124). Schließlich verweist Saito auf die Unmöglichkeit, als Mensch eine andere als letztlich menschliche Perspektive einzunehmen, und argumentiert so für die Unvermeidbarkeit eines epistemischen Anthropozentrismus (ebd.). Diese Konzeptionierungen werden nicht differenziert in einen ethischen, agentiellen und epistemischen Anthropozentrismus, so dass Saitos eigene Positionierung insbesondere zu einem ethischen Anthropozentrismus offen bleibt.
In der Gesamtschau legt Saito mit »Marx in the Anthropocene« eine detaillierte Neuinterpretation des späten Marx vor, die sich zwar nicht immer konsequent zwischen dem Nachzeichnen der großen Linien dessen Denkens einerseits und großer Detailtiefe andererseits entscheidet und auch hie und da der für marxistische Diskurse typischen Versuchung erliegt, die vermeintlich plausibelste und gültigste Marx-Lesart vorzulegen und dabei substantielle Unterschiede zu »konkurrierenden« Theorien zu behaupten, die letztlich verschwindend gering sind (wie bspw. bei der Differenz zu Smith und Castree). Doch das Angebot, Karl Marx nicht nur als Ikone vieler antikapitalistischer Bewegungen im Klassenkampf, sondern auch als Verfechter radikal transformierter – und somit befriedeter – Natur-Gesellschafts-Beziehungen zu begreifen und diese Neu-Interpretation zugleich als wesentliche Anregung für die Friedens- und Konfliktforschung im 21. Jahrhundert zu lesen, ist dank Saito plausibel geworden.
Larissa Knauf, Ulrich Roos und Paul Schäferle