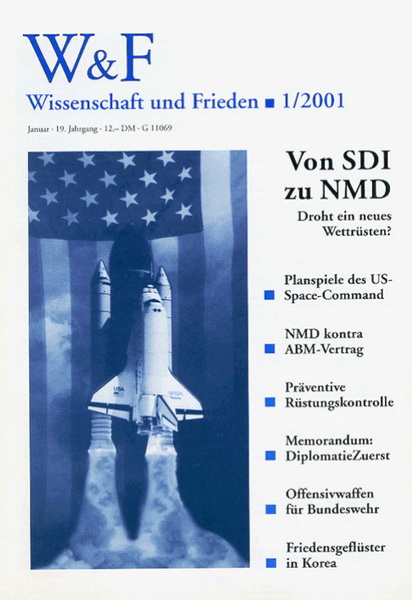Militärisches Denken als Antwort auf globale Bedrohungen?
von Ulrich Albrecht
Ist militärisches Denken die Antwort auf die globalen Bedrohungen? Die Fragestellung klingt rhetorisch und die Annahme ist sicher nicht falsch, dass die Mehrheit der in Friedensforschung und Friedensbewegung Engagierten ein klares Nein als Antwort bereithält; allenfalls bereit, den militärischen Aufwand der Vergangenheit, die immense Bindung von Ressourcen zu rekapitulieren, ehe man sich die globalen Herausforderungen der Zukunft genauer vor Augen führt. Ulrich Albrecht beantwortet die Themenfrage mit ja. Er geht davon aus, dass militärisches Denken, die konzeptionellen Fähigkeiten von Strategen, von Konzepteuren neuer Waffensysteme gebraucht werden – nicht nur sie, sie aber auch, um den exorbitanten Herausforderungen der globalen Entwicklungen begegnen zu können. Gleichzeitig fordert er angesichts von NMD-Phantasien in den USA mehr Einmischung von Seiten der Wissenschaft.
Die menschliche Intelligenz ist die wichtigste Ressource um das Überleben dieser Spezies zu organisieren. Wenn die Nutzung menschlicher Kreativität in der großen Anstrengung des Kalten Krieges vorrangig militärischen Vorbereitungen galt, so liegt es nahe, diese Potenziale künftig für das Bestehen globaler Herausforderungen einzusetzen. Daher mein Ja zu der Frage, ob militärisches Denken als Antwort auf globale Bedrohungen gebraucht wird.
Nehmen wir die globalen Herausforderungen in den Blick: Nach der Implosion des so genannten realen Sozialismus ist die Geschichte – sehr im Gegensatz zu der Voraussage von Francis Fukuyama – nicht an ihr Ende gekommen. Sie hat vielmehr im Tempo der Veränderungen gewaltige Beschleunigungen erfahren. Europa und die Welt befinden sich in einem Umbruchprozess von welthistorischen Ausmaßen, der von Konflikten und mannigfachen Krisen begleitet wird. Die Tiefe dieses Wandels ist vergleichbar mit den großen Zäsuren der Weltgeschichte, dem Ende des Römischen Reiches, dem Beginn der Neuzeit, den großen europäischen Revolutionen.
Im Zuge dieser Veränderungen schält sich schrittweise eine neue Ordnung heraus. Wir streiten derzeit miteinander, was wir von dieser neuen Ordnung erkennen. Eines aber ist klar: mit überkommenen Mustern von Wahrnehmung, mit vorfindlichen Theorien ist das Neue nicht mehr zu verstehen. Und mit den vorfindlichen Institutionen ist die Antwort nicht zu organisieren.
Wir stehen vor tektonischen Verwerfungen, vor Beben in den sozialen Strukturen, die sich vor allem in der Zunahme von Gewalt manifestieren. Wir nehmen die internationale Umwelt, etwa in Somalia oder in Afghanistan, als schwer durchschaubar, als chaotisch wahr. Das sind Indizien für mangelnde analytische Einsicht. Krieg, bis 1989/90 weitgehend im Kondominium der Supermächte reguliert, ist nach Europa zurückgekehrt. Trotz aller Bewältigungsversuche – wir stehen fassungslos vor dem Inferno an Gewalt, das sich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft abgespielt hat und abspielt.
Ein zweites Indiz, dass wir wenig begreifen, selbst die Militärs sind verwirrt: Anstelle der mechanisierten und totalen Kriege der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, in der gewaltige Heere etwa in großen Panzerschlachten aufeinander trafen, sind irreguläre militärische Auseinandersetzungen getreten. Doch haben wir es nicht einfach mit einem Remake von Geschichte zu tun. Krieg zwischen Staaten der westlichen Sphäre erscheint uns heute als ausgeschlossen. Aber um diese herum ist Krieg. „Krebsartig breitet sich ein neuer Typ von Konflikt aus, auf den die alte Doktrin nicht passt: Gruppenkonflikte innerhalb zerfallender Staaten ohne erkennbare Zentralgewalt, häufig mit mehr als zwei Parteien, von denen keine eindeutig legitimiert ist und denen Gewalt zum Selbstzweck wird“, schreibt Hans Michael Kloth im SPIEGEL. Den Vereinten Nationen machen vor allem die unklaren Verantwortungsmuster zu schaffen. „In der Vergangenheit konnte man bei einem Waffenstillstand davon ausgehen, dass die Militärs von einer Regierung kontrolliert werden“, klagt Bernard Miyet, bis Herbst 2000 Unter-Generalsekretär der UN für friedenserhaltende Maßnahmen. „Jetzt sehen wir uns Gruppen gegenüber, bei denen es manchmal schwer ist nachzuvollziehen, welche politischen Ziele sie verfolgen.“
Der vormalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Ghali, hat 1995 anlässlich des 50. Jahrestages seiner Organisation das Problem in seinem »Supplement zur Agenda für den Frieden« mit den folgenden Worten beschrieben: „Viele der Konflikte von heute ereignen sich innerhalb der Staaten und nicht zwischen Staaten. Das Ende des Kalten Krieges hat Hemmnisse verschwinden lassen (…) Im Ergebnis ist es zu einer Flut von Kriegen in neuerdings unabhängigen Staaten gekommen, die häufig einen religiösen oder ethnischen Charakter aufweisen, und in denen es oft zu ungewöhnlichen Gewalttaten und Grausamkeiten kommt. Das Ende des Kalten Krieges scheint zudem zum Ausbruch solcher Kriege in Afrika beigetragen zu haben.“
Leslie H. Gelb, Präsident des einflussreichen US-Council on Foreign Relations, widmet sich im Eröffnungsbeitrag der Weihnachtsnummer 1994 von »Foreign Affairs« in vergleichbarer Weise der Frage, was (Untertitel) „die fortwährende Herausforderung der neuen Welt“ nach dem Ende des Kalten Krieges sei. Nach beschwörenden Appellen, auf den Kern des Friedensproblems zu kommen („Die Frage des strategischen Fokus ist ausschlaggebend. Keine Strategie kann Erfolg haben, wenn sie nicht die gefährlichste Bedrohung angeht und diese zutreffend bestimmt“) gelangt er zu einem ähnlichen Ergebnis wie kurz nach ihm der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Nicht die nukleare Proliferation, nicht Russland, nicht das wiedervereinigte Deutschland (!) nicht neue chinesische Bestrebungen oder auch Handelskriege bildeten das Problem (wiewohl Leslie H. Gelb findet, wobei besonders der Fingerzeig auf Deutschland hierzulande Beachtung finden sollte: „All are serious“), sondern: „Das Kernproblem bleiben Kriege nationalen Zerfalls, ein beständiger Rückgriff auf unbürgerliche Bürgerkriege (uncivil civil wars), sich in ihre Bestandteile auflösende zerbrechliche aber halbwegs funktionierende Nationalstaaten, die an der Wohlfahrt der stabilen Nationen nagen.“
Diese »Kriege nationalen Zerfalls« bestimmt Boutros-Ghali in seinem »Position Paper« genauer: „Die neue Saat von innergesellschaftlichen Konflikten weist gewisse Eigenheiten auf, die die UN-Peacekeeper mit Herausforderungen konfrontieren, wie sie diese seit dem Kongo-Einsatz in den frühen sechziger Jahren nicht mehr erlebt haben. Diese Konflikte werden gewöhnlich nicht nur von regulären Streitkräften ausgefochten, sondern von Milizen und bewaffneten Zivilpersonen, die wenig Disziplin zeigen, und deren Kommandostränge unklar bleiben. Oft handelt es sich um Guerillakriege ohne deutliche Frontlinien. Zivilisten sind die Hauptopfer und häufig auch die Hauptziele. Humanitäre Katastrophen sind alltäglich, und die Verantwortlichen in den Kämpfen, wenn man sie überhaupt als Verantwortliche bezeichnen kann, vermögen nicht, damit zu Rande zu kommen.“
Der Generalsekretär der Organisation für Afrikanische Einheit, Salim Ahmed Salim, bestätigt für Afrika die Feststellung von Boutros-Ghali: „Ein gemeinsamer Grundzug aller Konflikte – von Liberia bis Somalia, von Angola zum Sudan und von Ruanda bis Mozambik und Südafrika – ist, dass es die verwundbarsten Gruppen sind, die am meisten betroffen sind, und die verletzbarsten unter diesen allen sind unschuldige Kinder.“
In der Äußerung des UN-Generalsekretärs bleibt hervorzuheben, dass die Kämpfe „mit ungewöhnlicher Gewalt und Grausamkeit“ ausgetragen werden. Viele der Bluttaten sind denn auch eher als Pogrome denn als militärische Handlungen zu werten, die den Maßgaben der Haager Landkriegsordnung folgen. Dass „Zivilisten Hauptopfer und häufig auch Hauptziele“ sind, so der Generalsekretär weiter, spricht allen Traditionen von der Einhegung des Krieges, allen Auffassungen vom neuzeitlichen soldatischen Handwerk Hohn.
Die Kriege des 21. Jahrhunderts widerspiegeln die tiefe Spaltung der Welt in eine von zwischenstaatlichem Krieg freie Wohlstandsinsel, geografisch beschränkt auf Westeuropa, die USA und Japan, und großen Regionen im vormals realsozialistischen Territorium, in Afrika und anderen Teilen der Welt, die den Anschluss an die wirtschaftliche, technologische und kulturelle Entwicklung der Moderne nicht schaffen. Diese Dichotomie zwischen Zentrum und Peripherie setzt sich im Militärischen fort. Das affluente Zentrum perfektioniert die Möglichkeiten der Hightech-Kriegführung, schafft sich so erweiterte Handlungsräume für die Durchsetzung eigener Interessen und auch zum gelegentlichen Intervenieren in der Peripherie aus so genannten humanitären Gründen. Der qualitative Rüstungswettlauf schreitet erstaunlicherweise ungebrochen fort.
Die »humanitäre Intervention«, nebenbei gesagt, ist keineswegs eine Erfindung unserer Tage. Vor hundert Jahren nutzten die europäischen Großmächte eben dieses Konzept, um im niedergehenden osmanischen Reich im Namen von christlichen Minderheiten Stützpunkte auf Zypern, im Libanon und anderswo zu ergattern.
Die Weltbank hat 1997 den niedergehenden Staat und dessen Verbindung mit Krieg zum zentralen Thema ihres Jahresberichtes gemacht. „In den letzten Jahren“, heißt es dort, „sind in einer wachsenden Zahl von Ländern faktisch alle Funktionen und Institutionen, oftmals im Zusammenhang mit einem Bürgerkrieg, zusammengebrochen.“ Die Institutionen mögen noch Bestand haben, sie leisten aber kaum etwas. Daneben gibt es implodierte Staaten. Der Bericht nennt Afghanistan, Kambodscha, Liberia und Ruanda. Schauplätze, wie es im Bericht heißt „für einige der schlimmsten humanitären Katastrophen.“ Es handelt sich aber nicht lediglich um ein Problem dieser Gesellschaften. „Diese zogen oft die Nachbarländer“, fährt der Weltbankbericht fort, „durch Gewalt, Banditentum und Flüchtlingsströme in Mitleidenschaft. Sie warfen Länder zurück, zerstörten wirtschaftliche Anlagen und die Infrastruktur, beanspruchten gewaltige Summen an internationaler Hilfe – und forderten natürlich zahllose Menschenleben.“
Von den Wohlstandsinseln des Nordens hier militärisch mit überlegenen Mitteln einfach dazwischen zu hauen, wird gar nichts lösen. Um den Weltbankbericht nochmals zu zitieren: „In Angola, Liberia und Somalia entstand zum Beispiel eine sich selbst tragende Wirtschaft der bewaffneten Gewalt, die auf Plünderung, auf Erpressung unter Gewaltandrohung, Drogenhandel, Geldwäsche, Raubbau an Tropenholz sowie Ausbeutung der Bodenschätze wie Edelsteine und Mineralien beruhte.“
In Liberia, im Kongo oder auch in Mosambik hat sich eine Bürgerkriegsökonomie herausgebildet, die in sich einigermaßen stabil ist, die nunmehr seit Jahren der Bevölkerung ein kärgliches Überleben gestattet. Diese Kriegsökonomien sind nunmehr offen, mit den Weltmärkten für Waffen, Drogen und Diamanten direkt verknüpft. Eine besondere Rolle spielen humanitäre Schutzzonen. „Das humanitäre Schutzgebiet stellt eine echte Revolution für die Kriegsökonomien dar“, schreibt Jean-Christophe Rufin, einer der Herausgeber des ersten Sammelwerkes zu diesem Thema. „Ein humanitäres Rückzugsgebiet eröffnet der Guerilla eine rückwärtige Basis in einem Nachbarland, die nicht durch eine Grenze, sondern vor allem durch die Präsenz von zivilen Flüchtlingsmassen geschützt ist, die überdies von der internationalen Gemeinschaft versorgt werden.“
Als Hauptinstrumente der neuen Kriegsökonomien gibt Rufin Raub und organisierte Kriminalität an. Auch betont Rufin die Bedeutung internationaler Vernetzung dieser Bürgerkriegswirtschaften: „Die Konflikte sind Teil einer Schattenwirtschaft, deren Beziehungen sie prägen und sie als Ausgangs- (Export von lokalen Produkten) und Endpunkt (Import von Waffen und Subsistenzmitteln) haben. Ganze Ketten von geheimen Stützpunkten sind nötig: Verbindungsstationen jenseits der Grenze (im Fall einer Blockade oder Überwachung kann das geschulte Schmugglerbanden erfordern), in benachbarten oder entfernteren Ländern und in den reichen Ländern, wo immer die eigentlichen Bestimmungsorte liegen.“
Die Forschung zu diesen Bürgerkriegsökonomien ist jung. Wir beginnen langsam zu verstehen, wie diese neuen Kriegswirtschaften im Gegensatz zur althergebrachten Kriegsökonomie funktionieren (diese hatten im Gegensatz zu den heutigen Verhältnis das Leitziel der Autarkie). Und wir begreifen, dass die alten Gegenmittel, etwa Embargos, gegen diese vernetzten Ökonomien noch weniger auszurichten vermögen als bisher.
Ein neuer Sicherheitsbegriff
Die Rede vom erweiterten Sicherheitsbegriff nach dem Ende des Kalten Krieges ist sattsam bekannt. Der Sicherheitshaushalt der Zeitgenossen bekam neben der militärischen weitere Dimensionen: Es geht in unserem Weltteil auch um ökologische, um soziale Sicherheit. Mein österreichischer Kollege Anton Pelinka hat das kürzlich auf den Begriff gebracht: „Es gibt keine nationale Sicherheit mehr, die nicht von einer transnationalen Sicherheit ausgeht. Und es gibt keine militärische Sicherheit, die nicht auch und wesentlich wirtschaftliche und ökologische, kulturelle und religiöse Herausforderungen mit berücksichtigt. Vor allem aber gibt es keine äußere Sicherheit, die nicht auch die innere berücksichtigt und umgekehrt.“
Die Bedrohungen der Umwelt, wachsende Ozonlöcher, Temperatursteigerungen infolge von CO2-Emissionen, die das Polareis abschmelzen und die Meeresspiegel steigen lassen, die systemische Bedrohung des Überlebens nicht unserer Spezies, sondern von Leben überhaupt, bedürfte eigentlich zur Bekämpfung eben jener Milliarden, die hierzulande weiterhin für militärische Rüstung ausgegeben werden. Und sie bedürfte auch der Wissenschaftsressourcen, die weiterhin der Priorität Rüstungstechnik gewidmet werden.
Die zweite große Katastrophe bleibt der ausbleibende Entwicklungsfortschritt in der so genannten Dritten Welt und das damit verbundene Leiden am Mangel für die Mehrheit derjenigen Menschen, die heute leben. 1960, 1970, 1980 wurden mit Fanfaren Entwicklungsdekaden proklamiert. Heute verkündet niemand mehr eine neue Entwicklungsdekade. Afrika wird zum sprichwörtlich vergessenen Kontinent, viele Staaten dort versinken in inneren Kriegen, der große Traum vom Aufstieg durch Entwicklung verfliegt, Staatlichkeit, die all dies organisieren sollte, zerfällt.
Für mich am überzeugendsten hat die ILO, die International Labour Organisation, diese Entwicklung auf den Begriff der »Human Security« gebracht. Es geht gewiss weiterhin um Sicherheit von Menschen vor äußerer Gefahr oder auch Gewalt im Inneren eines Landes. Daneben aber steht das Begehren, soziale Sicherheit zu haben, ökologisch gesichert zu leben. Menschliche Unsicherheit wird, noch vor Unsicherheit vor äußerer Gefahr, von der ILO beschrieben mit ungesicherter Ernährung, unsicherer Bleibe, ungewissem Gesundheitszustand, unsicherer Beschäftigung und Einkommen. Human Security, menschliche Sicherheit, bedeute ein auskömmliches Leben, Arbeit, ein Minimum an sozialer Sicherheit. Und wir müssen wiederum hinzufügen: Unter Bedingungen von Nachhaltigkeit, die nächste Generation soll auch leben (können).
Der grundsätzliche Schritt der ILO und konzertierende Aktionen anderer UN-Organe erfolgen nicht zufällig. Behutsam wollen diese Weltinstitutionen, nachdem die Friedensdividende nach Ende der militarisierten Ost-West-Konfrontation sich nicht wie erhofft eingestellt hat, unter ihren Mitgliedern eine Reflexion einleiten, was denn nun tatsächliche Prioritäten sind. In westlicher Sicht sieht dies sehr verdächtig danach aus, dass einmal mehr mit der Mehrheit der UN-Mitglieder Druck ausgeübt werden soll, die immer noch hohen Militärausgaben anderen Zwecken zuzuführen, von Hightech-Projekten wie dem NMD-Vorhaben abzugehen. Von der Agenda der Völkergemeinschaft her ist diese Prioritätenliste klar: Nicht die Produkte, der outcome militärischen Denkens, aber dessen enorme Fähigkeiten sind gefragt, um Human Security voranzubringen.
Das Handeln von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren
Naturwissenschaftler haben hier ein Mandat, das ist mindestens geklärt, seit Siegmund Freud im Jahre 1932 auf die Frage Albert Einsteins antwortete, was man tun könne, „um das Verhängnis des Kriegs von den Menschen abzuwehren.“ Einstein entwickelte seine Haltung in vier Stufen, die hier skizziert werden sollen. – Freuds Antwort auf die Einladung Einsteins zum Gedankenaustausch:
„Ich erschrak zunächst unter dem Eindruck meiner – fast hätte ich gesagt: unserer – Inkompetenz, denn das erschien mir als eine praktische Aufgabe, die den Staatmännern zufällt.“
Sich vom Schreck erholend, fährt Freud fort: „Ich besann mich auch, dass mir nicht zugemutet wird, praktische Vorschläge zu machen, sondern dass ich nur angeben soll, wie sich das Problem der Kriegsverhütung einer psychologischen Betrachtung darstellt.“
Darum geht es: Naturwissenschaftler, Vertreter anderer Disziplinen „sollen nur angeben“, ich paraphrasiere Freud in seiner Antwort an Einstein, „wie sich das Problem der Kriegsverhütung“ in der Sicht ihrer Disziplin darstellt.
Einstein selber meinte 18 Jahre später, mittlerweile gab es Atomwaffen, der Wissenschaftler müsse nicht lediglich interdisziplinär das Kriegsthema erörtern, sondern er müsse – so sein zweiter Schritt – auf Volkes Wille setzen: „Ich bin überzeugt“, schrieb er 1950, „die verantwortlichen Machthaber müssten ihre verhängnisvolle Haltung ändern, wenn Meinung und Wille der Mehrheit der Menschen wirksam zum Ausdruck gebracht werden könnten.“
Sechs Jahre später vollzieht Einstein den Schritt weg vom Konjunktiv und wendet sich gemeinsam mit Bertrand Russel 1956 in einem dritten Schritt mit dem bekannten Manifest an die allgemeine Öffentlichkeit; der Naturwissenschaftler und der naturwissenschaftlich gebildete Philosoph konstatieren, dass der Weg in eine friedvollere Welt die Abkehr von der Nuklearrüstung erfordere.
Schon 1932 hat sich Albert Einstein, Ulf Wolter zufolge, mit dem Gedanken getragen, eine weltweite Umfrage zum Kriegsthema zu lancieren. Mit Blick auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die jedermann das Recht, die Pflicht und auch die gesetzlich geschützte Möglichkeit zuspricht, sich direkt an der Gestaltung und der Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes zu beteiligen, wäre – übertragen auf heute – jedermann zu befragen, wie er etwa zu dem US-amerikanischen Projekt einer nationalen Raketenabwehr (NMD) steht. Das wäre der vierte Schritt im Denken Einsteins gewesen – eine konsultative Urabstimmung zum Thema Rüstung und Krieg.
Ich persönlich meine, dass das Engagement des Naturwissenschaftlers und Ingenieurs heute über die ersten drei Schritte der Befassung Einsteins mit der Kriegsproblematik hinausgehen muss. Die interdisziplinäre Erörterung dessen, was vorgeht, ist selbstverständliche wissenschaftliche Pflicht, reicht aber politisch bei weitem nicht hin. Auch auf den allgemeinen Willen der Öffentlichkeit zu setzen, so die den zweiten Schritt Einsteins prägende Überzeugung, wird ungenügend bleiben. Das Pugwash-Manifest, den dritten Schritt Einsteins markierend, bleibt hoch verdienstlich und hat eine bedeutsame internationale Nichtregierungs-Organisation von Wissenschaftlern ins Leben gerufen. Die alljährlichen Appelle dieser mit dem Friedensnobel-Preis ausgezeichneten Bewegung finden allerdings nur ein geringes Echo. Die Interaktion von Wissenschaft und Politik, sollen dissente Anliegen der Wissenschaftler politikfähig werden, bedarf augenscheinlich radikaler Mittel der Einmischung, welche Albert Einstein seit 1932 bewegt haben, und welche hier als vierte Stufe seines Engagements gedeutet wurden. Einstein hat das Projekt einer universalen Befragung nie konkret betrieben. Angesichts von NMD-Phantasien in den USA ist es an der Zeit, seine Idee wirklich zu prüfen, wenn es um Antworten auf diese neue amerikanische Herausforderung geht.
Prof. Dr. Ulrich Albrecht lehrt an der FU Berlin. Er ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung