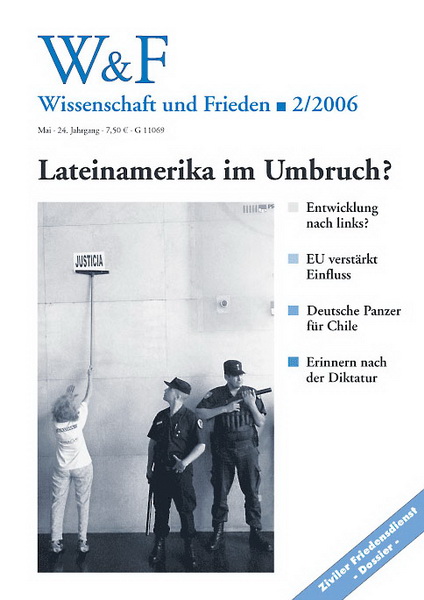Mit Furcht gibt es keinen Frieden
Probleme der urbanen Gewalt in Brasilien / Beobachtungen von Carl D. Goerdeler
von Carl D. Goerdeler
Manuel Coutinho würde keiner Fliege die Flügel ausreißen. Der Gemütsmensch in seinem Gemüseladen an der Avenida Automovel Club ist ein friedlicher Zeitgenosse. Aber in seiner Schublade hat er einen Revolver; den hat er sich nach dem dritten Überfall auf seinen Laden angeschafft. Und am 23. Oktober 2005 hat Manuel natürlich mit Nein und also gegen das Verbot von Waffenhandel gestimmt. So wie 58,5 Millionen andere Brasilianer auch. Nur 25,4 Millionen waren dafür, den Kauf von Schusswaffen und Munition auf die Streitkräfte, die Polizei, Wachmänner, Jäger und Sportschützen zu beschränken.
An diesem denkwürdigen Sonntag im Oktober hatten etwa 120 Millionen Brasilianer ihr Votum abgegeben – die Teilnahme an der Volksabstimmung war für alle Bürger zwischen 18 und 70 Jahren verpflichtend. Stimmberechtigt waren aber auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Wenn auch die Waffenbefürworter mit rund 64 Prozent klar über die Verbotsanhänger (36 Prozent) gesiegt haben – so zeigte doch die hohe Enthaltung von rund 22 Prozent aller Stimmberechtigten, wie umstritten die gesamte Volksabstimmung war.
Noch im September 2005 hatten die Umfragen einen klaren Meinungstrend für das Verbot von Waffenhandel signalisiert. Worauf war der Stimmungswechsel zurückzuführen?
„Kein Zweifel – das Nein ist ein Ausdruck des Protestes gegenüber einem Staat, der die Bürger im Regen stehen lässt. Und die Regierung hat den Schwanz eingekniffen“ – so der Abgeordnete Paulo Delgado, der zur Arbeiterpartei des Präsidenten Lula da Silva gehört. Und Lula hatte mit seiner Linksregierung, den Bürgerrechtlern und der Katholischen Kirche die Initiative der Vereinigung »Viva Rio« unterstützt, ein Votum zum Verbot von Waffenhandel herbeizuführen. Ermutigt wurden die Pazifisten dadurch, dass im Juli 2004 die Brasilianer in einer freiwilligen Aktion rund 440.000 (meist unbrauchbare) Gewehre gegen Belohnungen von bis zu 100 Dollar abgeliefert hatten. Der Waffenlobby und dem -handel drohten schwere Zeiten: Seit dem Beginn der Abrüstungskampagne mussten landesweit 1.500 Waffenläden schließen.
An der friedlichen Gesinnung der weitaus meisten Brasilianer besteht wohl kein Zweifel. Doch in keinem Land der Welt mit Ausnahme von Venezuela sterben mehr Menschen (gemessen an der Gesamtbevölkerung) jährlich durch Waffengewalt – mehr als durch Verkehrsunfälle, Krebs oder andere Krankheiten. Zwischen1979 und 2003 wurden nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als eine halbe Million Menschen ermordet.
Das Gefühl der Bedrohung und das Wissen um die Ohnmacht der Behörden, die Kriminellen zu fangen und zu bestrafen kennt jeder Brasilianer. Wenn ein Waffenverbot glaubhaft gemacht hätte, dass den Mördern nun endlich das Handwerk gelegt werde – dann wäre diese Abstimmung wohl anders ausgegangen. So aber beschlich die meisten Bürger je näher der Abstimmungstag kam, die Vermutung, die Regierung wolle sich mit dem Votum nur ein Alibi verschaffen – ein strenges Gesetz erlassen, aber sonst alles weiter laufen lassen wie bisher: die korrupte Polizei wie die untätige Justiz. Die meinungsführende Zeitschrift »Veja« hatte noch unmittelbar vor der Volksabstimmung darauf hingewiesen, dass in Brasilien nur drei Prozent aller Morde aufgeklärt werden (gegenüber 70 Prozent in den USA) und dass im Schnitt zehn Jahre vergehen, bis in einem Prozess der Täter verurteilt wird (acht Monate in den USA). Fazit: In Brasilien kann man straflos töten.
Die Bürger wollen nicht Freiwild sein. Amtlichen Angaben zufolge befinden sich in den häuslichen Arsenalen rund 17 Millionen Schusswaffen – davon sind neun Millionen nicht angemeldet. Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher ausfallen. Ein Verbot des Waffenhandels hätte langfristig vielleicht die Bürger entwaffnet – aber auch die Kriminellen? Daran haben mehr und mehr Brasilianer gezweifelt. Die Unterwelt beschafft sich ihre (teils schweren) Waffen sowieso auf dem Schwarzmarkt.
Die Waffenlobby feierte das Ergebnis als »Sieg des freien Bürgers«. In Wahrheit aber war dies eine bittere Niederlage: eine Niederlage für die Linksregierung von Lula und eine Niederlage für die zivile Gesellschaft. Die Brasilianer trauen sich selber und ihren Waffen mehr zu als der öffentlichen Ordnung. So wie Manuel Coutinho, der Gemüsehändler.
Die schweigende Mitte
Noch mehr Mitte geht nicht: nach der Praça da República richten sich alle Entfernungen in São Paulo und von dort ist es nur ein Katzensprung in die Oper, zur Kathedrale und hoch in den 42. Stock des Edificio Italia mit dem Panoramablick über die12-Millionen-Metropole. An der Praça da República hätte die Bankfrau Marlene Alves de Santana mit ihrer Familie gleich einziehen können: 240 Quadratmeter im 8. Stock mit Blick auf den schütteren Park – die Miete halb so hoch, die Fläche doppelt so groß wie bei ihrer Wohnung in Brooklyn am Südrand der City. Marlene ist aber nicht eingezogen. Denn sie fürchtete sich, nach Einbruch der Dunkelheit vors Haus zu treten. Sie wäre über Obdachlose, die auf dem Bürgersteig und unter den Bäumen auf dem Platz kampieren, gestolpert und spätestens in der ersten Woche hätte man ihr die Handtasche entrissen, und das wäre noch harmlos gewesen. Es war doch merkwürdig genug, dass die Miete so niedrig und das Angebot an freien Wohnungen dort in dem Altbau aus den 30er Jahren so hoch waren. Aber hatte nicht auch das Hilton-Hotel, einst die erste Adresse im Stadtzentrum und wegen des Sonntagsbrunchs beliebt, gerade erst dicht gemacht?
Die Mitte wohnt am Rand, und die vom Rand der Gesellschaft strömen in die Mitte, besetzen die Bürgersteige, schlagen ihr Buden in der Gosse auf. Die guten Kunden bleiben weg, Geschäftsleute schließen ihre Läden oder stellen um auf Billigware.
Der Zersetzungsprozess der alten Mitte kann in jeder brasilianischen Großstadt beobachtet werden. Man fährt nicht mehr in die Mitte zum Einkaufen, Speisen oder Spazieren gehen. Man geht auch nicht mehr ins Theater oder Kino. Man bleibt zu Hause hinter Gittern – oder fährt in die Shopping-Malls, wo ja alles beisammen ist. 5.000 betuchte Bürger zusammen zu trommeln, wäre auf der Praça da República ein Kunststück, im Morumbi-Shopping-Center aber ist es ein Klacks.
Die Flucht aus der Mitte führt zum Verfall der Stadt und auch der Gesellschaft. Die Stadt franst immer weiter aus, zugleich verfällt das Zentrum. Die Bürger distanzieren sich buchstäblich immer mehr voneinander und von der Mitte. Wer es sich leisten kann, zieht in einen scharf bewachten Wohnpark; was sich außerhalb abspielt, sieht man im Fernsehen. In Rio de Janeiro führen Pädagogen hin und wieder Jugendliche aus den Reichen-Ghettos durch die Stadt: damit sie einmal Bus und Metro fahren lernen und sehen, wo das Rathaus steht.
„Die Favelas auf den Bergen gehörten früher zur Postkarte von Rio de Janeiro; man war ja beinahe stolz auf sie. Entsinnen Sie sich noch an »Orfeu Negro«, den Kult-Film der fünfziger Jahre? – alles vorbei“, bedauert Hans Stern, der Juwelenhändler und wohl reichste Mann von Rio. In seiner Jugend war er im Cabriolet mit Weißwandreifen über die Avenida Atlantica geschwebt; das würde er heute schon aus Gründen der Tarnung, also der Sicherheit, nicht wagen. „Ob die Armut zugenommen hat, ob deshalb die Gewalt gestiegen ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber finden sie einmal die Bürger und Mäzene, die sich etwa um das Stadttheater kümmern, um das Symphonie-Orchester, um das Klassik-Radio, um die Stadtbibliothek. Bringen Sie mir die Bürger, die sich mit ihrer Stadt identifizieren!“
Drei Monate lang, von Mitte Mai bis Mitte August 2005 waren die städtischen Museen in Rio de Janeiro geschlossen. Und keiner hat es gemerkt! Der Streik der Kulturbürokraten war nur eine Marginalie. Monatliche Massaker der Polizei oder der Drogenbosse – wo ist da der Unterschied? Kliniken, in denen die Kranken verrecken, Gesetze, die nichts gelten: Wo regiert wird, wird geschmiert. Und die Bürger gehen nicht auf die Barrikaden.
Die brasilianische Mittelklasse beginnt beim Einkommen von fünf Mindestlöhnen und darüber. Zehn Prozent aller Erwerbspersonen verdienen das monatlich; die kleine Oberschicht ist auf ein Arbeitseinkommen nicht angewiesen. Die Besser- und Bestverdienenden verfügen über die Hälfte des gesamten Volkseinkommens – die weniger privilegierte Hälfte der Bevölkerung verfügt aber nur über zehn Prozent des gesamten Kuchens. Trotz der deutlich gestiegenen Lebensqualität (Human Development Index der UN) und Bildung sind in Brasilien Einkommen und Besitz also weiterhin sehr ungleich verteilt.
Aber darum geht es nicht. Das Gefühl der Mitte, an den Rand gedrängt zu sein, teilen nicht nur Ladeninhaber und Professoren, Ingenieure und Zahnärzte. Das Gefühl hat die bürgerliche Klasse in Brasilien ganz allgemein. „ Früher war es selbstverständlich, die Kinder in die öffentliche Schule zu schicken“, erinnert sich die Familientherapeutin Cyntia Falcão.„ Aber wer wagt das heute noch?…Wer irgend kann und etwas auf sich hält, der meidet sie“. So wie man das Öffentliche insgesamt meidet. Früher hätten zur Sippschaft, auch der ihren, immer Honoratioren gehört. Doch diese Zeiten sind vorbei: In den Gemeinderäten, den Provinzparlamenten und im Nationalkongress agieren Berufspolitiker, die sich nicht als Repräsentanten einer Nation, Gesellschaft oder Klasse verstehen, sondern als Geschäftemacher in eigener Sache.
Rio – 50 Jahre Verfall
An welchem Tag der Niedergang von Rio de Janeiro begann, ist nicht genau zu bestimmen. Es muss vor 50 Jahren gewesen sein als Juscelino Kubitschek, der künftige Staatspräsident, versprach, die Hauptstadt zu verlegen; so wie es ja bereits die Verfassung von 1891 vorsah. Das hatte bis dahin niemand Ernst genommen. Umso größer dann das Erstaunen, dass Juscelino vom ersten Tag seiner Regierung an, Vermessungstrupps und Ingenieure in den Busch schickte, den Bau von Brasília in die Wege zu leiten.
Rio de Janeiro, die »Prinzessin des Meeres«, die »schönste Stadt der Welt«, brauchte keine Rivalen zu fürchten. Nicht, solange sich die gesamte nationale Politik hier abspielte und an der Copacabana auf dem diplomatischen Parkett getanzt wurde. Sollten sich andere Städte wie São Paulo und Belo Horizonte mit Maschinenindustrie und Eisenhütten die Hände dreckig machen – Rio hatte das nicht nötig. Blaumänner hatten an der Copacabana nichts zu suchen, Putzfrauen, Köchinnen und Chauffeure, die schon.
Natürlich waren die Bewohner von Rio de Janeiro damals nicht alle Minister, Beamte oder Diplomaten. Das ganze Heer der Hofschranzen und Beamten, der ganze »niedere Klerus« der Politik und Verwaltung und deren Hauspersonal, dazu die ergrauten Staatsdiener, alle galt es zu versorgen. Davon lebte die Stadt – lebten die Krämer wie die Kutscher, die Friseure wie die Fräuleins, die Straßenfeger wie die Trambahnfahrer.
Der Typ des »malandro«, des Tunichtguts, des Vorstadtstrizzi, auch des sympathischen Spitzbuben und Überlebenskünstlers, eine Art brasilianischer Schweijk, war der Prototyp Rios, und er wurde in immer neuen Varianten besungen. Der malandro, das war der Macho, der wusste, wie man die öffentliche Stromleitung anzapfen konnte, der das Bier in der Sambaschule verkaufte, der als Buchmacher für die Bosse der eigentlich illegalen Tierlotterie die Wetten notierte, der jeden kannte und den jeder kannte und der aus der Kneipe heraus den Mädchen hinterher pfiff. Kurz und gut, der malandro war die Personifizierung des »jeitinho brasileiro«, der Kunst, sich durchzumogeln. An diesen »jeitinho« glaubt Rio de Janeiro ganz besonders.
Doch dann wurde es Ernst. 1960 flogen die Staatsgäste ein, landeten aber nicht in Rio de Janeiro, sondern in der Steppe da oben in Goias, wo sie die neue Hauptstadt einweihten. Kubitschek war wohl verrückt geworden. Wer von den Beamten wollte schon dahin? Die Generäle gaben den Befehl zum Staatsstreich. Das war am 31. März 1964.
Würde das Regime nun von Rio de Janeiro aus kommandieren, wo die meisten Garnisonen lagen? Anfangs schien es so – aber dann entdeckte die Junta, dass man in Brasilia viel ungestörter von politischen Turbulenzen Sandkastenspiele unternehmen konnte – sie entdeckten ihr Herz für die neue Hauptstadt, obgleich deren Architekt, Oscar Niemeyer, ein unbelehrbarer Kommunist war.
Rio de Janeiro, doppelt verraten. Verraten von der Politik, verraten von den Militärs. Die Bohème ging auf die Straße, die Studenten probten den Aufstand, so wie die Kommilitonen in Berkley und Berlin. Aber die Protestsongs und die Steine gegen den »Schweinestaat« blieben wirkungslos. Zu viel Utopie war im Spiel, wo doch die Schornsteine rauchten – nicht in Rio de Janeiro aber in São Paulo beispielsweise. Der Widerstand in Rio de Janeiro driftete in den Untergrund und die Drogenszene ab – in São Paulo aber setzten die Fabrikarbeiter mit ihren Streiks dem Regime zu. Die brasilianische Arbeiterbewegung mit ihrem charismatischen Führer Luis Inacio Lula da Silva an der Spitze war nun zum Subjekt der Geschichte geworden. Und Rio de Janeiro hatte in der Politik von da an ausgespielt.
21 Jahre kommandierten die Militärs, und als dann 1985 die Demokratie wieder eine Chance bekam, spielte sich das Geschehen in Brasília ab, kein Mensch kam mehr auf den Gedanken, die Hauptstadt wieder nach Rio de Janeiro zurück zu legen. Zurück aber ging es in Rio de Janeiro selber: Mit dem Gouverneur Leonel Brizola kam ein Populist alten Schlags an die Regierung. Brizola war der Liebling der Bohème, der Kleinbürger und der malandros – aller, die sich in Rio verraten fühlten. Dabei war Brizola kein Carioca, sondern einer aus dem tiefen Süden, ein Gaucho – und das Schicksal von Rio interessierte ihn nicht: Er wollte auf der nationalen Bühne die erste Geige spielen.
Während andere Bundesstaaten, São Paulo vorweg, miteinander wetteiferten, Industrien anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen, behinderte Brizola in Rio de Janeiro mögliche Direktinvestoren, besonders solche aus dem Ausland.
In Brasilien ging es aufwärts, in Rio de Janeiro in die Gegenrichtung. Statt auf Pragmatiker und Tatmenschen zu setzen, wählten die Bürger Politiker mit der größten Klappe. Und weil Politik sowieso verrufen war, bekam der »Große Onkel« in der Kommunalwahl von 1988 die drittmeisten Stimmen. Der »Große Onkel« war der Schimpanse im Zoo.
Die Bürger von Rio de Janeiro hatten sich aus der Politik abgemeldet. Und auf der nationalen Bühne rangierte die Stadt unter »ferner liefen«. Jedes Jahr zogen Bundesbehörden ab, blieben Rentner zurück. Selbst die Banken packten ein und zogen um nach São Paulo. Was blieb denn noch übrig an ökonomischer Substanz?
Nur noch der Bordsteinhandel, der Schwarzmarkt, die Gastronomie. Wenigstens die Touristen würden wie jedes Jahr einfliegen. Die Sonne und das Meer hatten Rio noch nicht verlassen. Aber neue Hotels wurden nicht mehr gebaut. Und der Hafen? Der Hafen verschlammte im Sumpf der Mafia, die die Preise diktierte, so wie in dem berühmten Film mit Marlon Brando, »On the Waterfront«. Das war ja vorherzusehen: Je weniger Arbeitsplätze es in Rio de Janeiro noch gab, desto heftiger waren sie umkämpft.
Die Menschen mit geregelter Arbeit wurden immer weniger im Vergleich zu den (relativ gut betuchten) Staatsrentnern an der Copacabana und den Menschen in den Vorstädten und Favelas, die sich mit Gelegenheitsjobs durchschlugen. Nun kamen Rio de Janeiro, die Stadt wie der Staat, an den Tropf der Bundesregierung. Einen Entwicklungsplan hatte man immer noch nicht. Wo sollte die Zukunft Rios denn liegen? In der nationalen Laissez-faire-Metropole?
Viel zu lange hatte man alles schleifen lassen. Längst war nun auch der Staat schon auf dem Rückzug. No future, kein Geld – die Favelas blieben ihrem Schicksal überlassen. Und dieses Schicksal hieß nun Diebstahl, Drogen, Tod. Mit krimineller Energie kam man schneller ans Geld als mit Ausdauer bei der Arbeitssuche. Lange hatte der Virus der Selbstzerfleischung eine Schattenexistenz geführt, nun brach er an den Rändern der Stadt mit voller Wucht aus.
Der Staat hat also keinen Anwalt mehr, die bürgerliche Gesellschaft kapselt sich ein. Die »Zivilgesellschaft« ist nur eine Schimäre, von der die Intellektuellen faseln. Brasilien wird von einer Nomenklatur populistischer Politiker regiert, die wie Sektenprediger den Zehnten in ihre eigene Tasche stecken. Die neue Mitte, das sind die Fußballvereine, die Sambaschulen, die Telenovelas, die Garagenkirchen, die 1-Dollar-Shops, die Video-Läden, der Traum, einen Job bei der Müllabfuhr zu kriegen. Aber um diese Mitte herum wächst mit jedem Jahr mehr ein breiter Todesstreifen der Armut und Gewalt, der den Rest der bürgerlichen Gesellschaft erdrosselt.
Carl D. Goerdeler lebt seit 1988 in Rio de Janeiro. Er ist Lateinamerika-Korrespondent zahlreicher deutschsprachiger Zeitungen und Autor mehrerer Marco-Polo Reiseführer