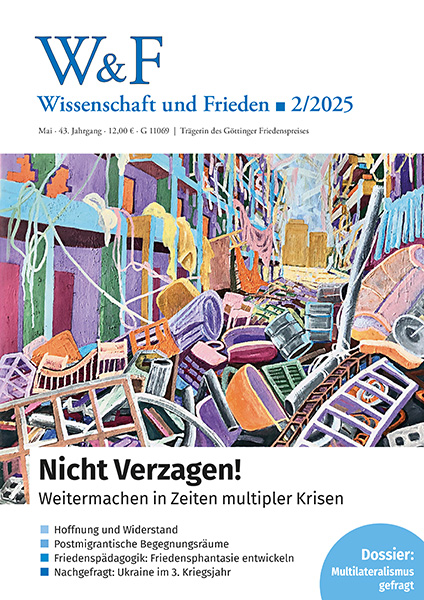(Neu-)Ausrichtung der Friedens- und Konfliktforschung
56. Kolloquium der AFK, Friedensakademie Rheinland-Pfalz & Rheinland-Pfälzisch Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), Landau, 19.-21.03.2025
Wie kann die Friedens- und Konfliktforschung ihre Erkenntnisse in Zeiten zunehmender Demokratie- und Wissenschaftsskepsis kommunizieren? Welche Antworten kann sie auf Herausforderungen wie Klimawandel, Radikalisierung und Gewaltkonflikte liefern? Wie kann in diesem Kontext mit Fake News, Desinformation und Misstrauen umgegangen werden? Und wie können ambivalente Forschungsergebnisse so formuliert werden, dass sie auf das Verständnis der Öffentlichkeit stoßen? Diese und weitere integrale Fragen wurden aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen und generationellen Perspektiven auf dem diesjährigen AFK-Kolloquium diskutiert. Mit mehr als 150 teilnehmenden Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen wurde die (neue) Rolle der Friedens- und Konfliktforschung in einer sich wandelnden Weltordnung in vielfältigen Formaten breit diskutiert. Dabei ging es sowohl um theoretische, methodische und epistemische Aspekte, als auch um konkrete praktische Beispiele im Umgang mit den multiplen gegenwärtigen Krisen.
Globale Herausforderungen
Das Kolloquium wurde mit der Keynote »Trump for World Peace? Implications of US Politics for Conflicts Across the Globe« eröffnet, welche die sich tagtäglich ändernde weltpolitische Realität nach dem Amtsantritt Donald Trumps aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchtete. Dr. Sangeeta Mahapatra (Institut für Asien-Studien am Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA)) vertrat dabei die zumeist unterrepräsentierte Position des Globalen Südens. Dr. Florian Böller (Senior Lecturer am Center for American Studies der Universität Heidelberg) brachte die Sichtweisen der USA mit in die Diskussion ein. Die europäische Perspektive nahm Deborah Düring (MdB, Sprecherin für Außenpolitik der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) ein. Dabei führte Prof. Dr. Janpeter Schilling (Professor für Humangeografie (RPTU), wissenschaftlicher Leiter der Friedensakademie Rheinland-Pfalz) moderierend durch die Diskussion. In der Debatte wurden nach den einführenden Statements der Speaker*innen die Implikationen von Trumps Präsidentschaft auf konkrete Konflikt- und Kriegsherde – beispielsweise den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den sich ausweitenden Nahost-Konflikt – eingegangen und deren integrale Bedeutung für die globale Sicherheit thematisiert. In der anschließend geöffneten Diskussion standen vor allem die Rolle und Positionierung der Friedens- und Konfliktforschung in einer sich neu strukturierenden globalen Ordnung im Fokus. Neben den bereits heute sichtbaren Implikationen wurde auf implizite Folgen dieser Umstrukturierungen, insbesondere im Hinblick auf die Situation der Zivilgesellschaft in den USA, Deutschland, Indien und China eingegangen. Auch der partiell sehr starke Fokus der Friedens- und Konfliktforschung auf klassisch sicherheits- und militärpolitische Aspekte war Teil einer kritischen Diskussion.
Auch die Podiumsdiskussion »Friedens- und Konfliktforschung in der ‚Zeitenwende‘: Welche Forschung, wie gefördert, wie vermittelt?«, moderiert von Madita Standke-Erdmann (King’s College London), knüpfte an das Thema der (Neu-)Ausrichtung der Friedens- und Konfliktforschung in neuen globalen Realitäten an. Dabei näherten sich Dr. Thomas Held (Deutsche Stiftung Friedensforschung), Prof. Dr. Jana Hönke (Universität Bayreuth, Forschungsverbund »Deutungskämpfe im Übergang«), Dr. Christina Norwig (Bundesministerium für Bildung und Forschung) und Prof. Dr. Jonas Wolff (Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Forschungsverbund »TraCe«)) aus ihren jeweiligen (wissenschaftlichen) Hintergründen der zentralen Frage nach Forschung, Förderung und Vermittlung.
Die von Timothy Williams (Universität der Bundeswehr München) geleitete Fishbowl-Diskussion »In Times of Geopolitical Upheaval – Who Still Cares About the Global South?« beleuchtete die geopolitischen Verwerfungen und deren Auswirkungen auf den Globalen Süden. Dabei wurde insbesondere betont, dass es sich bei vielen der gegenwärtigen Krisen nicht um neue Phänomene handelt, sondern um Kontinuitäten historischer Entwicklungen. Auch die homogenen Annahmen des Globalen Nordens über den Globalen Süden wurden unter Verweis auf sehr verschiedene politische Systeme, Ideologien und Interessenslagen Systeme kritisiert. In diesem – wie in vielen anderen Kontexten des Kolloquiums – wurden auch die weitreichenden Implikationen des Gaza-Kriegs thematisiert.
Ebenfalls tagten die Arbeitskreise der AFK zu themenspezifischen Aspekten wie Theorie, Abrüstung und Rüstungsdynamiken, Herrschaftskritik, Curriculum und Didaktik, Friedenspädagogik und Natur, Ressourcen und Konflikte.
Insbesondere in den Panels wurde der interdisziplinäre und intergenerationelle Dialog deutlich. So entwickelte sich im Peer-to-Peer-Austausch eine spannende Dynamik zwischen jungen und älteren Forscher*innen, die beidseits neue Ideen, Ansätze und Perspektiven angestoßen hat. Die Panels beschäftigten sich unter anderem mit:
- Wissenschaftsfreiheit in Zeiten des Krieges,
- Konzepten nuklearer Gerechtigkeit sowie Dynamiken globaler Aufrüstung,
- der Rolle der feministischen Außenpolitik in der sich wandelnden globalen Ordnung,
- Herausforderungen der Friedens- und Konfliktforschung in Bezug auf emotionale, ethische und methodische Dimensionen in sensiblen Konfliktkontexten,
- dekolonialen Perspektiven auf Wissenschaft, Politik, Gender und Konflikte im Kontext von Frieden und Sicherheit,
- dem Klimawandel als Konfliktthema zwischen Populismus und Radikalprotesten, als auch die Lösung klimabezogener Konflikte in einer globalisierten Welt,
- Konflikt-Narrativen, zugrundeliegenden Diskursen, Erinnerungskultur und indigenen Perspektiven auf (die Prävention) von Massengräueltaten,
- effektiven Friedensinterventionen.
Kolloquium der jungen AFK – Christiane-Rajewsky-Preis
Durch ihre aktive Nachwuchsförderung unterstützt die AFK early-career Forscher*innen. So wurden auch in diesem Jahr zwei hervorragende Arbeiten mit dem Christiane-Rajewsky-Preis 2025 ausgezeichnet. Anna Laetitia Rauchenwald von der Universität Wien erhielt diese Auszeichnung für ihre Masterarbeit »Die Politische Ökonomie europäischer militarisierter Außenpolitik am Beispiel der EFF-finanzierten EU-Missionen in Mali und Niger«. Für die beste Dissertation wurde Sara Daub mit ihrer Arbeit »External Diaspora Sponsorship to Rebel Organizations: Causes and Consequences« an der Hertie School prämiert. Eine detaillierte Beschreibung beider Arbeiten kann auf der neuen Website der AFK eingesehen werden.
Darüber hinaus tagte die Junge AFK vom 18.03.-19-03-2025 unter dem Titel »Von Fake News bis Cyberwar: Aktuelle Herausforderungen und Ansätze in der Friedens- und Konfliktforschung«. Das Kolloquium bot engagierten jungen Wissenschaftler*innen die Möglichkeit, sich in einem multidisziplinären und diversen Umfeld über die essentiellen Fragestellungen unserer Zeit auszutauschen, zu vernetzen und die eigene Position kritisch zu reflektieren.
Der Umgang mit Wissenschaftsfreiheit in Zeiten massivster globaler Herausforderungen zog sich omnipräsent durch alle Diskussionsformate und wurde aus unterschiedlichsten Blickwinkeln kritisch beleuchtet, diskutiert und neu gedacht, bleibt aber weiterhin eine der zentralen Aufgaben der Friedens- und Konfliktforschung.
Amelie Sieber