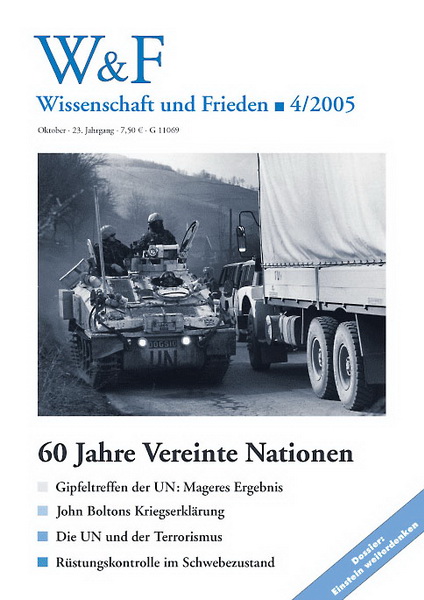Neue Sicherheitsdiskurse
Vom »erweiterten Sicherheitsbegriff« zur globalen Konfliktintervention.
von Lothar Brock
Seit Ende der 1980er Jahre vollzieht sich auf breiter Front eine rhetorische »Versicherheitlichung« von nicht-militärischen Politikfeldern: Hunger, Armut, Umweltzerstörung, Diskriminierung und neue Krankheiten (Aids) werden als nicht-militärische Gefährdungen von Sicherheit ausgewiesen. Die Anstöße dazu kamen aus der Zivilgesellschaft. Sie hoffte, mit Hilfe eines »erweiterten Sicherheitsbegriffs« Aufmerksamkeit und Ressourcen für die von ihr vertretenen Anliegen zu mobilisieren und die Sicherheitspolitik zu entmilitarisieren. Was ist erreicht worden? Heute ist der »erweiterte Sicherheitsbegriff« eine Standardformel, auf die sich auch die Hohe Politik gerne beruft – vom Sicherheitsrat der UNO bis zum Nationalen Sicherheitsrat der USA. Das High Level Panel, das im Dezember 2004 seinen Bericht zur Reform der UNO veröffentlichte, und Generalsekretär Kofi Anan, dem dieser Bericht als Vorlage für die eigenen Vorschläge diente, gingen ebenso wie der Sachs-Bericht zu den Millennium Development Goals von einem erweiterten Sicherheitsbegriff aus. Das wurde allgemein mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Ein Durchbruch auf der ganzen Linie? Zweifellos. Aber der vom Generalsekretär angestrebten Reform der Vereinten Nationen hat das nicht viel geholfen, und der Erfolg, den das allseitige Bekenntnis zu einem erweiterten Sicherheitsbegriffs bedeutet, könnte sich noch als Pyrrhussieg erweisen – dann nämlich, wenn die Militärpolitiker aus der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs mehr Nutzen zögen als die Befürworter einer zivilen Konfliktbearbeitung. Ob eine solche Befürchtung berechtigt ist und was daraus gegebenenfalls folgen würde, soll hier in aller gebotenen Kürze erörtert werden.1
Die bisherige Bilanz der neuen Sicherheitsdiskurse ist gemischt. Auf der einen Seite ist es unter Berufung auf einen erweiterten Sicherheitsbegriff zu einer erstaunlichen Ausdifferenzierung nicht-militärischer Formen der Konfliktbearbeitung gekommen. Seit Beginn der 1990er Jahre hat sich eine regelrechte »Industrie« zur konzeptionellen Innovation auf dem Gebiet der zivilen Konfliktintervention, der Krisenprävention und der Friedenskonsolidierung herausgebildet. Diese Entwicklung ist von Anfang an in enger Wechselwirkung von Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik vonstatten gegangen und hat inzwischen zu einer Professionalisierung der zivilen Konfliktbearbeitung geführt, die über das hinausgeht, was die Agenda für Frieden des damaligen UN-Generalsekretär, Boutros Boutros-Ghali, 1992 erwarten ließ. Was dabei die Bundesrepublik Deutschland betrifft, so ist die Kooperation zwischen dem BMZ und der GTZ auf der einen Seite, und den auf dem Gebiet der zivilen Konfliktbearbeitung tätigen Nicht-Regierungsorganisationen und kirchlichen Einrichtungen im Rahmen der Gruppe Friedensentwicklung2 institutionalisiert worden. Die Bundesregierung unterstützt die Ausbildung von Friedensfachkräften und hat selbst beim Auswärtigen Amt ein Zentrum für Internationale Friedenseinsätze eingerichtet, das u.a. Personal für die inzwischen zur Routine gewordenen Friedensmissionen der Vereinten Nationen ausbildet. Die Bundesregierung hat außerdem in engem Austausch mit der hiesigen Zivilgesellschaft einen Aktionsplan »Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung« erarbeitet und im Mai 2004 verabschiedet. Sie schließt damit an Länder wie Großbritannien, die Niederlande und Norwegen an, die auf dem Gebiet der zivilen Konfliktbearbeitung eine Avantgardefunktion erfüllen.
Aber der Auf- und Ausbau der zivilen Konfliktbearbeitung ist keineswegs gleichbedeutend mit einem Rückgang militärischer Interventionspraktiken. Im Gegenteil. Die verstärkten Bemühungen um eine Zivilisierung der Konfliktbearbeitung korrelieren zeitlich mit einer Ausweitung militärischer Einsatzoptionen. Die Territorialverteidigung weicht der globalen militärischen Konfliktintervention. NATO und EU sind dabei, sich militärische Eingreifverbände zuzulegen, die in kurzer Zeit an beliebigen Orten der Welt eingesetzt werden können. Die Bundeswehr ist heute mit 7.200 Soldatinnen und Soldaten an Friedensmissionen beteiligt. Tendenz steigend. Dem stehen 5.000 internationale Fachkräfte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gegenüber.3 Tendenz gleichbleibend, wenn nicht fallend.4 Diese Entwicklung ist teilweise eingebunden in Bemühungen um einen Ausbau kollektiver Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen nach Kapitel VII der UN-Charta. Das ist erfreulich. Aber die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs geht auch mit einer Erweiterung des Begriffs der Verteidigung (Art. 51 UN-Charta) einher und auf diesem Wege mit einer »Enttabuisierung des Krieges«5 als Mittel der internationalen Politik. Die kollektive Friedenssicherung steht dementsprechend unter dem Vorbehalt der einzelstaatlichen Gewaltanwendung, heute mehr als bei der Ausformulierung der Agenda für Frieden. Und nicht nur das: Während der erweiterte Sicherheitsbegriff in aller Munde ist, drohen die Hauptprotagonisten einer diesem Begriff entsprechenden Politik, die liberalen Demokratien, sich selbst zu Sicherheitsstaaten zu wandeln, in denen die Freiheit des Einzelnen erneut unter den Vorbehalt behördlicher Ermessensentscheidungen gestellt wird.6
Die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs, so meine These, ist politisch ambivalent: sie kann genutzt werden, um die Forderung nach ziviler Konfliktbearbeitung zu unterstreichen, aber ebenso dazu, eine Erweiterung militärischer Sicherheitspolitik nach außen und die Einschränkung bürgerlicher Rechte und Freiheiten nach innen zu rechtfertigen. Dieser politischen Ambivalenz des Begriffs entspricht seine analytische Unschärfe. Er eskamotiert Widersprüche und Zielkonflikte statt sie aufzudecken. An die Stelle einer Analyse des Zusammenhangs zwischen wirtschaftlicher Marginalisierung, Diskriminierung, Staatszerfall, kultureller Fremdbestimmung, Aufkommen neuer Krankheiten und Gewalt tritt die rhetorische Gleichschaltung der einschlägigen Politikfelder (Entwicklungszusammenarbeit, Aids-Bekämpfung, Stärkung des Sicherheitssektors und Anerkennung kultureller Differenz als Sicherheitspolitik). Diese Unschärfe des erweiterten Sicherheitsbegriffs ist einer der Gründe für seine politische Ambivalenz. Da er alles meint, kann sich jeder bedienen. Und nicht nur das: die Erweiterung des Sicherheitsbegriffs ist gleichbedeutend mit einer Erweiterung des Spektrums von Bedrohungen, mit denen die Menschen konfrontiert werden. Die Ausweitung von Bedrohungsgefühlen aber fördert nach aller Erfahrung eher die Akzeptanz militärischer Vorsorge oder militärischer Eingriffe in akute Konflikte als die politische Bereitschaft, sich auf langwierige zivile Formen der Konfliktbearbeitung einzulassen. Von daher besteht kein Anlass, die Anerkennung neuer Bedrohungen und jetzt auch der »responsibility to protect«7 durch die Hohe Politik als Durchbruch zu einer anderen Sicherheitspolitik zu feiern.
Vom Frieden zur (Un-)Sicherheit
In den frühen Jahren der Friedens- und Konfliktforschung wurde über den Friedensbegriff gestritten. Dabei ging es vor allem um die Unterscheidung zwischen negativem und positivem Frieden. Der negative Friede galt weitgehend als unzulänglich; denn er konnte ja auch einen Friedhofsfrieden, einen Frieden der gewaltsamen Befriedung umfassen und sich als trügerischer Firnis über struktureller Gewalt erweisen. Die flächendeckende Militarisierung politischer Herrschaft in Lateinamerika im Verlaufe der 1970er Jahre bot dafür in der Tat ein niederschmetterndes Beispiel. Der Frieden wurde dort mit Hilfe einer brutalen Repression hergestellt. Folgerichtig wurden die nationalen Befreiungskriege von Vielen als Kriege zur Herstellung eines positiven Friedens (stillschweigend) gerechtfertigt. Aber mit Blick auf die Konfrontation der Supermächte und die Möglichkeit eines Nuklearkrieges hatte der negative Friede doch auch eine positive Seite, und diese positive Seite wurde mit dem Begriff der Sicherheit belegt.
Paradoxerweise rückte der Sicherheitsbegriff im Laufe der 1980er Jahre in dem Maße in den Vordergrund der einschlägigen Debatten, in dem die Gefahr eines Nuklearkrieges zurückging – bis hin zu dem Punkt, an dem der Friedensdiskurs zu einem Sicherheitsdiskurs wurde.8 Der vollständige Umschlag erfolgte spätestens mit dem Ende des Ost-West-Konflikts. Das Kunststück, mit dem dies ohne Gesichtsverlust der Friedensbewegung geschehen konnte, bestand in dem Rekurs auf einen »erweiterten Sicherheitsbegriff«, der den Vorteil bot, für all das zu stehen, was man sich unter einem positiven Frieden nur wünschen konnte. Der erweiterte Sicherheitsbegriff ermöglichte es zugleich, jene Gefühle und Bedürfnisse wohlwollend anzusprechen, die in der alten Zuordnung zum negativen Frieden nur unzulänglich und mit einem pejorativen Unterton erfasst worden waren. Diese Gefühle (das Unbehagen an gewaltsam ausgetragenen Konflikten, also auch an Befreiungskriegen) und Bedürfnisse (nach Sicherheit in rasantem Wandel) wollten Friedens-, Umwelt-, Solidaritäts- oder Menschenrechtsgruppen nunmehr strategisch nutzen, um der Hohen Politik die Agenda streitig zu machen und mehr öffentliche Aufmerksamkeit sowie mehr finanzielle Mittel für Zwecke zu mobilisieren, die bis dahin eher als »low politics« galten: den Schutz der Umwelt, die Durchsetzung der Menschenrechte, die Aufhebung der Geschlechterdiskriminierung, die Anerkennung kultureller Differenz und nicht zuletzt den Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit.
Wie die Einführung des Begriffs »soziale Sicherheit« dazu beigetragen hat, die öffentliche Absicherung privater Lebensrisiken als (Rechts-) Anspruch des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft zu untermauern, genauso haben die neuen internationalen Sicherheitsdiskurse dazu beigetragen, die zivile Konfliktbearbeitung als Standard angemessenen Verhaltens aufzuwerten. Die zweite große Errungenschaft der neuen Sicherheitsdiskurse besteht zweifellos darin, dass der Einzelne als Objekt der internationalen Sicherheitspolitik gegenüber der bislang vorherrschenden Fixierung auf den Staat in das Blickfeld der internationalen Politik gerückt worden ist. Das Denken in Kategorien der nationalen Sicherheit wird durch die Einführung der Kategorie der menschlichen Sicherheit zumindest ansatzweise aufgebrochen.
Wie sich heute auch hierzulande zeigt, bietet die »soziale Sicherheit« aber selbst dort, wo sie als Standard angemessener Ansprüche anerkannt wird, keine Sicherheit gegenüber dem Versuch, eine erneute Privatisierung der Vorsorge zu forcieren, wobei dies vorzugsweise als Maßnahme zur Rettung der sozialen Sicherheit unter sich wandelnden Umweltbedingungen (Globalisierung) »verkauft« wird. Genauso wenig bietet die allgemeine Akzeptanz eines erweiterten Sicherheitsbegriffs ein verlässliches Bollwerk gegen die Versuchung der Politik, bei wachsendem Handlungsdruck die zivile Konfliktbearbeitung als Follow up eines militärischen Eingriffs zu handhaben und dabei die »human security« unter die nationale Sicherheit zu subsumieren. Der politische Stellenwerte der »menschlichen Sicherheit« im Sinne der »responsibility to protect« wächst in dem Maße, in dem sie mit den so verstandenen nationalen Sicherheitsinteressen potentieller Interventen übereinstimmt. Das zeigt sich gerade in Verbindung mit den militärischen Großereignissen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts, nämlich mit dem Kosovo-Krieg sowie den Kriegen gegen die Taliban und das Saddam-Regime im Irak.
Von der Sicherheit zum Krieg
Was den Kosovo-Krieg betrifft, so stand hier zwar der demonstrative Bezug auf die Sicherheit von Menschen gegenüber der Sicherheit von Staaten im Vordergrund. Es kann aber weiterhin bezweifelt werden, dass die Möglichkeiten der zivilen Konfliktintervention (z.B. im Rahmen der OSZE-Mission) tatsächlich ausgeschöpft worden waren, als im Oktober 1998 die Entscheidung der NATO zur militärischen Konfrontation (mit der späteren Folge des Krieges) fiel. Auch die Verhältnismäßigkeit des Militäreinsatzes ist weiterhin umstritten, da die Gefährdung menschlicher Sicherheit im Krieg drastisch zunahm (was eigentlich niemanden überraschen konnte). Darüber hinaus stellte der Kosovo-Krieg den Einstieg in eine Völkerrechtspolitik dar, die darauf abzielt, den einzelstaatlichen Handlungsspielraum bei der Anwendung von Gewalt gegenüber den Restriktionen der UN-Charta auszuweiten. Diese Politik kam gegenüber Afghanistan und Irak voll zum Zuge. In beiden Fällen beriefen sich die USA zwar auf Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Dies geschah aber in einer Weise, die die Anwendung von Gewalt in das weitgehend freie Ermessen der intervenierenden Staaten stellte.
Dieser Völkerrechtspolitik traten die zivilgesellschaftlichen Sicherheitsdiskurse zwar in aller Regel entgegen, anderseits waren sie selbst an ihrer Herausbildung ungewollt beteiligt. Unter dem Eindruck des Ausmaßes der Gewalt in zahlreichen innerstaatlichen Konflikten und der Schwierigkeit zu bestimmen, wie auf diese Gewalt angemessen reagiert werden könne, bedienten sich die zivilen Sicherheitsdiskurse des Vokabulars der »neuen Kriege«, der »humanitären Intervention« und selbst des »gerechten Krieges«. Das Reden von den »neuen Kriegen« trug dazu bei, ein breites öffentliches Interesse für die Gewaltkonflikte im Süden und im ehemaligen sozialistischen Lager zu wecken. Zugleich suggerierte es, dass die alten völkerrechtlichen Regeln gegenüber diesen neuen Kriegen nicht mehr gelten konnten (und sollten). Die rasche Verbreitung der Denkfigur der »humanitären Intervention« konnte einerseits als Ausdruck der »Macht der Moral« verstanden werden, bedeutete aber andererseits, dass es fortan gegenüber den Staaten, in denen die »neuen Kriege« stattfanden, zweierlei Souveränität geben würde – die unantastbare Souveränität der liberalen Demokratien, die nicht bereit waren und sind, sich in verbindlicher Form einer kollektiven Friedenssicherung zu unterwerfen, und die eingeschränkte Souveränität der »failed states« oder der Schurkenstaaten, denen gegenüber sowohl das Interventionsverbot der UN-Charta (Art. 2/7) als auch das Gewaltverbot (Art. 2/7) nicht gelten sollen. Hier drängt sich ein Vergleich mit den Gefangenen in Guantanamo auf, denen wie den Schurkenstaaten ein Anspruch auf einschlägigen Rechtsschutz abgesprochen wird.
Das inzwischen wieder abflauende Reden von der »humanitären Intervention« unterstützte insofern die auf Handlungsfreiheit ausgerichtete Völkerrechtspolitik der liberalen Demokratien, als es die Unterscheidung zwischen kollektiver Friedenssicherung nach Kapitel VII der UN-Charta und einer unilateralen oder bündnisgestützter Ausübung von Zwangsgewalt verwischte. Wenn Menschen in Not sind, so unterstellt die Denkfigur der »humanitären Intervention«, ist das eine hinreichende Rechtsgrundlage für ein Eingreifen – zumal wenn der Sicherheitsrat als einzige Instanz, die die Anwendung von Gewalt autorisieren darf, nicht handlungsfähig ist oder zu sein scheint.
Dieser Effekt war bei der Rückbesinnung auf den »gerechten Krieg« noch deutlicher. Wie sattsam diskutiert, kann die Lehre ebenso zur Legitimation wie zur Kritik von Kriegen herangezogen werden. Aber der Streit darüber, ob ein Krieg gerecht oder ungerecht sei, geht an der Sache vorbei. Das Konzept selbst ist »ungerecht«, da es einer Logik verhaftet bleibt, nach der der Einzelstaat in einem Streit zugleich Partei und (Rechts-) Instanz ist. In diesem Sinne liegt das ausschlaggebende Problem darin, dass dieser Ansatz es letztlich dem Einzelstaat vorbehält, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit militärischen Handelns zu befinden. Damit höhlt auch dieses Konzept die Idee der kollektiven Friedenssicherung nach Kapitel VII der UN-Charta aus.
Selbst die Denkfigur der »menschlichen Sicherheit« ist nicht ganz so unschuldig, wie sie daher kommt. Die Aufwertung von Menschen gegenüber Staaten als Subjekte legitimer Sicherheitsansprüche stützte die Argumentation, dass es eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft zum Schutz von Menschen vor rechtloser Gewalt gibt. Die Anerkennung dieser Verantwortung ist ein Fortschritt, der sich auch in der Aufwertung des Einzelnen als Völkerrechtssubjekt (vor allem im Bereich der Menschenrechte) zeigt. Wenn aber die Wahrnehmung der internationalen Verantwortung nicht an feste Regeln gebunden wird, erweitert das Reden in Kategorien der »menschlichen Sicherheit« das Spektrum der Gründe, die für eine interventionistische Politik ins Feld geführt werden können. In diesem Sinne warnt das BMZ zu Recht vor der Gefahr, durch den Bezug auf einen humanitär begründeten Handlungsbedarf „eine völkerrechtliche Beliebigkeit zu fördern, die Schwellen für militärische Lösungen abzusenken sowie Weiterentwicklung und Nutzung ziviler, vor allem präventiver Handlungsmöglichkeiten in den Hintergrund treten zu lassen.“9
Von der erweiterten Sicherheit zum Schutz vor rechtloser Gewalt
Um dieser Gefahr entgegenzutreten, plädiere ich für einen engen Sicherheitsbegriff, nämlich Sicherheit als Schutz vor rechtloser Gewalt. Das eröffnet die Möglichkeit, die Aufgabenstellung der Sicherheitspolitik zu präzisieren. Es geht nicht um das gute Leben an sich, sondern um die Aufgabe, Menschen zu befähigen, ihre Konflikte ohne Anwendung von Gewalt auszutragen. Dieser Aufgabe sind insofern Grenzen gesetzt, als die Fähigkeit zu gewaltfreiem Konfliktaustrag nie gleichmäßig und umfassend ausgebildet werden kann. Deshalb ist der »zivilisatorische Prozess« nicht gleichbedeutend mit der Überwindung von Gewalt, sondern mit der Eindämmung rechtloser Gewalt, also der Selbstjustiz. Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist dementsprechend das allgemeine Gewaltverbot und das Gebot der friedlichen Streitbeilegung (Kapitel VI UN-Charta) mit Vorkehrungen zur kollektiven Friedenssicherung (Kapitel VII) verbunden worden, die die Anwendung von Zwangsgewalt nach Ausschöpfung aller anderen Mittel einschließt. Daraus folgt zweierlei: Der Vorrang der zivilen vor der militärischen Konfliktintervention und die Bindung militärischer Konfliktintervention an das Regelsystem der Charta. Bei der Gewährleistung von Sicherheit als Schutz vor rechtloser Gewalt bezieht sich das Kriterium »Recht« also immer auf beides: die Situation vor Ort und die Art und Weise, wie in diese Situation eingegriffen wird. Der so verstandene enge Sicherheitsbegriff ist also reflexiv. Er schließt die Selbstbeobachtung der Sicherheitspolitik als Politik, die ständig in Gefahr ist, neue Unsicherheit zu produzieren, ein.
Bei genauerer Betrachtung geht es auch bei der zivilen Konfliktbearbeitung nicht um einen weiten, sondern um einen engen Sicherheitsbegriff wie er hier verstanden wird. Auch die Idee der zivilen Konfliktbearbeitung konstatiert einen Primat der zivilen vor der militärischen Konfliktbearbeitung und die strikte Bildung militärischer Eingriffe an die Regeln des UN-Systems. Die Idee der zivilen Konfliktbearbeitung beruft sich insofern unnötiger und – wie oben gezeigt wurde – fahrlässigerweise auf einen erweiterten Sicherheitsbegriff. Unnötig ist der erweiterte Sicherheitsbegriff, weil er nichts zur normativen Begründung ziviler Konfliktbearbeitung (viel aber zur Verwirrung der Probleme, um die es geht) beiträgt; fahrlässig ist die Berufung auf einen weiten Sicherheitsbegriff, weil er das normative Spannungsverhältnis zwischen ziviler und militärischer Konfliktbearbeitung in der Denkfigur einer umfassenden Sicherheitspolitik aufhebt. Einem Sicherheitsbegriff, der als Schutz vor rechtloser (physischer) Gewalt verstanden wird, ist demgegenüber die Kritik der Gewalt eingeschrieben. Das schließt die Unterscheidung zwischen gesetzlicher und gesetzloser Gewalt ein, weil die Differenz zwischen beiden ja nicht der Politik vorgegeben ist, sondern von dieser selbst (z.B. im Weg der Völkerrechtspolitik) beeinflusst wird. Auf jeden Fall aber ist der Modus der Gewaltanwendung stets selbst Thema eines engen Sicherheitsbegriffs.
Beim Aktionsplan der Bundesregierung vom Mai 2004 ist bemängelt worden, dass er bei der Auflistung von 160 Maßnahmen zur zivilen Konfliktbearbeitung auf politische Prioritätensetzungen verzichtet.10 Er könnte sich von daher als vergebliche Liebesmühe erweisen, da er selbst dem Muster des erweiterten Sicherheitsbegriffs folgt, nämlich gute Dinge zu addieren, wo es eigentlich darum ginge, eine Problematik zu strukturieren. Ein enger Sicherheitsbegriff bzw. die Konzentration auf ein Kernanliegen der Sicherheitspolitik (Schutz vor rechtloser Gewalt) könnte auch in dieser Hinsicht nützlich sein.
Anmerkungen
1) Zu weiteren Überlegungen siehe Lothar Brock, 2004: Der erweiterte Sicherheitsbegriff – Keine Zauberformel für die Begründung ziviler Konfliktbearbeitung, in: Die Friedenswarte 79, Heft 3-4, 323-344; Ders. 2001: Sicherheitsdiskurse ohne Friedenssehnsucht. Zivilisatorische Aspekte der Globalisierung, in: Ruth Stanley (Hrsg.): Gewalt und Konflikt in einer globalisierten Welt. Festschrift für Ulrich Albrecht, Opladen: Westdeutscher Verlag; Ders. 1998: Umwelt und Konflikt in der internationalen Forschung, in: Alexander Carius/Andreas R. Kraemer (Hrsg.): Umwelt und Sicherheit – Herausforderung für die internationale Politik, Berlin: Springer, 39-56.
2) Es handelt sich um eine Arbeitsgemeinschaft von BMZ und GTZ sowie dem Evangelischem Entwicklungsdienst, Misereor, der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Plattform zivile Konfliktbearbeitung, dem Konsortium Ziviler Friedensdienst und dem Institut für Entwicklung und Frieden der gleichnamigen Stiftung.
3) BMZ 2004: Zum Verhältnis von entwicklungspolitischen und militärischen Antworten auf neue sicherheitspolitische Herausforderungen (BMZ-Diskurs 1), Bonn, S. 5.
4) Das ist allerdings ein bewusstes Ziel der Entwicklungspolitik, die seit Jahren das Ziel verfolgt, internationale durch einheimische Fachkräfte zu ersetzen. Ibid., S. 12.
5) Geis, Anna 2005: Die Zivilmacht Deutschland und die Enttabuisierung des Militärischen, HSFK-Standpunkte 2.
6) Braml, Josef 2004: Vom Rechtsstaat zum Sicherheitsstaat? Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte durch die Bush-Administration, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 45, 6-15.
7) International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Ottawa: International Development Research Center 2001
8) Krell, Gert 1980: Die Entwicklung des Sicherheitsbegriffs, in: Beiträge zur Konfliktforschung, 10. 03., S. 33-57.
9) BMZ 2004 (Anm. 3), S. 11.
10) Debiel, Tobias 2004: Wie weiter mit effektiver Krisenprävention?, in: Die Friedenswarte, 79, Heft 3-4, 253-298.
Prof. em. Dr. Lothar Brock ist Forschungsgruppenleiter der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und Vorsitzender der Kammer für Entwicklung und Umwelt der EKD