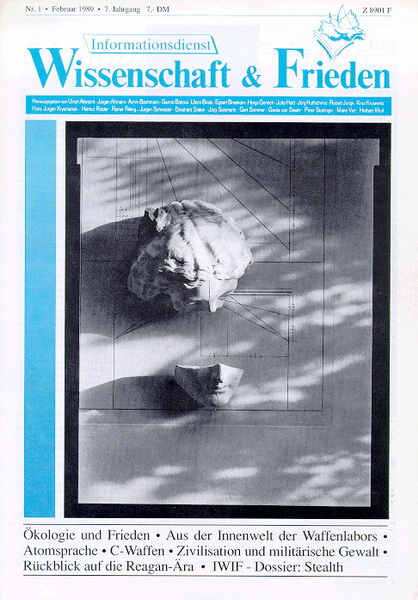Ökologie und Frieden*
von Günter Altner
Unser desolates Verhältnis zur Natur ist seit langem durch bestimmte Weichenstellungen geprägt worden, die wir so ohne weiteres nicht aufzulösen vermögen. So möchte ich in meinem Referat, im Sinne einer kritischen Aufarbeitung, auf diesem Weg in die Vergangenheit zurückgehen.
Ich habe vor das in vier Schritten zu tun:
- Einige kurze Bemerkungen zur Situation der Krise zwischen Menschen und Natur.
- Der Ruf nach Frieden und Versöhnung mit der Natur erfordert eine tief in die Geschichte zurückgehende Aufarbeitung.
- Die Wiederentdeckung des Eigenwertes der Natur und die daraus resultierenden Verpflichtungen für Wissenschaft und Technik.
- Neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Austragungsmuster zur Gewährleistung von mehr Frieden mit der Natur.
Die Krise zwischen Mensch und Natur
Man darf nicht verkennen, daß in den letzten zwei Jahrzehnten zugunsten des Umweltschutzes viel geschehen ist. Das Umweltbewußtsein hat sich in einem Maße vertieft, wie wir es vor ein oder zwei Jahrzehnten nicht erwarten konnten. Die Umweltpolitik ist zu einem zentralen Bereich politischen Handelns geworden, zahlreiche Umweltgesetze regulieren den Verbrauch der Natur. Die Staaten schließen über Grenzen hinweg Umweltabkommen. Inzwischen bestreitet niemand mehr, daß etwas geschehen muß im Verhältnis von Mensch und Natur. Über die Notwendigkeit des Umweltschutzes kann man sich auch spontan über Grenzen hinweg mit Wissenschaftlern aus dem Ostblock oder mit Vertretern aus den Entwicklungsländern verständigen. Und dennoch haben wir in den zurückliegenden Jahren den großen Ausverkauf der Natur nicht bremsen können. So ist es zwar gelungen, durch die Festlegung von Grenzwerten, national den Anteil von einzelnen Schadstoffen in Luft und Wasser zu senken, aber dafür ist der Anteil von einzelnen Schadstoffen, deren Auswirkungen wir im einzelnen noch nicht kennen, gestiegen. Und weltweit galoppiert der Artentod, sterben die Wälder, kranken die Seen, erwärmt sich das Klima, reißt über allem das Ozonloch auf.
Auf allen Gebieten, auf denen die Menschen bisher unter sich zu sein glaubten, »mischt« sich irgendwie die Natur dazwischen: Als Lebensgrundlage, aber vor allem heute als Müll, als Gift, als Strahlung, als Krankheit... Und überall dort, wo wir meinten, Natur auf Grund der von uns erkannten Gesetzmäßigkeiten einfach benutzen zu können, offenbart die Natur nun ihr gesellschaftliches Antlitz, als Müllproblem, als Krankheit, als Angst vor Verstrahlung, als Weltklimaproblem. Natur und Gesellschaft, Schöpfung und Menschheit sind im Prozeß der industriellen Moderne zu einer ebenso widersprüchlichen wie unauflösbaren Einheit geworden. Und diese Einheit hat die Gestalt der Überlebenskrise.
Wir müssen lernen, mit allem, was wir tun, auch der Natur Rechnung zu tragen, sie in unsere sozialen Bemühungen mit einzubeziehen, anderenfalls verwirken wir das Leben, belasten wir die Zukunft unserer Kinder. So wie die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert die Berücksichtigung der sozialen Frage unabdingbar machte, so stehen wir heute vor der ernsthaften Entscheidung, der irdischen Schöpfung entweder das Ihre zukommen zu lassen oder mit ihr unterzugehen. Aus dieser Situation kommt der Ruf nach Frieden und Versöhnung mit der Natur. Aber geht das nach der Entwicklung, die hinter uns liegt?
Der Psychotherapeut Martin Schrenk setzt hinter die vielfachen Anläufe und Versuche zu einer Versöhnung mit der Natur ein großes Fragezeichen. Er fragt: Kann Versöhnung mit der Natur überhaupt möglich sein? Wäre das nicht so, wie wenn einer im Nürnberger Gerichtssaal oder Eichmann in seiner Glaskabine den Juden zurufen wollte: Ich will mich mit Euch versöhnen! Schrenk will hier auf die Tatsache aufmerksam machen, daß diejenigen, die Natur im Zuge einer langen Entwicklung von Wissenschaft, Technik und Industrie unterworfen und ausgebeutet haben, heute nun vorschnell aus Überlebensinteressen die Versöhnung mit der Natur ausrufen, ohne in eine tiefe Aufarbeitung und Nachdenkarbeit eintreten zu wollen. Vor jeder Suche nach einer Möglichkeit der Versöhnung mit der Natur muß das Eingeständnis der Schuld, muß ein Schuldbekenntnis stehen. Auch das ist wiederum ein schwieriger Punkt. Schuld, Schuldbekenntnis, Schuldaufarbeitung zwischen Menschen, das mag etwas sein, was wir verstehen, was wir auch zu vollziehen vermögen – aber kann das auch auf das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, mit Blick auf das, was zwischen uns gewesen ist, übertragen werden? Margarete Mitscherlich sagt, Trauer ist ein seelischer Vorgang, in dem ein Individuum einen Verlust mit Hilfe eines wiederholten schmerzlichen Erinnerungsprozesses langsam zu ertragen und durchzuarbeiten lernt, um danach zu einer Wiederaufnahme lebendiger Beziehungen zu den Menschen und den Dingen seiner Umgebung fähig zu werden. Gäbe es eine Möglichkeit, in einer Rückschau auf die europäische Wissenschafts-, Technik- und Industriegeschichte eine Trauerarbeit zu leisten, die uns in die Lage versetzt, zu einem neuen, lebendigen Umgang mit der Natur fähig zu werden?
Aufarbeitung der Geschichte
Das Bewegende an der Ökologiediskussion des letzten Jahrzehnts ist nicht zuletzt, daß zahlreiche Versuche einer solchen Aufarbeitung nach rückwärts stattgefunden haben. Aus diesen Denkansätzen und Traditionen heraus möchte ich ihnen drei Beispiele dieser zurückblickenden Aufarbeitungsarbeit vorführen. Sie reichen verschieden weit in die Geschichte des Lebens, in die Geschichte der Menschheit und speziell in die Geschichte der europäischen Menschheit zurück. Sie sprechen ganz verschiedene Stränge an, Stränge, die nur für unser heutiges Verhältnis zwischen Mensch und Natur unter dem Gesichtspunkt von Ökologie und Technik wichtig zu sein scheinen.
Da gibt es die Biologen, sie rätseln heute über die Bestimmung des Menschen. Ist der Mensch vielleicht doch eine biologische Fehlkonstruktion? Geht er an der Virulenz seines Großhirns zugrunde, wie die Säbelzahntiger ein Opfer ihrer überdimensionierten Zähne wurden? Das Großhirn ein gefährliches Belastungsorgan? Andere Biologen verweisen bedeutungsschwer auf die ungehemmte menschliche Aggression. Und dies in einer Art, da die großen Hoffnungen längst zeronnen sind, mittels Verhaltensforschung und unter Befragung der Graugänse Handlungsanweisungen für die Politik abzuleiten. Damals, – so lautet die These – unter den Voraussetzungen des Überlebenskampfes zwischen den steinzeitlichen Horden, sei dem Menschen das ihn heute noch kennzeichnende Aggressionspotential angezüchtet worden, nur – und das sei eben der entscheidende Unterschied, – seien eben inzwischen aus den Keulen unserer Altvorderen Raketen und ABC-Waffen geworden.
Diese These mancher Biologen befriedigt uns nicht. Wenn man ihre Logik aufzudecken versucht, so lautet das Ergebnis: Es geschieht der Natur ganz recht, daß wir sie zerstören; sie hat uns ja so konstruiert, daß wir sie zerstören müssen. Das führt an der Entscheidungsfreiheit des Menschen vorbei. Hier wird gewissermaßen ein theoretischer Netzwurf über die Naturgeschichte geworfen und aus diesem biologischen Netzwurf gefolgert, der Mensch sei fehlkonstruiert. Aber natürlich kann man sich zu dieser Theorie verhalten und feststellen, daß in dieser Theorie nicht alle Denkmöglichkeiten zur Deutung des Menschen enthalten sind. Aus seinem gesellschaftlichen Bewußtsein kann der Mensch auch anders sein und anders handeln wollen.
Nicht ganz so weit zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte, sondern nur in die jüdisch-christliche Tradition führt ein weiterer Aufarbeitungsversuch, der wiederum ein gewisses Licht auf unsere gegenwärtige Situation werfen kann. Wolfgang Giegerich, ein Psychoanalytiker aus der Schule von C.G. Jung, hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „Die Atombombe als seelische Wirklichkeit. Ein Versuch über den Geist des christlichen Abendlandes“; mit einem Geleitwort von Herbert Pietschman, Ordinarius für theoretische Physik an der Universität Wien.1 Giegerich nimmt Bezug auf die jüdisch-christlichen Traditionen. Seine These: Es gebe in ihnen archetypisch vorweggenommen das, was sich in der Kernspaltung und im Bau der Atombombe und in der Anwendung der Atombombe später ereignet habe. Giegerich nimmt Bezug auf die bekannte Geschichte vom goldenen Kalb. Ich darf zur Auffrischung Ihres Gedächtnisses daran erinnern: Moses kommt vom heiligen Berg und kehrt zum Lager seines Volkes zurück. Er trifft das Volk dabei an, wie es ein goldenes Kalb verehrt, eine große Kulthandlung mit diesem goldenen Kalb vollzieht, und Moses zerstört das Kalb: „Er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten und zerschmelzte es im Feuer, zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser.“ Man kann auf jeden Fall, da hat Giegerich schon recht, diese Geschichte als eine urtypische Weichenstellung für die alttestamentlichen und selbst für die christlichen Traditionen in dem Sinne nehmen, daß der jüdisch-christlichen Frömmigkeit das Göttliche, das Heilige zu einem sehr frühen Zeitpunkt radikal aus der Natur herausgedrängt wurde. Und diesen Prozess der Verdrängung des Heiligen aus der Natur sieht Giegerich gewissermaßen als das Anfangsergebnis der Kernspaltung. Ich gebe ihm selber das Wort: „In Entsprechung zu den Kernspaltungen der Physik können wir die drei Aspekte der Ersten Kernspaltung folgendermaßen beschreiben.
- Die Göttlichkeit Gottes, die das erste Bestandstück des Bildes als solchen ausmacht, wird in den Himmel gehoben, oder eigentlich über alle Himmel hinaus, und wird rein spirituell. Sie leuchtet mit einer nie dagewesenen Intensität. Das ist das, was man heute in der Atomphysik bei der Kernexplosion »star« nennt.
- Das zweite Bestandstück des Bildes als solchen, das Irdisch-Sinnliche, wird durch die Abspaltung des Göttlichen zur (nicht mehr aus sich selbst heraus göttlichen) Schöpfung, das heißt zum Bloß-Natürlichen. Das ist die sogenannte nukleare Asche. Nukleare Asche gibt es also nicht erst als empirisches Resultat der buchstäblichen Kernexplosion dieses Jahrhunderts, die ganze Wirklichkeit ist vielmehr seit über zwei Jahrtausenden ontologisch nukleare Asche. Erst durch das Abstreifen der Göttlichkeit von der Welt wurde dies überhaupt in ihrer empirischen Nacktheit zugänglich und somit allmählich aufbereitet für eine freilich erst viel später einsetzende physikalische Forschung und technische Ausbeutung. Das was die Naturwissenschaften als ihre Gegenstände in den Blick fassen, ist nicht die ursprüngliche Natur, es ist immer schon ihre Asche. Das Gold des Goldenen Kalbes hätte gar nie einer chemischen oder physikalischen Analyse unterworfen, der Stier nicht für biologische Experimente benutzt werden können: weil das Prädikat Gott aus ihnen selbst hervorleuchtete.
- Die bei der Kernexplosion erfolgte Ausscheidung des Dritten der Zwei, der Bildlichkeit, brachte wie in der Physik die Freisetzung einer ungeheuren Energie. Diese freigesetzte Energie ist es, die erstens dem Gott den Schwung für das Abheben in die Transzendenz gab, die zweitens der Welt die Kraft für ihre Dämonisierung und für die immense Steigerung ihrer Wirklichkeit (ihres Wirklichseins) zuführte, wovon später zu handeln sein wird, und die drittens das erzeugte, was wir metaphysisch wie psychologisch den »Willen« nennen. Die uralte Geschichte von dem Goldenen Kalb ist also, im Zusammenhang der christlich-abendländischen Geschichte, zugleich auch der weit in die Zukunft vorausweisende Mythos von der Geburt des Willens im neuzeitlichen Sinn des Wortes, von der Geburt des neuzeitlichen Ichs, dessen innerstes Wesen der Wille ist.“ 2
Nun das ist, wie man so leger sagen würde, eine »steile« These. Aber eines ist an dieser These bedenkenswert und wird auch seit einiger Zeit lebhaft in der Theologie diskutiert: ob in diesem nüchternen Weltverhältnis, in diesem Abstrußen des Göttlichen von der Welt nicht eine entscheidende Weichenstellung zu sehen ist, die zu jener technisch-industriellen Kultur in Europa geführt hat, die so nirgendwo sonst auf der Erde entstanden ist.
Selbstverständlich gibt es auch im Alten Testament einen positiven Bezug zur Schöpfung, aber er ist nicht mehr dadurch definiert, daß das Heilige in der Natur anwesend gedacht wird, sondern dadurch, daß Schöpfung Geschenk ist, Existenzgrundlage aller Existenz, dem Menschen zu treuen Händen anvertrautes Gut, aber unbestreitbar durch eine abgrundtiefe Differenz vom Schöpfer selber getrennt. Das, so kann man sagen, sollte Geschichte machen. Insbesondere dann, als die Welt unter dem Einfluß von Wissenschaft und Technik zum Objekt des menschlichen Erkennens und zur natürlichen Ressource wurde.
An dieser Stelle gehe ich auf einen dritten Versuch der Aufarbeitung ein, der zeitlich wiederum ein Stück später anzusetzen ist, der uns an das Ende des Mittelalters und an den Anfang von neuzeitlicher Naturwissenschaft und Technik führt. Hier beziehe ich mich auf Carl Friedrich von Weizsäcker. Carl Friedrich von Weizsäcker hat in seinen Veröffentlichungen immer wieder davon gesprochen, daß von Galilei zur Atombombe ein schnurgerader Weg führe. Weizsäcker meint, es sei nicht nur die Rücksichtslosigkeit von Interessen, die Wissenschaft und Technik gefährlich und zerstörerisch gemacht habe. In der Erkenntnismethodik selber und in den durch sie ausgelösten technologischen Machbarkeiten liege das tiefere Problem des neuzeitlichen Fortschritts beschlossen. Die Welt als das Berechenbare, als die determinierbare, benutzbare Maschine, das war das Modell, dem man in den folgenden Jahrhunderten mehr und mehr Rechnung trug. Haeckel und Helmholtz sprachen im 19. Jahrhundert vom ewigen und unabänderlichen Kausalgesetz. Erst mit den erkenntnistheoretischen Umbrüchen in der Quantenphysik brach dieses Modell mechanistischen Herrschaftswissens zusammen. Hans Peter Dürr hat diesen Umbruch sehr plastisch geschildert. Der wesentliche Einbruch erfolgte durch die Quantenmechanik. War es bisher schon immer notwendig, bei ungenauer Kenntnis eines Zustandes auf ganz präzise Aussagen und insbesondere Vorhersagen zu verzichten, sich mit der Angabe ihrer Wahrscheinlichkeit zu begnügen, so stellt sich nun heraus, daß der Wahrscheinlichkeitscharakter von physikalischen Aussagen nicht allein von der subjektiven Unkenntnis herrührt, sondern im Naturgeschehen selbst eingeprägt ist. Eine noch so genaue Beobachtung aller Fakten der Gegenwart reicht prinzipiell nicht aus, um das zukünftige Geschehen vorherzusagen, sondern eröffnet nur ein bestimmtes Feld von Möglichkeiten, für deren Realisierung sich bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben lassen. Das zukünftige Geschehen ist also nicht mehr determiniert, nicht festgelegt, sondern bleibt in gewisser Weise offen. Das Naturgeschehen ist kein mechanistisches Uhrwerk mehr, sondern hat den Charakter einer fortwährenden Entfaltung. Die Schöpfung ist nicht abgeschlossen, die Welt ereignet sich in jedem Augenblick neu.
Hier fand das alte Bild von der Welt als Mechanismus und vom Menschen als Herrn und Meister der Natur ein Ende. Aber es wäre nun ganz irrig, wenn wir darauf hoffen wollten, daß die moderne Physik im Gefolge der Quantentheorie eine »weiche« Technik hervorgebracht hätte. Dort wo sich viele Vorgänge überlagern und technisch gebündelt und gesteuert werden, läßt sich daraus klassische Ausbeutungstechnik nach bewährtem Zuschnitt machen. Die Entwicklung der Atomtechnik als Bombentechnik und dann als friedliche Reaktortechnik, ist klassische Technik auf der theoretischen Grundlage einer ganz anders gearteten komplementären Physik. Das ist der Widerspruch des Atomzeitalters.
Kann man die Entwicklung der Quantenphysik als das Ergebnis einer internationalen wissenschaftlichen Leistung feiern, so führte die Atombombentechnik unter dem Druck des 2. Weltkriegs zu einer Spaltung der Wissenschaftlergemeinschaft, bei der die einen dort und die anderen dort am Bau der Bombe mitzuwirken hatten. Das erforderte, wie die Entwicklung in den USA zeigte, ganz neue Formen der Großtechnik. Aber darüberhinaus veränderte sich auch das politische Denken. Die Zerstörungsmöglichkeiten der Atombombentechnik begründeten die Strategie der Abschreckung. Die Physiker, die anfangs erkenntnis- und ideenleitend gewesen waren, gerieten hoffnungslos mit ihrem Können in politische Abhängigkeiten, aus denen sie sich bis heute nicht befreien konnten. Im Gegenteil, die Rüstungsforschung ist seit dem Bau der Atombombe einer ständigen Ausweitung unterworfen und dringt so in immer weitere Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche ein. In der Tat: von Galilei zur Atombombe führt ein schnurgerader Weg.
Der Eigenwert der Natur
Aber unter dem Druck dieser Fehlentwicklung, in der gewissermaßen noch einmal im Konzentrat die gesamte Entwicklung des neuzeitlichen Verhältnisses des Menschen zur Natur zum Ausdruck kommt, im Schatten der atomaren Zerstörungsmöglichkeiten, also hat sich nun in Theorie und Praxis ein neues Naturverständnis einzuspielen begonnen. Natur ist ein offenes Prozeßgeschehen, ist geschichtlich durch Einmaligkeit und Offenheit gekennzeichnet, unwiederbringbar in ihren jeweiligen Gestalten, unwiederbringbar auch in ihrer Jetztgestalt, wie wir sie heute zur Kenntnis zu nehmen haben. Dieses neue offene Naturverständnis hat interessanterweise eine breite ethische Diskussion über den Eigenwert der Natur provoziert. Diese ethische Diskussion hängt unmittelbar mit diesem neuen Naturverständnis seit dem erkenntnistheoretischen Umbruch in der Quantenphysik zusammen. Auch hier nur eine kurze Kennzeichnung. Da gibt es das Manifest österreichischer Wissenschaftler für den Umweltschutz. In dem heißt es: „Jede Form von Leben ist einzigartig und muß unabhängig von ihrem augenblicklichen Nutzwert für den Menschen geachtet und im Sinne einer elementaren Kulturleistung vor gedankenloser Ausrottung bewahrt werden.“ Hier wird in einer sehr deutlichen Sprache vom Eigenwert jeder einzelnen Naturform gesprochen, eben weil sich in ihr der Gang des bisherigen Prozesses spiegelt, weil sich in ihr jene Einmaligkeit zeigt, die für das menschliche Bewußstsein wahrnehmbar ist.
Ich habe hier eine einzige Stimme zitiert. Man könnte das Manifest der österreichischen Wissenschafatler in eine breite Palette von Überlegungen und Positionen eingliedern, über Hans Jonas bis hin zu Meyer-Abich, in denen unter sehr verschiedenen Ansätzen der Versuch gemacht wird, den Eigenwert der Natur, wie er unter den Krisen der Neuzeit für uns sichtbar gemacht worden ist, zu begründen. Insgesamt geht es also um eine neue Sensibilität gegenüber der Natur als Mitwelt im Sinne der Beachtung ihres selbständigen Wertes und Werdens. Nicht im Sinne romantischer Rückkehr in eine vortechnische und vorwissenschaftliche Zeit, sehr wohl aber geht es um die Entdeckung und Praktizierung gemeinsamer Überlebensinteressen, die Mensch und Natur zusammenschließen. Es geht um einen neuen, bewußten Stoffwechsel zwischen der menschlichen Gesellschaft und der Natur, der ökologisch und sozial nach beiden Seiten und auf beiden Wirkungsebenen zu verantworten ist. Das ist keine Kleinigkeit, wie wir aus der Konkurrenz sozialer, ökologischer, internationaler und auf die Zukunft der Generationen bezogener Bewertungskriterien wissen. Ökologische Sensibilität fügt sich nicht bruchlos mit den bisherigen Voraussetzungen und Zielen des Fortschritts zusammen. Überdies ist die Eigendynamik des wissenschaftlich-technisch-industriellen Komplexes auf dem Weg zu High-tech so stark und so geschlossen und so konzentriert und so unkontrolliert, daß sich die genannten Bewertungskriterien wie Gefühlsmusik im Windkanal des voranhastenden Fortschritts ausnehmen. Dennoch gilt es, die Kriterien ökologischer Orientierung, wie sie auf der Grundlage jener ökologischen Sensibilisierung in Richtung Eigenwert der Natur heute bewußt zu werden beginnen, in Form eines kurzen Katalogs zusammenzufassen:
Erstens:
Bei der Organisation von Technik ist die Selbstorganisation von Natur, auch der vom Menschen überformten Natur, möglichst weitgehend zu beachten und in das technische und wirtschaftliche Kalkül miteinzubeziehen.
Zweitens:
Beim Eingriff in die irdische Evolution ist auf die Kontinuität des bisherigen Prozesses, aus dem ja auch die menschliche Gesellschaft hervorgegangen ist, und auf die Vielfalt seiner Garanten zu achten. Wir leben in einer Zeit des sprunghaft wachsenden Artentodes und der daraus erfolgten Destabilisierung irdischer Öko-Systeme.
Drittens:
Beim Einlassen auf den Prozeß der Evolution darf die vorübergehende Einmaligkeit dieser Phase der Evolution, in der wir jetzt leben, nicht übersehen werden. Jede Phase ist unabdingbar notwendig. Ohne den Fortgang des nächsten Schrittes keine weitere Entfaltung des Lebens und sozialer Bedürfnisse des Menschen.
Viertens:
In der absichtsvollen Gestaltung der menschlichen Zivilisation ist der Zweck der Natur fortzusetzen und unter der Perspektive gesellschaftlicher Bedürfnisse zu steigern.
Es geht also insgesamt um eine sensible, tastende, Alternativen erwägende Steuerungskunst, die von ganz anderer Art ist als die flinken, vorschnell fixierten Fortschrittskonzepte von gestern. Gefordert ist eine Steuerungskunst, die bei allem, was sie tut, bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch bei den technologischen Anwendungen, nach den Folgen fragt. Natur hat auch dort, wo wir sie überformen, in der Energietechnik, in der Chemietechnik, in der Landwirtschaftstechnik und wo auch immer, eine zu beachtende Eigenpotenz, die in das Kalkül unseres technischen Gestaltens als partnerschaftliches Element aufgenommen werden muß.
Das Glaubensbekenntnis der gegenwärtigen Technologie und Innovationspolitik hat demgegenüber eine ganz andere Ausrichtung. Bundesforschungsminister und BDI tönen miteinander:„Ideenreichtum, Mut zum Wagnis und zu neuen Wegen müssen unsere Antwort auf die technisch-ökonomische Dynamik der 80er Jahre werden, die uns zugleich fordert und Chancen bietet. Hier gilt es, die Positionen der deutschen Wirtschaft zu halten und auszubauen, weil von diesen Schlüsseltechnologien über das bereits heute realisierte Maß hinaus nachhaltige Wirkungen ausgehen werden, wenn sie in eine breite und differenzierte Produktpalette diffundieren.“3
Hier ist nicht von den Entwicklungsländern die Rede, auch nicht von der örtlichen Natur als entscheidende Ausgangsvoraussetzung menschlicher Produktion. Hier wird in einer klassischen Weise, bezogen auf die internationale Konkurrenz und bezogen auf die neuesten technischen Instrumente der Konkurrenzwirtschaft, der Wachstumswirtschaft das Wort geredet. Es gilt immer noch der Glaube, ich möchte sagen unser abendländischer, europäischer Glaube an die Allmacht wissenschaftlich-technischer Rationalität und der in ihr liegenden Gestaltungsmöglichkeiten, der diesen Erklärungen mitten in der ökologischen Krise die Feder geführt hat. Ich denke, es ist pure Gesundbeterei, wenn Lothar Späth mit Hilfe von High-Tech auf die geradezu selbstgläubige Renaturalisierung der technischen Zivilisation hofft. Auch wenn der informationstechnisch gesteuerte Produktionsansatz generell umweltfreundlicher ist als die alte Kohle- und Stahltechnik, so ist bei den zu erwartenden Zuwächsen mit einer steigenden Ausbeutung natürlicher und energetischer Ressourcen zu rechnen. Wenn der gesamte Bewertungsrahmen so bleibt, wie er ist, wenn der Aspekt der Natur als Gegenüber des Menschen so ausgeblendet bleibt, wie das in dieser Erklärung der Fall ist, besteht keine Hoffnung auf Frieden mit der Natur.
Es hat keinen Sinn, daß wir unseren ethischen Impuls hinsichtlich seiner Wirksamkeit überschätzen, wir nehmen an dieser Geamtentwicklung teil. Und das, was an zusätzlichen Gesichtspunkten aus der Umweltdiskussion kommt, greift bislang nicht wirksam genug. Es sei denn, wir verließen den Pfad der exzessiven Ausbeutung der Natur und würden uns der Nutzung material- und energiesparender Technologien und ökologisch orientierter Produktionsformen und einer Recycling-Wirtschaft zuwenden. Es geht also um Zielorientierung von Wissenschaft und Technik im kritischen Gegenüber zum industriell-militärischen Komplex. Es geht um Korrektur und Neuorientierung in einem Prozeß internationaler Konkurrenz, in dem Atomtechnologie, Raumfahrttechnik, Gentechnik, Informationstechnologien und Waffentechnologien dominieren.
Neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Austragungsmuster
Das Generalziel ist schnell formuliert. es hätte zu heißen:
Im Gegenüber zu all diesen Zwängen, Sicherung des Überlebens der Menschheit, ausgewogenes Zusammenleben der Menschen mit der irdischen Natur, soziales Zusammenleben, innergesellschaftlich und international, aber entschieden eingebunden in die Gesamtverhältnisse der irdischen Schöpfung.
Es ginge insgesamt um ein neues Bewahrungswissen, um ein gleichgewichtsorientiertes Denken, das die irdische Biosphäre in ihrer unverwechselbaren Jetzt-Gestalt ernst nimmt und achtet. Diese Situation macht neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Austragungsmuster notwendig. Der Präsident der Universität Tübingen konnte angesichts dieser Situation vor kurzem formulieren: „Wir haben wohl zu spät erkannt, daß das Überleben unserer Zivilisation nicht in erster Linie von Militärbündnissen, sondern vor allem von der intellektuell vorzubereitenden wachsenden Zusammenarbeit zwischen den Staaten, Regionen und Kulturen abhängen wird, und daß die zu ihrer Bewältigung notwendigen technischen Systeme einer breiten Konsensbildung bedürfen. Der Naturwissenschaftler kann, wenn er sich zu gesellschaftlichen Problemen äußert, seine apriorischen Annahmen mit Experimenten und Erfahrungen nicht mehr allein absichern, er weiß sich abhängig von wissenschaftstheoretischen und weltanschaulichen Vorgaben ebenso wie von seiner sozialen, ökonomischen und ökologischen Umwelt. Die Naturwissenschaften haben ihren autonomen Platz im gesellschaftlichen Umfeld verloren, und sehen sich fast unvorbereitet dem Anspruch ausgesetzt, daß Erkenntnisse ebenso wie deren technische Verwertung in der Gesellschaft verantwortet werden sollen“4
Das, was hier zunächst als eine Schwächung und Destabilisierung der Position des Naturwissenschaftlers und der Naturwissenschaften gilt, ist gleichzeitig die Voraussetzung für ein neues Verhältnis zwischen technischer Zivilisation und irdischer Lebenswelt. Die neue Kommunikationsdichte kann immer nur ein Mehr an demokratischer Politik bedeuten: ein Mehr an Kommunikation, ein Mehr an Abwägungen, ein Mehr an Abschätzungen von Alternativen. Eine solche Fortschrittsverantwortung im Sinne ökologisch orientierter Politik setzt Vielstimmigkeit und praktizierte Partizipationen voraus. In ihr müssen die, die anwaltschaftlich für den Schutz der Natur votieren und die, die sich für die Menschlichkeit der Produktionsprozesse einsetzen, also diejenigen, die ökologische und soziale Schutzinteressen geltend machen, in enger Auseinandersetzung mit Naturwissenschaft und Technik stehen. Die Naturwissenschaften dürfen nicht an die Industrie ausverkauft werden. Und die Geisteswissenschaften dürfen nicht zu Akzeptanzwissenschaften verkommen. Interessenpolitik in der Demokratie kann und darf nicht nur wie in der Vergangenheit nach altem lobbypolitischem Zuschnitt gemacht werden, es sei denn jene aufkeimende Ehrfurcht vor der Natur in Verbindung mit der sozialen Verpflichtung und dem technologischen Entwurf wäre eine Täuschung. Wirtschaftsverbände und politische Administration tun sich nachweislich bis heute schwer, sich hier auf einen angemessenen Politikstil im Umgang mit der Ökologiebewegung, mit denjenigen, die ökologische Schutzinteressen vertreten, einzulassen. Dabei ist es doch am Tage, daß die so lebenswichtigen Alternativen, auf denen eine präventive Umwelt- und Fortschrittspolitik basieren könnte, ursprünglich nicht von den Parlamenten und nicht von den Hochschulen und nicht von den Industrien kamen. Gesucht und gefordert ist ein neuer Politikstil, wie es Reinhardt Ueberhorst immer wieder unterstreicht, ein Stil, der das Denken in Alternativen, das Abwägen so oder so gearteter Lösungen öffentlich betreibt.
Wir benötigen zur Gewährleistung dieser neuen ökologischen Orientierung bei der weiteren Gestaltung des Fortschritts einen offenen, diskursiven Politikstil, neue ergänzende Politikmuster. Ich nenne hier nur beispielhaft einige wenige Punkte. Natürlich benötigen wir die Einrichtung einer dem Parlament zugeordneten Technologie-Bewertungsstelle, vergleichbar dem Office of Technology Assessment (OTA) beim US-amerikanischen Kongress. Die Tatsache, daß das Parlament in den zurückliegenden Jahrzehnten immer erst im Nachhinein argumentieren konnte, zeigt ja überdeutlich, was hier fehlt. Und es ist eine beschämende Erfahrung, daß dieser Vorschlag für eine solche Technologie-Bewertungsstelle im Umfeld des Parlamentes, der von einer Bundestag-Enquete-Kommission in der vorigen Legislaturperiode erhoben wurde, bis heute verzögert und aus lobbypolitischen Gründen abgedrängt wurde.
Ich gehe noch weiter und sage: dieses herkömmliche Instrumentarium der Enquete-Kommissionen und einer solchen Technologie-Bewertungsstelle für das Parlament reicht nicht aus. Darüber hinaus ist zur Steuerung und Kontrolle der Eigenläufigkeit des technisch-industriellen Fortschritts sicher auch die Berufung von sogenannten Volksenquete-Kommissionen empfehlenswert, in denen alternative Forschungsansätze und ökologische und soziale Interessen für das Parlament in einer verpflichtenden Weise vertreten sein müßten.
Man könnte diese Liste der Forderungen noch weiter fortsetzen. Ich hebe hier nur noch einen Punkt hervor: die Erklärung und die Praktizierung von Moratorien, die Verhängung von Forschungsförderungs- und Produktionsstops im Falle kritischer, nicht hinreichend aufgeklärter Risikolagen. Wir benötigen, um Hans Jonas zu zitieren, „Gnadenfristen im Vormarsch des Fortschritts“. Kritische Wissenschaft, die ihre eigenen Methoden und die Folgen von Erkenntnis und Anwendung hinterfragt, Bürgerbewegungen und Sozialpartner müssen im Zuge eines großen gesellschaftlichen Umdenkungsprozesses lernen, miteinander im Blick auf die Folgen und im Blick auf die bestehenden Alternativen den Weg der Sorgfalt, der Prüfung und der Rücksichtnahme bei der ökologischen Gestaltung der Biosphäre zu finden. Wir stehen an einer Wendemarke, an der sich der Mensch der Herrschaft über seine technischen Mittel neu und in einem radikalen Sinne vergewissern muß. Wir bedürfen einer sorgfältigen Abstimmung unserer Interessen und neuer Formen des Naturumgangs. Das setzt ohne Zweifel auch neue rechtliche Regelungen für eine öffentliche Wissenschaftskontrolle voraus. Es ist der einzige Weg, den wir noch gehen können, wenn Überleben Ausdruck von Denken ist und Denken das Überleben der Menschheit und der irdischen Natur garantieren soll.
Anmerkungen
* Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete Fassung des Vortrages von G. Altner auf dem Naturwissenschaftler-Kongreß in Tübingen (Dez. 1988). Zurück
1 Giegerich, Wolfgang: Die Atombombe als seelische Wirklichkeit. Ein Versuch über den Geist des christlichen Abendlandes. Schweizer Spiegel Verlag AG, Raben-Reihe, 1988 Zurück
2 Giegerich, Wolfgang: a.a.O., S. 300-301 Zurück
3 Zit. nach Altner, Günter: Unsere gemeinsamen Aufgaben – Über die Notwendigkeit des Zusammengehens von Ökologiebewegung und Gewerkschaften. In: Kieffer,K.W. u.a. (Hrsg.): Ökologisch denken und handeln: Strategien Mittlerer Technologie. Alternative Konzepte Nr. 67, Karlsruhe 1988, S. 67/68 Zurück
4 Theis, Adolf: Wie Katz und Maus? Zum Spannungsverhältnis zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. In: Futura 1/ 1988, S.20 Zurück
Prof. Dr. Dr. Günter Altner, Theologie / Biologie (Heidelberg)