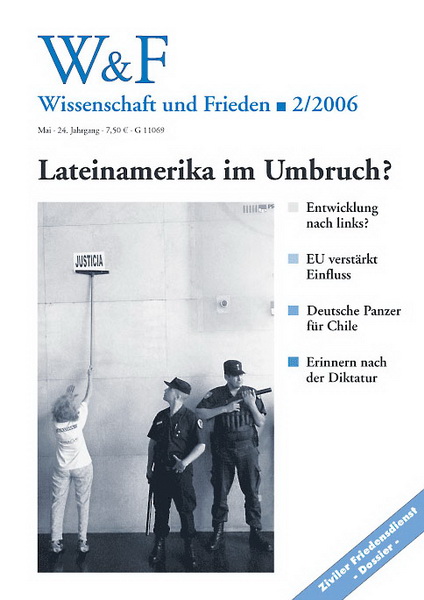Paramilitärs und Paramilitarismus
von Sabine Kurtenbach
Wenn von Paramilitärs in Lateinamerika die Rede ist, so werden vor allem historische Erinnerungen wach. Erinnerungen an die 70er und den Anfang der 80er Jahre in denen Todesschwadrone im Auftrag der Herrschenden in zahlreichen Ländern folterten und mordeten, oft im engsten Kontakt zu den regulären militärischen Einheiten. Im Verlauf dieser Kriege erreichten viele dieser Gruppen eine relative Autonomie, die in den letzten Jahren vielfach noch ausgebaut werden konnte. Die Autorin zeichnet den Weg der Paramilitärs anhand der Entwicklung in Guatemala und Kolumbien nach und zeigt auf, warum die Zurückdrängung der paramilitärischen Strukturen eine unerlässliche Voraussetzung für eine Demokratisierung ist.
Der Begriff Paramilitärs wird in erster Linie mit den Todesschwadronen der 70er Jahre in Verbindung gebracht, die auf dem Subkontinent in zahlreichen Ländern die Herrschaft der diktatorischen Militärregime gewaltsam abgesichert haben. Da sich selbst diese Regime einen legalen Anstrich gaben, haben sie die Repression gegen politische Gegner, deren »Verschwindenlassen«, deren Folter und deren Mord, vielfach paramilitärischen Gruppierungen überlassen. Die Mitglieder dieser Gruppen waren in der Regel Angehörige des Militärs.
In den Kriegsländern Zentralamerikas bestanden die paramilitärischen Akteure dagegen aus von den Sicherheitskräften bewaffneten »Zivilisten« und dienten in erster Linie der Aufstandsbekämpfung und der damit verbundenen Kontrolle der Bevölkerung. Am ausgeprägtesten war dieses System in Guatemala, wo etwa eine Million Menschen zur Mitarbeit in sog. Zivilpatrouillen gezwungen wurde. In El Salvador hatten die zivilen Verteidigungskomitees etwa 60-80.000 Mitglieder, in Nicaragua waren in den 80er Jahren etwa 500.000 Menschen Mitglieder ziviler Milizen.1 Auch in Kolumbien entstand ein Teil der sog. Selbstverteidigungsgruppen durch staatliche und private Initiativen der Aufstandskontrolle, etwa in den 90er Jahren die sog. »Convivir« (Zusammenleben). In Peru wurden die »rondas campesinas« von der Regierung Fujimori als zentrales Element des Kampfes gegen Sendero Luminoso eingesetzt.
Im Verlauf dieser Kriege erreichten die verschiedenen paramilitärischen Gruppen aber überall ein erhebliches Maß an Autonomie, weil sie hauptsächlich im ländlichen Raum agierten, wo es nur eine prekäre staatliche Präsenz gab. Außerdem profitierten sie – ebenso wie die staatlichen Sicherheitskräfte – von den existierenden kriegsökonomischen Strukturen; sei es direkt oder indirekt von der US-Militärhilfe, sei es durch die Kontrolle von illegalen Aktivitäten im Grenzbereich (Schmuggel, Drogenhandel, etc.). In den lateinamerikanischen Friedensprozessen Ende des 20. Jahrhunderts wurden diese Gruppen und deren Demobilisierung nirgends explizit thematisiert. Ein Zeichen dafür, dass sie allgemein – in Zentralamerika mehr als in Kolumbien oder Peru – als mehr oder minder direkt abhängig von den staatlichen Sicherheitskräften betrachtet wurden.
Wandel und Kontinuität von Gewalt und paramilitärischen Akteuren
Spricht man am Anfang des 21. Jahrhunderts dagegen von Paramilitarismus und Paramilitärs in Lateinamerika, so hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Zwar gibt es in dem einen oder anderen Fall sehr deutliche historische Kontinuitäten zu den Phänomenen der 70er Jahre, allerdings verfügen diese Gruppen über ein hohes Maß an Autonomie, eine Verbindung zu staatlichen Sicherheitskräften besteht »nur« noch im Kontext personeller oder auch krimineller Netzwerke oder durch die Toleranz und engagiertes »Wegsehen« seitens des Militärs. Letztlich spiegelt diese Veränderung den Wandel des Gewaltgeschehens in der Region wider.
Während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten die US-Dominanz und vor allem der Kalte Krieg das Gewaltgeschehen in Lateinamerika. Die Gewalt war überwiegend politisch begründet, sei es zur Erhaltung des Status quo, sei es zu deren Veränderung. Während das Ende der Ost-West-Konfrontation – mit Ausnahme Kubas – vor allem auf die Dynamik der innergesellschaftlichen Konflikte in Lateinamerika einwirkte, veränderten zwei andere Entwicklungen maßgeblich deren Struktur:
- Trotz aller Defizite und der weitgehenden Reduzierung auf die Abhaltung regelmäßiger und sauberer Wahlen entzog die Demokratisierung der Gewalt die politische Legitimierung und damit auch den ideologischen Bezugsrahmen.
- Die neoliberale Strukturanpassung erhöhte die soziale Fragmentierung und untergrub die Organisationsfähigkeit der kollektiven Akteure in der gesamten Region. Dies wird nicht nur in der hohen Volatilität politischer Parteien, sondern auch in der Schwäche von Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft deutlich.
In bezug auf die Gewalt und die Gewaltakteure drücken sich diese Veränderungen in einer Privatisierung und Diffusion, d.h. in einer Vereinzelung und Verallgemeinerung der Gewalt aus (vgl. Lock 1999). Lateinamerika ist auch heute noch – allerdings mit bedeutenden innerregionalen Unterschieden – weltweit der gewalttätigste Kontinent (WHO 2002). Die Länder südlich des Rio Grande weisen die höchsten Homizidraten (Zahl der Morde pro 100.000 Einwohner) auf. Aber auch der Raum, in dem die Gewalt stattfindet, hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Fanden die Guerillakriege noch überwiegend auf dem Land statt, so ist die Gewalt heute vor allem in den lateinamerikanischen Städten »zu Hause«. Ein Großteil der Gewalt geschieht im Umfeld der organisierten und nicht-organisierten Kriminalität, wobei die Grenzen fließend sind. Kriminalität – d.h. die vorsätzliche Überschreitung von strafrechtlichen Regeln einer Gesellschaft – ist in Lateinamerika nicht weiter verbreitet als in anderen Weltregionen, sie ist dort aber in höherem Maß gewalttätig und mit dem Einsatz von Schusswaffen verbunden (vgl. Fajnzylber u.a. 1998).
Die organisierte Kriminalität nahm ihren Ausgang und verdankt ihren Aufschwung dem Drogenhandel, in deren Umfeld zunächst in Kolumbien, später aber auch in Mexiko und Brasilien mafiöse Organisationen mit globaler Reichweite entstanden sind (vgl. Serrano/Toro 2002). Waffenhandel und Geldwäsche sind wesentliche Bestandteile dieses Geschäfts, ebenso wie Entführungen, Menschenhandel und Schmuggel (z.B. Autos). Aber auch die nicht-organisierte Kriminalität weist einen gewissen Grad an Organisation auf bzw. ist in weiten Teilen direkt und indirekt an die organisierte Kriminalität angebunden. Zentraler Akteur sind in vielen Ländern die zahlreichen »Jugendbanden«, deren Zielsetzung sich in erster Linie auf das eigene Überleben und im Rahmen der Gruppe meist auf die soziale, ökonomische und politische Kontrolle des eigenen Stadtviertels bezieht. Ähnliche Phänomene gab und gibt es auch in anderen Ländern und Weltregionen – in Afrika sind diese Gruppen vielfach die zentralen Akteure der »neuen« Kriege und der Warlord-Strukturen (vgl. Nissen/Radtke 2002, Riekenberg 1999).
Die Ausübung oder Androhung von Gewalt ist im Kontext der organisierten Kriminalität ein zentraler Mechanismus zur Absicherung der »Geschäfte«, die aufgrund ihres kriminellen Charakters keine vertragliche Regelung aufweisen. Außerdem spielt die Gewalt bei den Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen eine große Rolle, wenn es um die Sicherung oder Ausdehnung des eigenen »Geschäftsbereichs« geht. Hat sich eine Gruppe dann durchgesetzt – und insofern ein Monopol errichtet – geht die Gewalt zumindest vorübergehend zurück, weil diese Gruppen in ihrem Territorium durchaus Funktionen der öffentlichen Sicherheit erfüllen. Allerdings ist diese weder auf rechtsstaatliche noch demokratische Mechanismen, sondern auf Gewalt gestützt. Schon aus diesem Grund ist die so entstandene Sicherheit meist prekär und kommt nur der jeweiligen Klientel zugute.2
Guatemala – Paramilitärs im Frieden
Guatemala ist ein Beispiel dafür, wie eine im Krieg etablierte Gewaltordnung den Übergang vom autoritären zum formal demokratischen Regierungssystem sowie die Beendigung des Krieges überlebt und sich den neuen Gegebenheiten anpasst. Zentrale Bestandteile dieser Ordnung sind klientelistische und kriminelle Netzwerke aus Teilen des Militärs, der ehemaligen Regierungspartei Frente Republicano Guatemalteco (FRG) und der paramilitärischen Gruppen, die im Krieg gegründet wurden (vgl. hierzu Peacock/Beltrán 2003). Diese Gruppen schüren vor allem, aber nicht nur, auf der lokalen Ebene und auf dem Land Unsicherheit und Angst, was auch auf der nationalen Ebene Wirkung zeigt. Zum einen tragen die Gewalt und/oder deren Androhung dazu bei, die substantielle Umsetzung der Friedensverträge von 1996 und damit die Reform von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu verhindern. Zum anderen untergräbt dies die ohnehin fragile legitimatorische Basis des demokratischen politischen Systems.
Schon deshalb war und ist es extrem schwierig, die paramilitärischen Strukturen des Krieges zu demobilisieren. So blieb die Bewaffnung der Zivilpatrouillen kurz nach Kriegsende unter anderem mit dem Argument aus, die Mitglieder der PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) hätten sich die Waffen selbst gekauft, weshalb der Staat sie ihnen jetzt nicht wegnehmen könne. Eine sehr spezielle Sicht auf Privateigentum und staatliches Gewaltmonopol. Die PAC haben sich in einigen Regionen des Landes reorganisiert, heute sollen sie über ca. 500.000 Mitglieder verfügen. Seit 2003 haben sie mehrfach zentrale Kreuzungen und Straßen des Landes besetzt sowie ihren Protest in die Hauptstadt getragen, um eine »Entschädigung« für ihre Beteiligung am Krieg einzufordern. Die Regierung hat dies daraufhin zugesagt. Politik in Guatemala ist auch zu Friedenszeiten noch überwiegend gewaltgestützt.
Kolumbien – Frieden mit den Paramilitärs?
Historisch zeigen sich in Kolumbien ähnliche Entwicklungen wie in Guatemala, weil sich dort bewaffnete Gruppen, die zunächst in den 50er Jahren im Kontext des Kriegs zwischen Liberaler und Konservativer Partei entstanden, in weitgehend kriminelle Organisationen und Banden transformierten (vgl. Sánchez/ Meertens 1983). Aktuell findet allerdings der umgekehrte Prozess statt, in dessen Rahmen sich kriminelle Organisationen politisieren, um in Verhandlungen mit der Regierung eintreten zu können.
Bis Mitte der 90er Jahren entstanden in Kolumbien circa 250 paramilitärische Gruppierungen mit unterschiedlicher regionaler Präsenz und verschiedenem Organisationsgrad.3 In den Städten Kolumbiens bildeten die Jugendbanden die Basis der paramilitärischen Gruppen. Weltweit bekannt geworden sind die Gruppen der sog. »sicarios«, die gedungenen Mörder, die vom Erlös ihres »Geschäfts« der Mutter einen Kühlschrank kauften.4 Die Drogenbosse rekrutierten und funktionalisierten diese Gruppen für ihre Zwecke, aus zunächst losen und punktuellen Formen der Kooperation entstanden schlagkräftige Verbände, die sich im Verlauf der 90er Jahre nicht nur verselbständigten, sondern auch politisierten. Vor diesem Hintergrund wuchs in den vergangenen Jahren in der kolumbianischen Gesellschaft das Bewusstsein dafür, dass die Paramilitärs unter Umständen gefährlicher sind als die Guerillagruppen. Und dies obwohl zahlreiche so genannte »Selbstverteidigungsgruppen« als Reaktion regionaler Eliten auf die wachsenden Aktivitäten der Guerilla sowie die Demokratisierung und Dezentralisierung des Landes entstanden, die seit Mitte der 80er Jahre die politischen Spielregeln grundlegend verändert haben. Ganz im Sinne traditioneller Politikmuster gründeten die traditionellen Eliten Privatarmeen gegen die stärker werdende Organisation oppositioneller Gruppen.
Im Januar 1995 schloss sich ein Großteil der paramilitärischen Gruppen unter dem Namen Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) zusammen. Die zentrale Ideologie der paramilitärischen Gruppen ist die der »Selbstverteidigung « gegen die Guerilla, und die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo, weshalb sie sich als Staatsersatz sehen. Mit der Wahl von Álvaro Uribe zum Präsidenten im Jahr 2002 wurden sie erstmals von einer Regierung als Gesprächspartner anerkannt. Im Juli 2003 unterzeichneten die Regierung und ein Großteil der Paramilitärs eine gemeinsame Erklärung, in der vereinbart wurde, die überwiegende Mehrheit der paramilitärischen Gruppen bis Ende 2005 zu demobilisieren und zu reintegrieren. Dieser Prozess ist von zahlreichen Rückschlägen und Problemen begleitet. Neben der Frage der Strafverfolgung für begangene Menschenrechtsverletzungen, der fehlenden Transformation der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Demobilisierung bleibt die Forderung der USA nach Auslieferung zahlreicher Bosse bestehen.
Zurückdrängung paramilitärischer Strukturen
Die hier nur skizzierten Erfahrungen in Guatemala und Kolumbien zeigen einige Grundsatzprobleme im Zusammenhang mit paramilitärischen Akteuren und Strukturen in Lateinamerika auf. Der Einfluss dieser Gewaltakteure reicht aus, um – mit oder ohne eigenes politisches Projekt – grundlegende Reformen zugunsten einer Vertiefung der Demokratie und einer Stärkung des Rechtsstaats zu verhindern. Dies macht sie zu mächtigen Blockadekräften. Die Aufrechterhaltung des Status quo ist für die Gewaltakteure von hoher Bedeutung, weil sie nur so ihren illegalen Geschäften weitgehend ungestört nachgehen können bzw. diese – wie derzeit in Kolumbien – legalisieren können. Dadurch werden nach aller Erfahrung aber insbesondere dier Handlungsoptionen all der Akteure eingeschränkt, die für gesellschaftlichen Wandel eintreten.
Die Paramilitärs agieren letztlich in einer Grauzone zwischen Krieg und Frieden, wie sie gerade auch für die »neuen« Kriege charakteristisch ist. Zieht man die Grenze zwischen Krieg und Frieden dort, wo die politische Gewalt aufhört, so verschwindet diese Grauzone aus dem Blick, ihr politischer Gehalt wird nicht wahrgenommen. Gerade für die künftige Entwicklung stellt sich aber durchaus die Frage, unter welchen Bedingungen diese »unpolitischen« Gewaltakteure sich stärker politisieren könnten. Schließlich ist nicht gesagt, dass das »Ende der Ideologien«, das mit dem Ende des Ost-West-Konflikts konstatiert wurde, ein Dauerzustand ist. Die lateinamerikanischen Länder sind demographisch sehr jung – ca. 40% der Bevölkerung sind unter 15 Jahren alt. Dies führt dazu, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich nicht selbst an die Zeiten der Militärdiktaturen und/oder – außerhalb Kolumbiens – an die Kriegszeiten erinnert. Beides gilt als stabilisierendes Element für die Demokratien und in beiden Kontexten spielt vor allem unter präventiven Gesichtspunkten die Frage des gesellschaftlichen Umgangs mit der Gewalt der Vergangenheit eine wichtige Rolle. Nur wenn es gelingt auf rechtsstaatlichem Weg die paramilitärischen Gewaltakteure in die Schranken zu verweisen, lassen sich die demokratischen Strukturen stärken, die zu deren politischer Marginalisierung notwendig sind.
Literatur:
Duncan, Gustavo (2005): Del Campo a la Ciudad en Colombia. La Infiltración Urbana de los Señores de la Guerra. Documento CEDE No.2 enero, versión electrónica. Bogotá (http://economia.uniandes.edu.co/~economia/archivos/temporal/d2005-02.pdf, Zugriff am 25.4.05).
Fajnzylber, Pablo/ Daniel Lederman, Norman Loayza (1998): Determinants of Crime Rates in Latin America and the World. An Empirical Assesment. Worldbank Latin American and Caribbean Studies Viewpoint, Washington D.C.
González, Fernán E., Ingrid J. Bolívar, Teófilo Vázquez (2003): Violencia Política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. CINEP, Bogotá.
Kurtenbach, Sabine (2005): Gewalt, Kriminalität und Krieg – zur symbiotischen Verbindung verschiedener Gewaltformen und den Problemen ihrer Einhegung, in: Basedau, Matthias/ Hanspeter Mattes, Anika Oettler (Hg.): Sicherheit als öffentliches Gut, Hamburg DÜI, S.209-228.
Lock, Peter (1998): Privatisierung von Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung, in: Lateinamerika. Analysen-Daten-Dokumentation. Jg. 15, Nr. 38. Hamburg Institut für Iberoamerika-Kunde.
Manwaring, Max G. (2005): Street Gangs: The New Urban Insurgency. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle (www.carlisle.army.mil/ssi) Zugriff am 13.4.05).
Nissen, Astrid/ Katrin Radtke (2002): Warlords als neue Akteure der internationalen Beziehungen, in: U. Albrecht et al. (Hg): Das Kosovo-Dilemma: Schwache Staaten und Neue Kriege als Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Münster, Westfälisches Dampfboot, S.141-155.
Peacock, Susan C./Beltrán, Adriana (2003): Hidden Powers. Illegal Armed Groups in Post Conflict Guatemala and the Forces Behind them. A WOLA Special Report. Washington D.C.
Riekenberg, Michael (1999): Warlords. Eine Problemskizze in: Comparativ. Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung 9. Jg. Nr. 5/6, S. 187-2005.
Romero, Mauricio (2003): Paramilitares y autodefensas 1982-2003. Bogotá.
Serrano, Mónica/ María Celia Toro (2002): From Drug Trafficking to Transnational Organized Crime in Latin America, in: Mats Berdal/ Mónica Serrano (Hg.) 2002: Transnational Organized Crime and International Security. Business as Usual?, Boulder, London Lynne Rienner, S. 155-182.
WHO (2002): World Report on Violence and Health 2002. Genf.
Anmerkungen
1) Alle Angaben beruhen auf den eher konservativen Angaben des Londoner Internationalen Instituts für Strategische Studien (vgl. IISS- Military Balance 1982/83ff).
2) Eine eindrucksvolle Studie zu den wechselnden Mechanismen, die von der organisierten Kriminalität zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung ihres Einflusses in Kolumbien benutzt werden ist Duncan 2005.
3) Zu den Paramilitärs vgl. v.a. González et al. 2003, Romero 2003 und Duncan 2005.
4) Zum Psychogramm eines Sicarios vgl. El Tiempo 9.4.1989, deutsche Übersetzung in: Militärpolitik Dokumentation 76/77.
Dr. Sabine Kurtenbach ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Iberoamerika-Kunde in Hamburg, freie entwicklungspolitische Gutachterin und Mitherausgeberin des seit 1999 im Suhrkamp-Verlag erscheinenden Jahrbuch Menschenrechte