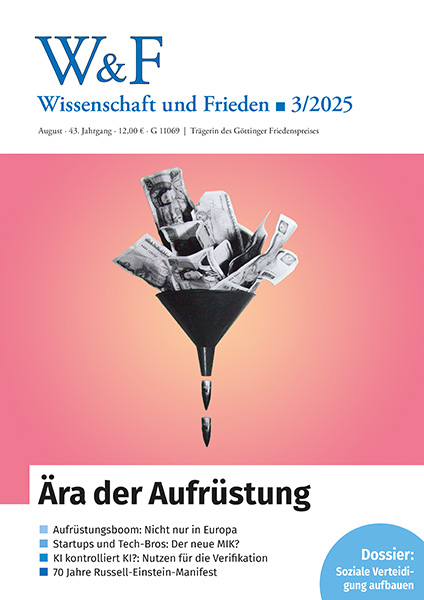Potenziale und Grenzen des Pazifismus
Tagung, Friedrich-Schiller-Universität Jena und Akademie des Bistums Aachen, Aachen, 4.-6. Juni 2025
»Nie wieder Krieg?« Unter dem Motto dieser als Frage reformulierten pazifistischen Forderung beschäftigte sich die von Benedikt Brunner (Jena/Mainz), Sarah Jäger (Jena) und Gabriel Rolfes (Aachen/Chemnitz) organisierte Tagung mit den Potenzialen und Grenzen des Pazifismus in Geschichte und Gegenwart aus einer primär theologisch-friedensethischen Perspektive. Sie verfolgte das doppelte Ziel, das Feld des Pazifismus ökumenisch und interdisziplinär zu erschließen und zugleich die Vernetzung zwischen Wissenschaftler:innen und (kirchlichen) Friedenspraktiker:innen zu stärken.
In ihrem Überblick über die historische Genese und Umstrittenheit des Begriffs des Pazifismus verdeutlichte Sarah Jäger zu Beginn der Tagung die Vielfältigkeit pazifistischer Ansätze. Deren Relevanz zeige sich im heutigen friedensethischen Diskurs besonders im Konzept des »gerechten Friedens« sowie in der Arbeit christlicher Friedensinitiativen, die präventive Gewaltverhinderung vorantreiben und alternative Konfliktlösungsstrategien entwickeln.
Anschließend führte Benedikt Brunner in die Fragestellung der Tagung nach der friedensethischen Relevanz pazifistischer Ansätze ein. Zu beleuchten seien die Aspekte des 1) konzeptuellen Verständnisses des Pazifismus, 2) seine historischen Lehren und 3) die wissenschaftliche Erschließung pazifistischer Praxisformen. Diesen wurde in fünf Panels nachgegangen.
Mit dem ersten Panel wurde ein systematischer Blick auf das Konzept des Pazifismus geworfen. So fasste Marco Hofheinz (Hannover) unter Pazifismus alle Bestrebungen, Politik gewaltfreier zu gestalten. Der in der liberalistischen Tradition verortete Rechtspazifismus, der im Fokus seines Vortrages stand, verfolge den Leitgedanken des »Friedens durch Recht«. Eine Rechtsordnung, die als Friedensordnung zu konzipieren sei, bleibe als normative Zielperspektive trotz aktueller neorealistischer Tendenzen ohne Alternative. Thomas Hoppe (Hamburg) machte anschließend auf die aporetische Grundstruktur des Gewaltproblems aufmerksam: Negative Folgen würden nicht nur bei der Anwendung von Gewalt, sondern auch bei gewaltfreiem Handeln drohen, wenn Menschen nicht geschützt werden können. Der Pazifismus entfalte seine friedensethische Bedeutung somit durch die Ausarbeitung von Friedensstrukturen sowie durch die Verhinderung einer Gewöhnung an Gewalt.
Anliegen des zweiten Panels war es, pazifistische Strömungen historisch zu kontextualisieren. Der Frage, wie Debatten über Pazifismus angesichts der Erfahrung zweier Weltkriege geführt wurden, widmete sich Thomas Kuhn (Greifswald). Während die Mehrheit der Geistlichkeit in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts antipazifistisch eingestellt gewesen sei, hätte es insbesondere in der Schweiz auch eine wirkmächtige Riege antimilitaristischer Pfarrer gegeben. Auch Frauen sei in der Friedensbewegung eine besondere Rolle zugekommen. Mit der historischen Verortung der westdeutschen Spielart dieser Friedensbewegung setzte sich anschließend Gisa Bauer (Köln) auseinander. Die Bewegung hätte über Jahrzehnte das Ansinnen verfolgt, zunächst die Wiederbewaffnung, dann die Atomwaffenstationierung zu verhindern. So hätte sie sich zu einer umfassenden pazifistischen Bewegung entwickelt, die zwar ihre konkreten politischen Ziele (Verhinderung der Wiederbewaffnung, des NATO-Beitritts und des Doppelbeschlusses) verfehlte, aber als Motor der gesellschaftlichen Politisierung und des friedensethischen Diskurses die gesamte Geschichte der Bundesrepublik prägte und Millionen von Menschen mobilisierte. Die Entwicklung der Friedensbewegung in der DDR hätte sich von der westdeutschen grundlegend unterschieden, so Marie-Anne Subklew-Jeutner (Hamburg). Kirchliche Stellungnahmen zur Friedensfrage seien aufgrund des geschlossenen ideologischen Systems stets hochpolitisch gewesen, auch wenn sie dem eigenen Selbstverständnis nach theologisch verfasst worden seien. Zentrale kirchliche Texte seien im Kontext der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht sowie des Schulfachs »Wehrkunde« entstanden. Besondere Symbolkraft auch über kirchliche Kreise hinaus hätte die »Schwerter zu Pflugscharen«-Bewegung gewonnen.
Das dritte Panel war verschiedenen Tiefenbohrungen nach den Quellen des christlichen Pazifismus gewidmet. Eröffnet wurde es von Lukas Johrendt (Hamburg), der Bonhoeffers Weg zum christlichen Pazifismus nachzeichnete. So plädiere Bonhoeffer für einen situationsbezogenen Pazifismus. Während das eigentliche »pacem facere« (»Frieden schaffen«) Gott überlassen sei, sei es an den Menschen, das Wagnis des Friedens einzugehen. Lukas Mengelkamp (Hamburg) widmete sich mit der Frage nach Abschreckung im Ost-West-Konflikt anschließend einer Debatte, die im Hintergrund der Friedensbewegung und der Diskussionen um christlichen Pazifismus stand. In den 1950er Jahren sei die Abschreckungstheorie vor allem in den USA entstanden. Dabei hätte das zentrale Paradox darin bestanden, militärische Mittel politisch nutzbar zu machen, obwohl Krieg als Mittel der Politik angesichts von Nuklearwaffen unmöglich geworden war. Die amerikanischen Ansätze seien in Deutschland stark rezipiert worden.
Eine weitere Tiefenbohrung unternahm Sarah Jäger, indem sie die Entwicklung der Frauenfriedensbewegung nachzeichnete. Die Bewegung habe einen erweiterten Friedensbegriff entwickelt, der den direkten Zusammenhang zwischen Krieg, Gewalt gegen Frauen und Geschlechterunterdrückung betonte. Roger Mielke (Koblenz) beleuchtete anschließend die wechselseitigen, oftmals stereotypen Wahrnehmungen von Pazifismus und Soldatenseelsorge. Die Fragestellungen der einen Seite würden jeweils zur Herausforderung für die andere Seite werden. Beide Positionen würden auf unauflösbare Grundfragen der Friedensethik verweisen, wie diejenige nach der Friedensfähigkeit des Menschen, nach der Bedeutung von Macht und Herrschaft oder nach den Möglichkeiten einer internationalen Friedensordnung. Als linkskatholischer Intellektueller entwickelte der nonkonformistische Publizist Walter Dirks eine Position, die Pazifismus und Sozialismus miteinander verband, so Gabriel Rolfes in seinem Beitrag. Eine zentrale These bei Dirks sei, dass äußerer Friede vom inneren Friede abhängig sei, wobei der Zumutbarkeit der politischen Umstände eine wichtige Rolle bei der Friedensermöglichung zukäme.
Das vierte Panel widmete sich dem Pazifismus in der Gegenwart. Zunächst wurde ein Blick auf außerchristliche, religiöse Pazifismustraditionen geworfen, wobei der jüdische Beitrag trotz der Anstrengungen der Organisator:innen leider nicht besetzt werden konnte. Die muslimischen Friedensdiskurse unter den Bedingungen zunehmender religiöser Radikalisierung und Islamfeindlichkeit in Deutschland wurden von Youssef Dennaoui (Aachen) beleuchtet. Der Bezug zum Frieden sei im Islam fest verankert: Der Begriff »salam« (Frieden) stelle einen der Namen Gottes dar und spiegle sich auch im Begriff »Islam« wider. Die gegenwärtige Situation sei jedoch durch interne Deutungsmachtkämpfe um islamische Konzepte von Krieg und Frieden geprägt. Extrempositionen würden die moderate Mehrheit der Muslime unter Druck setzen, weshalb es angezeigt sei, aktiv gegen Islamfeindlichkeit vorzugehen, um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen.
Anschließend wurden die pazifistischen Gegenwartsdebatten um Versöhnung und Gewaltfreiheit zum Thema. Martin Leiner (Jena) diagnostizierte eine dreifache Krise der Gegenwart. Vor dem Hintergrund des Scheiterns traditioneller Friedensschlüsse (Krise des Friedens), systematisch nicht erreichten Kriegszielen in modernen Konflikten (Krise des Krieges), sowie einer problematischen Fokussierung der Friedensforschung auf Kriegsforschung statt echter Friedenslösungen (Krise der Friedensforschung), könne die Versöhnungsforschung als Alternative fungieren. Sie verstehe Versöhnung als aktiven Prozess, der bereits mitten im Gewaltkonflikt beginne und verschiedene Friedensverständnisse aushandle, um einen »versöhnten Frieden« zu erreichen. Mit der Gewaltfreiheit als Stil einer Politik für den Frieden beschäftigte sich anschießend Stefan Voges (Aachen), indem er die »Catholic Nonviolence Initiative« als einen pazifistischen Aufbruch der jüngeren Zeit vorstellte.
Der zweite Abend war explizit dem Anliegen der Vernetzung mit Friedenspraktiker:innen gewidmet. Vertreter:innen verschiedener kirchlicher Organisationen der Friedens- und Entwicklungsarbeit (Maria Reyes-Henkel und Moritz Weißer, Pax Christi; Dr. Markus Patenge, Iustitia et Pax; Ali Al-Nasani, Eirene; Maria Biedrawa, Church and Peace) sprachen über erfolgreiche lokale Projekte und strukturelle Herausforderungen. So werde die Verbindung zwischen Entwicklungsarbeit und Friedensförderung oft unterschätzt. Die Friedensbewegung stehe jedoch nicht nur aufgrund aktueller geopolitischer Entwicklungen zunehmend unter Druck, sondern auch, weil es immer schwieriger werde, junge Menschen für die Friedensarbeit zu gewinnen.
Der dritte Tag der Tagung widmete sich Konflikten der Gegenwart und dem theoretischen Potenzial des Pazifismus. Juliane Prüfert (Diemelstadt-Wethen) eröffnete das fünfte Panel mit ihrer Vorstellung des Konzepts des gerechten Friedens aus der Perspektive der europäischen Ökumene. Dieses sei in der Ökumene breit rezipiert worden, habe jedoch konfessionell unterschiedliche Ausprägungen erhalten: von mennonitischer Betonung des Gewaltverzichts Jesu über evangelische Verrechtlichung bis hin zur russisch-orthodoxen Erlaubnis der Kriegsteilnahme zur Verteidigung des Nächsten. Der Krieg in der Ukraine stelle verschiedene Denominationen vor neue Herausforderungen, da selbst traditionell pazifistische Kirchen ihre Gewaltlosigkeit durch die Pflicht zum Schutz der Schwächsten in Frage stellen müssten. Christine Schweitzer (Hamburg) widmete sich daran anschließend den Chancen und Grenzen ziviler Konfliktbearbeitung. Gewaltfreie Alternativen seien oft effektiver als militärische Gewalt. Die im Blick auf Krieg und Frieden äußerst ambivalente Rolle des Christentums machte die von Margit Ernst-Habib (Duisburg-Essen) vorgestellte postkoloniale Perspektive besonders deutlich. Sie kritisierte, dass das Konzept des Pazifismus oftmals eurozentrisch geprägt sei und koloniale Denkstrukturen reproduziere, indem epistemische Gewalt ausgeübt werde. Zu hinterfragen sei, wem Pazifismus nütze – so habe er historisch oft den Mächtigen zur Unterdrückung von Befreiungskämpfen gedient, während koloniale Gewaltstrukturen als Pazifizierung verschleiert worden waren. Vor diesem Hintergrund sei die Friedensforschung und die Friedensarbeit zu dekolonialisieren, statt auf Pazifismus könne möglicherweise verstärkt auf Antimilitarismus gesetzt werden. Wie postkoloniale Kontexte traditionelle pazifistische Ansätze herausfordern und neue, an den jeweiligen Kontext angepasste Wege zu Frieden und Gerechtigkeit aufzeigen können, zeigt sich beispielhaft im südafrikanischen Kampf gegen die Apartheid, mit dem sich Benedikt Brunner im letzten Vortrag der Tagung auseinandersetzte. In Südafrika hätten sich Stimmen durchgesetzt, die deutlich machten, dass Versöhnung nur dann möglich ist, wenn Ungerechtigkeit und Unterdrückung beseitigt werden, wobei Gewalt nicht völlig ausgeschlossen wurde.
Im Rückblick kann festgehalten werden, dass die Tagung das Ziel einer ökumenischen und interdisziplinären Erschließung des Pazifismus in weiten Teilen erfüllt hat, wobei jedoch ein deutlicher Überhang der evangelisch-theologischen Perspektive auszumachen war. Die vielfältigen Beiträge eröffneten zahlreiche neue Forschungsperspektiven. Für weitere Forschung bieten sich u.a. die in den Tagungsdiskussionen immer wieder thematisierten Spannungen an, die neorealistische Aufrüstungstendenzen für den (christlichen) Pazifismus schaffen. Darüber hinaus konnte die Tagung dem Anliegen der Vernetzung von Wissenschaftler:innen und Friedenspraktiker:innen Rechnung tragen und einen gewinnbringenden Rahmen für Austausch und gegenseitiges Lernen schaffen.
Anna Löw