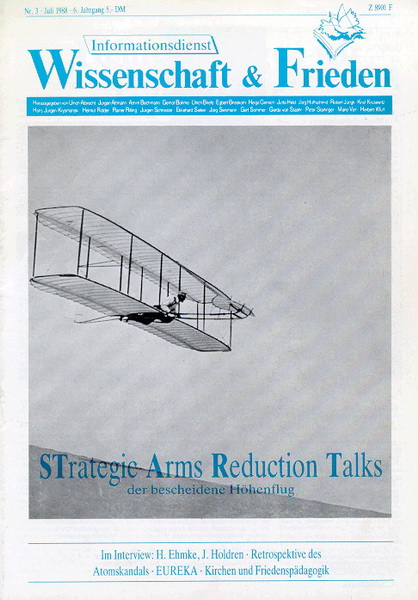Retrospektive des Atomskandals: Was ist an der Wahrheit so gefährlich?
von Detlef zum Winkel
Viel ist nicht herausgekommen bei der „rückhaltlosen und lückenlosen Aufklärung“ der Vorgänge in Hanau und Mol, die die Regierenden vor einem halben Jahr täglich versprachen. Immerhin aber das: In der Produktion von Pointen ist das Bundesumweltministerium kaum zu übertreffen. Letztes Jahr hatte Walter Wallmann noch im Bonner Amt den Klassiker geprägt, das bundesdeutsche Plutonium werde Gramm für Gramm überwacht. Dieses Jahr formulierte sein Nachfolger Töpfer das geflügelte Wort: „ich suche auch hier wirklich die Urmehrheit – auch auf die Gefahr hin, daß wir sie finden“.(„Spiegel“, 11.1.88)
Was als pfälzische Heiterkeit gedacht war, wird von der Realität in häßlichen Zynismus verwandelt: Die unbekannte Wahrheit hat tatsächlich zwei Akteuren das Geschehens das Leben gekostet. Das ist der Unterschied zum Flick-Skandal. Jener allerdings erlaubt es, auf die finanzielle Größenordnung der Geschäfte zu schließen, um die es gegangen sein könnte. Bei 20 Millionen Bestechungsgeldern sollten nach den von Flick gesetzten Maßstäben Milliarden im Spiel sein. Daran dachte wohl der spendenerfahrene Kanzler, als er Mitte Januar fragte: „21 Millionen für das bißchen Zeug?“ („Spiegel“, 18.1.88)
Die Vorgeschichte
In der zweiten Märzwoche 1987 informierte der damals neue Geschäftsführer der Transnuklear, Hans Joachim Fischer, das Management von TN und ihrer Mutterfirma Nukem über „Unregelmäßigkeiten“ in den Abrechnungen: Zwischen 1981 und 1986 seien von der Abteilung Radioaktive Abfälle fünf bis sechs Millionen Mark Schmiergelder gezahlt oder unterschlagen worden. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende der Nukem und seine Stellvertreter, Spalthoff (RWE) und Becker (Degussa) wurden informiert. Fischer machte den Vorschlag, eine Selbstanzeige beim zuständigen Finanzamt oder bei der Hanauer Staatsanwaltschaft einzureichen. Doch die Degussa zögerte über wiederholte Interventionen ihrer Steuerabteilung die Selbstanzeige um runde drei Wochen hinaus: bis zum 7 April, genau zwei Tage nach der hessischen Landtagswahl. Trotz allen inzwischen vorgebrachten Erläuterungen und Relativierungen ist ganz klar, daß die Affäre erst nach dem Wahltermin öffentlich werden sollte Die Manager verhehlen nicht, wem ihre politischen Sympathien damals galten: Wallmann, der es dann auch knapp schaffte.
Bis Mitte Dezember 1987 konnte man erfahren, daß Transnuklear Angestellte bundesdeutscher Atomkraftwerke und Energieversorgungsunternehmen sowie des Kernforschungszentrums CEN im belgischen Mol „beschenkt“ hatte, um sich „lukrative Aufträge“ zur Entsorgung des schwach- bis mittelradioaktiven Abfalls zu beschaffen, wie er in den AKWs ständig anfällt. In diesem Bereich (kontaminierte Arbeitskleidung, Reinigungsmittel u.ä.) bot die Firma nämlich nicht nur Transportleistungen an, sondern einen „Entsorgungsservice“. So schloß sie mit den AKW-Betreibern Verträge ab, wonach die genannten Abfälle konditioniert (Verfressen/Verbrennen/Verfestigen zur Volumenreduzierung und in endlagerfähiger Form zurückgebracht werden sollten. Da TN über keine eigene Konditionierungsanlage verfügte, arbeitete man mit den Kernforschungszentren in Karlsruhe, Mol und Studsvik (Schweden) zusammen. Vor Ort in Mol waren TN-Angestellte mit „Sortierungsarbeiten“ der radioaktiven Abfälle beschäftigt. „Hantierungsarbeiten“ für TN leistete auch die Firma Smet Jet auf dem Gelände des CEN.
Versionen mit kurzer Lebensdauer
Zunächst hieß es, Sicherheitsbelange seien bei dieser „branchenüblichen“ Auftragsbeschaffung nicht verletzt worden. Diese Behauptung ließ sich nicht mehr aufrechterhalten, nachdem in Belgien zwei Direktoren des CEN wegen der Annahme von TN-Geldern entlassen worden waren und dort ebenfalls Staatsanwaltliche Ermittlungen eingesetzt hatten. Am 8. und 15.12.87 sahen sich Transnuklear und Preußen-Elektra zu weiteren Eingeständnissen gegenüber dem Bundesumweltministerium veranlaßt: In Mol konditionierte und an die Atomkraftwerke zurückgelieferte Abfälle enthielten geringe Mengen Plutonium und größere Mengen Kobalt 60. Daraus folge, daß andere Abfälle „untergemischt“ worden seien, die nicht von den in den Begleitpapieren ausgewiesenen Kraftwerken stammten. Außerdem habe TN an Smet Jet im Laufe von 8 Jahren ca. 24 Mio. DM gezahlt, obwohl die Leistungen der belgischen Firma allenfalls mit 8 Mio. zu veranschlagen seien: weitere 15 Millionen, die möglicherweise für Bestechungen aufgewendet wurden.
Am 15.12.87, zeitgleich zum Bekanntwerden dieser neuen Informationen, nahm sich der ehemalige TN-Angestellte Hans Holtz, der die schwarze Kasse geführt und die „nützlichen Aufwendungen“ notiert hatte, in der Untersuchungshaft das Leben. Töpfer entzog der Firma am 17.12.87 bis auf weiteres die Genehmigung für Atomtransporte und ordnete einer Überprüfung ihrer Zuverlässigkeit an. Bis zum Jahreswechsel wurden in verschiedenen Atomkraftwerken, Zwischenlagern und Forschungsinstituten knapp 2000 Mol-Fässer registriert, während die genaue Untersuchung ihres Inhalts auf sich warten ließ.
Transnuklear hatte rasch eine Erklärung für die Plutoniumverunreinigungen zur Hand, wobei es nicht sehr fair war, daß das Unternehmen über seinen Pressesprecher Jörg Pompetzki sogleich versuchte, dem toten Hans Holtz und einigen entlassenen Mitarbeitern die alleinige Verantwortung zuzuschieben: sie seien „in „dunkle Geschäfte“ mit falsch deklarierten radioaktiven Abfällen verwickelt“(„FAZ“, 17.12.87). TN zufolge handelte es sich um 321 zwischen 1982 und 1984 gelieferte Fässer mit Rückständen des Reaktors BR-3 in Mol. In diesem 1987 stillgelegten Forschungsreaktor habe sich 1977 eine „Leckage“ ereignet, weshalb der Primärkreislauf dekontaminiert werden mußte. Die verfestigten Reinigungsschlämme mit insgesamt 211 Milligramm Plutonium seien auf jene 321 Fässer verteilt worden. Die Verunreinigung betrage pro Faß etwa 300 Millicurie Kobalt 60 und 0,04 mCi entsprechend 0,57 mg Plutonium 239. Diese Werte lägen innerhalb des Erlaubten, und dementsprechend hätten auch Messungen der Strahlendosis an der Oberfläche der Fässer nichts Auffälliges ergeben können.
Garantieren könne TN allerdings nicht dafür, daß nicht auch weitere Fässer mit Fremdstoffen gefüllt seien, die nicht von ihren Absendern stammen („Frankfurter Rundschau“, 18. und 22.12.87; „Spiegel“, 28.1287). Später wurde genauer bekannt, wohin die 321 Fässer geliefert wurden: 64 nach Neckarwestheim, 150 nach Würgassen, 107 nach Stade, wobei die letzte Charge in der Lagerhalle Kleinensiel des AKW Unterweser landete. Nach Informationen der „taz“ (13.1.88) soll Transnuklear diese Angaben im Dezember von Mol erhalten haben.
Die Belgier, die nach dieser Version nicht nur TN-Gelder kassiert sondern auch noch eigenen Pu-kontaminierten Abfall heimlich und billig beiseitegeschafft hätten, gaben die 321 Fässer zu, behaupteten aber, ihrerseits geschädigt worden zu sein, weil TN große Mengen Abfälle geliefert habe, die in Mol gar nicht konditioniert werden konnten. Von 1983 bis 1987 habe das Hanauer Unternehmen 6000 Kubikmeter Abfälle angefahren, wovon 4900 Kubikmeter bearbeitet wurden. Von den verbleibenden 1100 Kubikmetern könnten nach Untersuchungen noch 500 Kubikmeter konditioniert werden, die restlichen 600 Kubikmeter seien jedoch wegen zu hoher Bestrahlung in Mol nicht bearbeitungsfähig. Bei diesen 600 Kubikmetern handle es sich jedoch nicht um plutoniumhaltige Abfälle, erklärte das belgische Energieministerium zur Erleichterung der Kollegen in der BRD (Bericht Töpfers vom 21.12.87).
Von Transnuklear-Angestellten kamen dagegen Hinweise, wonach sich auch spaltbares Material in dem BRD-Abfall befunden habe, der nach Mol transportiert wurde („Spiegel“, 28.12.87). So könne bei Brennelemente-Schäden Plutonium in den leichtaktiven Müll geraten. In diesem Kontext sah sich Umweltminister Töpfer am 23.12.87 genötigt, eine Überprüfung Störfälle in Siedewasserreaktoren seit 1984 anzuordnen. Konkret wurde der Verdacht geäußert, 100 Gramm alphaaustrahlenden Materials seien nach einem Störfall unter falscher Bezeichnung, d.h. mit dem gewöhnlichen schwachaktiven Abfall nach Mol gegangen. Diese 100 Gramm wurden als Uranstaub mit Plutoniumspuren beschrieben. Neben Caesium, was wegen der Kernspaltung logisch ist, sei auch noch Kobalt 60 darin enthalten gewesen („FR“ und „FAZ“, 29.12.87), ein Radioisotop, das nie zu fehlen scheint und von der Presse gelegentlich der Einfachheit halber auch als Spaltprodukt bezeichnet wird („FR“ und „FAZ“, 5.1.88), ohne ein solches zu sein. Die Atomkraftwerke Philippsburg und Grundremmingen, bei denen ein solcher Störfall vermutet wurde, widersprachen umgehend. Auch die Staatsanwaltschaft Hanau dementierte, Beweise hierfür zu haben. Trotzdem nahm Töpfer den Vorfall in seinen Bericht über die Entsorgung des Atommülls in der Bundesrepublik auf („taz“, 14.1.88). Später wurde tatsächlich eine einzelne Brennstofftablette im Abklingbecken des AKW Philippsburg gefunden („taz“, 24.2.88). Freilich sind alle hier genannten an spaltbarem Material – sowohl diejenigen, die nach Mol gingen als auch diejenigen, die von dort zurückkamen – unter dem Gesichtspunkt einer Proliferation irrelevant – wenn die Mengenangaben stimmen.
Die Kontrollinstanzen IAEO und Euratom hatten es daher leicht, sich für nicht zuständig zu erklären und darauf zu verweisen, daß an solchen Abfällen eigentlich niemand interessiert sein kann. Der Atomskandal rangierte unter dem Stichwort „ungelöste Entsorgung“. Wenn schon die Handhabung der schwach- bis mittelaktiven Abfälle derartige Probleme bereite, so fragten die Kommentatoren, wie werde es dann erst mit der Wiederaufarbeitung und Endlagerung der bestrahlten Brenn elemente aussehen? Aber Mitte Januar nahm die Geschichte ihre nächste spektakuläre Wendung.
Der Paukenschlag
Am 14.1.88 antwortete Wallmann im Umweltausschuß des hessischen Landtags auf eine Frage des Grünen Joschka Fischer, im Zusammenhang mit den Vorgängen in Mol gebe es den konkreten Verdacht einer Proliferation waffenfähigen Spaltmaterials an Pakistan oder Libyen. Am gleichen Tag verfügte Töpfer die vorläufige Stillegung der nuklearen Produktion bei der Hanauer Nukem, weil das Unternehmen die Behörden unzureichend informiert hatte. Diese Maßnahme habe aber, wie in den folgenden Tagen in Bonn und Wiesbaden betont wurde, nichts mit dem Proliferationsverdacht zu tun.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die Vorwürfe gegen Nukem. Bei der Mutterfirma von Transnuklear, „im Auge des Taifuns“ („Spiegel“), wurden 50 Mol-Fässer erst „entdeckt“, als quer durch die Republik bereits 2000 Fässer aus Belgien gemeldet waren. Von diesen Fässern wußte Nukem seit 1985, daß sie Spuren von Caesium 137 und Kobalt 60 enthielten. Weil diese Nuklide nicht von den Alkem-Abfällen stammen könnten, verweigerte das Unternehmen die Annahme der Fässer, so daß sie einfach in einer Lagerhalle von TN abgestellt wurden. Darüber hinaus waren zwei Fässer nicht mehr auffindbar; ein weiteres Faß war trotz der Kontaminierung an die Uranverarbeitungsanlage Gewerkschaft Brunhilde im pfälzischen Ellweiler gegangen.
Unabhängig von den unterschiedlichen Bewertungen wird von Nukem und den Behörden die im wesentlichen übereinstimmende Darstellung gegeben: Von 1983 bis Anfang 1987 ließ Nukem 42,5 Tonnen uranhaltige Betriebsabfälle von TN nach Mol bringen. Dabei habe es sich um zerkleinerte Büromöbel gehandelt, die mit angereichertem Uran kontaminiert gewesen seien. In Pressemeldungen wird von „hoher“ oder „starker“ Anreicherung gesprochen, was nicht auszuschließen ist, da das Nukem-Uran Anreicherungen bis zur Waffentauglichkeit besitzt. Um die Auflagen für schwach bis mittelaktiven Abfall einzuhalten, will das Unternehmen angereichertes Uran hinzugegeben haben, bis mit Hilfe einer solchen „Verdünnung“ die Isotopenzusammensetzung von Natururan (0,71 % U 235) erreicht worden sei.
Die so präparierten Abfälle seien nicht zu einer endlagerfähigen Konditionierung nach Mol geschickt worden, sondern nur zur Verbrennung. Denn man wollte, sagt Nukem, versuchen, das enthaltene Uran später „als Kernbrennstoff zurückzugewinnen“. Die Quantitäten müßten demnach so gewesen sein, daß ein solcher Versuch als lohnend erschien. 53 Fässer zu je 200 Litern, von Nukem als „Asche mit Natururan“ deklariert, seien zwischen 1984 und 1986 zurückgekommen, zunächst 1984 in einer gesonderten Sendung zwei Stück, die angeblich nicht vollständig gefüllt seien. Daher habe man sie bei Nukem „mit Reststoffen in verschiedenen Abfallfässern zusammengefaßt". Zusammen sollen die beiden verschwundenen Fässer 114 kg Material enthalten haben.
Aus den folgenden 51 Fässern zog Nukem 1985 Proben, in denen geringe Beimengen von Kobalt 60 und Caesium137 festgestellt wurden: 3 bis 5 Becquerel pro Gramm Reststoff in der Hälfte dieser Fässer. Ferner ergab die Untersuchung Hinweise darauf, daß die Behälter auch angereichertes Uran enthielten, das „Kernbrennstoffcharakter“ besaß. Von der Verunreinigung mit „Fremdstoffen“ und dem Brennstoffcharakter des Urans wurden die Aufsichtsbehörden nicht informiert; auch wurde damals keine Plutoniumsanalyse vorgenommen, obwohl der Caesiumbefund dies nahegelegt hätte. Wären die Behörden informiert worden, so der hessische Umweltminister Weimar, so wären die dubiosen Abfallverschiebungen und Vermischungen in Mol wahrscheinlich schon vor drei Jahren aufgeflogen. Stattdessen schickte Nukem im Juli 1986 eine Probe mit 15 kg solcher uranhaltiger Asche (anderen Berichten zufolge zwei Proben zu je 15 kg) an die Uranverarbeitungsanlage in Ellweiler, um prüfen zu lassen, ob eine Rückgewinnung des Urans möglich wäre. Eine Bearbeitung ist dort aber anscheinend nicht erfolgt.
Weitere 22 Fässer der Nukem mit ähnlichem Inhalt lagern noch in Mol. Daraus und aus der bereits nach Hanau zurückgelieferten Sendung ließ Nukem im Oktober 1987 Proben entnehmen, um sie nun auch auf Plutonium untersuchen zu lassen. Für die noch in Mol lauernden Nukem-Fässer wurde ein Pu-Gehalt von 6 Nanogramm pro Gramm Asche ermittelt; das Ergebnis für die Proben aus Hanau stand im Februar immer noch aus und wurde m.W. auch später nicht bekanntgemacht (nach „Siemens/argumente“, 9.2.88). Noch im Dezember, als die Untersuchungen zu Transnuklear auf vollen Touren liefen, verschwieg Nukem den Behörden, diese Analysen in Auftrag gegeben zu haben. So erweckte die Firma den Eindruck, daß sie etwas zu verbergen hat.
Der ungeheuerliche Verdacht
Auch heute weiß man darüber nicht mehr als die paar Schlagzeilen vom Januar, zu denen die Texte nicht geschrieben oder nicht veröffentlicht wurden: waffenfähiges Spaltmaterial aus Mol sei von Transnuklear nach Lübeck transportiert, dort auf einem finnischen Schiff unter einer Ladung Koks versteckt worden und über Schweden nach Pakistan oder Libyen gelangt. An dem Handel seien die Bremer Hansa Projekt Transport und die Lübecker Neuen Metallhüttenwerke beteiligt gewesen, beide im Besitz der pakistanischen Brüder Gokal, die im Ruf stehen, Waffenhändler zu sein. Gelegentlich wurden auch Bremen und Hamburg als Häfen genannt, über die Proliferationsgeschäfte abgewickelt wurden. Weil zwei Nukem-Fässer abhanden gekommen waren, konzentrierte sich in den Medien der Verdacht darauf.
Am Abend des 15.1.88 dementierte in Hanau Jörg Pompeßski, Firmensprecher von Nukem und TN, waffenfähige Atomexporte nach Pakistan, Libyen oder Sudan (letzteres war gar nicht behauptet worden, doch soll Khartoum ein Hauptumschlagsplatz für unkontrollierte bzw. illegale Nukleargeschäfte sein: ein „grauer Markt“). Lediglich Kobalt 60-Strahlungsquellen seien für medizinische und technische Zwecke nach Pakistan exportiert worden. Ferner habe Nukem einmal 19,45 kg Uran in Form von Hexafluorid an Pakistan verkauft. Der Stoff sei 1978 für Laborzwecke geliefert worden. Über seinen Anreicherungsgrad wurden keine Angaben gemacht. Weitere Pressemeldungen und Import/Export-Tabellen norddeutscher Häfen zeigen ein reges internationales Geschäft mit Kobalt 60-Sendungen, auch nach Libyen und Südafrika.
Der Begriff des spaltbaren Materials, das zur Herstellung von Atombomben geeignet sein könnte, ist ein weites Feld. Der belgische Sozialist und Europa-Abgeordnete Glinne sprach definitiv von 45 kg hochangereicherten Urans, die in pakistanischen Besitz gelangt seien. Dafür seien „praktisch alle europäischen Staaten“ verantwortlich („FR“ und „FAZ“,19.1.88). Hingegen wurde in der Boulevardpresse mit Bestimmtheit die These vertreten, es sei um Plutonium gegangen. So hatte die Frankfurter „Abendpost-Nachtausgabe“ schon am 18.12.87 behauptet, belgische Behörden hätten bestätigt, daß TN „mit Hilfe von Bestechungsgeldern Plutonium ungenehmigt in Mol untergebracht hat“. „Ausgediente Brennstäbe“ seien in Mol bearbeitet worden, doch die „Restabfälle“ seien nicht zur Zwischenlagerung in die Bundesrepublik zurückgekommen, sondern durch anderen Atommüll ausgetauscht worden. „Bild“ berichtete am 15.1.88, „daß offenbar in (genehmigte) Atommüll-Fässer (verbotenerweise) hochgiftiges Plutonium gefüllt wurde. Transnuklear transportierte die Fässer ins belgische Atomkraftwerk Mol. Dort soll das Plutonium herausgeholt und weiter verschoben worden sein – möglicherweise nach Pakistan und Libyen.“
Technologien zur Plutoniumextraktion – sei es durch Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennstäbe oder durch Rückgewinnung aus Abfällen, die stark mit Plutonium versetzt sind – waren in Mol vorhanden: Von 1968 bis 1974 wurde dort die WM Eurochemic von 12 westeuropäischen Ländern betrieben. Die „FAZ“ (16.1.88) merkte dazu an, es müsse geprüft werden, ob sich die Geschäftsführung, heute als Belgoproces N.V. mit Dekontaminierungsarbeiten befaßt, wirklich seit 1974 an die Stillegung gehalten hat. Als geschlossene Anlage unterliegt dieser Bereich auch nicht der IAEO-Kontrolle. Zweitens wurde auf dem Eurochemic-Gelände unter Regie des Karlsruher Kernforschungszentrums eine sog. Naßveraschungsanlage errichtet, um Plutonium aus brennbaren Abfällen zurückzugewinnen, gedacht vor allem für stark plutoniumhaltige Betriebsrückstände aus der Wiederaufbereitung oder der Brennelementeproduktion. Mit diesem Verfahren produzierte Belgoproces N.V. im Rahmen eines zweijährigen Demonstrationsbetriebs (1983-85) 6 kg Plutonium aus 4 Kubikmetern brennbarer Eurochemic-Abfälle. Nach Mitteilung des KfK wurde dieses Plutonium in die Spaltstofflußkontrolle einbezogen, wobei es in der Natur der Sache liegt, daß sich IAEO/Euratom nur im guten Glauben auf die Angaben der Betreiber verlassen können.
Keine Mitteilung gibt es darüber, ob und in welchem Umfang dieses als ausgesprochen erfolgreich beschriebene Verfahren nach 1985 fortgesetzt wurde.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Proliferation von militärisch interessantem Spaltmaterial nach Pakistan oder in andere Länder wurden in einem „FAZ“-Artikel (16.1.88) durchgespielt, um zu dem Schluß zu kommen, daß die direkte Weitergabe vom waffenfähigem Uran 235 oder Plutonium 239 unwahrscheinlich sei. „Eher wäre (…) denkbar, daß die Fässer abgebrannten Brennstoff enthalten, der zunächst wiederaufgearbeitet werden müßte.“ Dann wären allerdings nicht nur zwei Fässer, sondern ganz andere Mengen verschoben worden.
Tatsächlich verfügt Pakistan dank belgisch-französischer Technik über eine Wiederaufbereitungstechnik, die sicherlich militärischen Zwecken dienen soll. „Fraglich blieb jedoch bislang, woher der zu Atombomben zu verarbeitende Brennstoff kommen sollte“ (ebenda), weil die eigenen Reaktoren des Landes im Unterschied zu anderen Komponenten des pakistanischen Atomprogramms IAEO-Kontrollen unterworfen wurden, ohne daß bisher Unregelmäßigkeiten auffielen. Wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, wird man wiederum heimliche Exporte von Brennstäben mit hohem Abbrand, etwa solche aus kommerziellen stromerzeugenden Reaktoren, für relativ unwahrscheinlich halten. Wegen des hohen Abbrands wäre das daraus zu extrahierende schmutzige Plutonium waffentechnisch nicht sehr geeignet. Wegen der hohen Strahlung wären Transport und Bearbeitung ebenso gefährlich wie auffällig, und schließlich könnte das Material natürlich auch den Kontrollen entzogen werden. Etwas anders verhält es sich möglicherweise mit schwach bestrahlfern Material oder mit Betriebsabfällen aus der Brennelementeproduktion, die noch relevante Reste von hochangereichertem Uran oder Plutonium enthalten. Ein solches Material könnte problemlos als schwach- bis mittelaktiver Abfall getarnt nach Mol geschmuggelt worden sein. Und in Belgien gelten wiederum andere Abfallkategorien als in der Bundesrepublik.
Für die letzte Variante haben sich bisher die stärksten Indizien gefunden. Große Mengen der von Transnuklear ins Ausland beförderten, als schwach- bis mittelaktiv deklarierten Abfälle sind offensichtlich verschwunden. Wie bereits erwähnt, hatten gemeinsame deutsch-belgische Abklärungen Ende 1987 ergeben, daß in Mol noch 1100 Kubikmeter solcher Abfälle lagern müßten. Am 18.1.88 berichtete der „Spiegel“, das Brüsseler staatliche Amt für radioaktive Abfälle, Ondraf, habe Ende der ersten Januarwoche festgestellt, „daß knapp 700 Fässer mit deutschen Strahlrückständen in Belgien spurlos verschwunden sind, nachdem sie beim belgischen TN-Tochterunternehmen „Smet Jet“ angeliefert worden waren.“ Zehn Tage später bestätigte die Geschäftsleitung von TN gegenüber der „FAZ“ (28.1.88): „Belgien habe zugesagt, die 321 Fässer im Gegenzug gegen deutschen Müll zurückzunehmen. Der deutsche Abfall sei aber nicht mehr aufzufinden.“ Ähnliches ergaben Ermittlungen in Schweden. Anfang April teilte die schwedische Atomenergiebehörde mit, fünf angekündigte TN-Transporte von radioaktiven Abfällen, die zur Verbrennung nach Studsvik gebracht werden sollten, seien dort nicht angekommen. Wo ist es geblieben, das bißchen Zeugs?
Krisenmanagement
Bewiesen ist bisher nur der enge wissenschaftlich-technische Austausch des CEN in Mol und der Plutoniumfabrik Belgonucleaire im benachbarten Dessel mit Pakistan, obwohl sich die belgische Seite jederzeit über die militärischen Ambitionen Islamabads bewußt war. Aus der BRD hat die Degussa-Tochter Leybold Heraeus (Köln/Hanau) Pakistan maßgeblich beim Erwerb der Urananreicherungstechnologie geholfen. Pakistan selbst erklärte, es habe keine illegalen Nuklearimporte aus der Bundesrepublik oder Belgien erhalten. Libyen sprach von Verleumdungen des „zionistischen Geheimdienstes“. Die IAEO bekräftigte die Effektivität ihrer Kontrollen und bescheinigte den Firmen in Hanau und Mol, für Abzweigungen von Spaltstoffen hätten nie Anhaltspunkte vorgelegen. Die Hanauer Staatsanwaltschaft dementierte das Vorhandensein irgendwelcher Beweise. Am 20.1.88 erklärte die Bundesregierung über ihren Sprecher Ost, die „ungeheuerlichen Verdächtigungen der letzten Tage“, daß von deutschen Firmen direkt oder indirekt der Atomwaffensperrvertrag verletzt worden sei, entbehrten „jeglicher Grundlage“.
Gleichwohl wurden bei den Hanauer Firmen einige Veränderungen veranlaßt, zwar keine „tiefen Schnitte“, die der ganzen atomaren Familie Schmerzen bereitet hätten, aber doch Maßnahmen, bei denen widerstreitende Interessen sichtbar wurden. Am interessantesten: Die RWE verkauften ihre Nukem-Anteile (45 %) an den HTR-Hersteller BBC/Babcock, der gerade ein „Riesen-Atomgeschäffe mit China“ („FR“, 12.3.88) abgeschlossen hatte. Für den Bau eines ersten chinesischen Hochtemperaturreaktors gingen Aufträge über mehrere 100 Millionen Mark an BBC und andere bundesdeutsche Firmen. Dem Bonner Untersuchungsausschuß berichtete Töpfer am 21.4.88, es seien 2362 Gebinde von Transnuklear falsch deklariert aus Mol in die BRD zurückgeliefert worden. Die von diesen Fässern ausgehende Strahlung bewege sich jedoch innerhalb der genehmigten Werte. Hatte die „FAZ“ am 6.1.88 noch voller Eifer gemeldet „Alle fast 2000 Atommüllfässer sollen geöffnet werden“, so waren 14 Wochen später nur 50 Fässer auf ihre Nuklidzusammensetzung untersucht worden. In vier Fässern habe die Pu-Kontaminierung zwischen 1 und 2,8 mg betragen, in allen anderen lag sie unter einem Milligramm. Solche geringen Beimischungen seien bei Verbrennungsanlagen wie derjenigen in Mol üblich. Die Fässer seien für die Endlagerung geeignet.
Wohin führen die Spuren? Just zum Zeitpunkt dieser beruhigend abgefaßten Worte gab die Hanauer Staatsanwaltschaft bekannt, noch einmal 50 Mol-Fässer im Auge des Taifuns gefunden zu haben, bei Transnuklear. Die neuen Fässer würden auch andere Stoffe als schwach strahlendes Material enthalten („FAZ“, 22.4.88). Bis zum Juni stieg die Zahl der in der BRD registrierten Mol-Fässer auf über 5000, mindestens 2400 davon falsch deklariert. Das ist das Siebeneinhalbfache der anfänglich in Hanau und Mol eingeräumten 321 Fässer. Bei jener Sendung mit angeblichen Rückständen von Reinigungsschlamm aus dem BR-3-Reaktor in Mol stellte sich heraus, daß in die Fässer noch einmal Stahlbehälter einzementiert waren. Erst darin befand sich das radioaktive Material, der Zement war strahlungsfrei. Es handelte sich also nicht einfach um ein Vermischen verschiedener Abfälle und schon gar nicht um eine Querkontaminierung bei der Verbrennung, sondern um ein regelrechtes Verstecken – und um einen ziemlichen Aufwand, der das Ganze nicht nur harmlos erscheinen läßt, wie es von Töpfer schließlich dargestellt wurde. Wider Erwarten enthielt der Stoff überhaupt keine Caesium-Beimischungen, so daß die ganze These eines Reaktorstörfalls mit Brennelementeschaden als recht fragwürdig erscheint („Nordseezeitung“, 29.2. und 1.3.88).
Mehrere Fälle von Plutonium-Verunreinigungen betrafen Fässer, die nicht zu der 321 er Charge gehören, ohne daß daraus auf den gesamten Pu-kontaminierten Anteil der 2400 falsch deklarierten Fässer geschlossen werden könnte. Seltsamerweise scheint dabei immer auch Kobalt 60 aufzutreten. Bei der Untersuchung von zehn Fässern in Baden-Württemberg fanden sich neben „typischen Kernkraftwerksabfällen“ auch Anhaltspunkte dafür, „daß schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus anderen kerntechnischen Anlagen mitverarbeitet worden sind.“ („Siemens/argumente“, 9.2.88). Handelt es sich dabei um Wiederaufarbeitung, Brennelementeprodukte oder Anreicherung? Beträchtlich war auch der Uran-Anteil in den Nukem-Fässern, als Asche mit Natururan „deklariert“: In den 50 aus Mol zurückgelieferten Fässern mit einem Gesamtinventar von 7085 kg befanden sich 756 kg Uran, das Zehnfache der anfänglich vermuteten Menge. Die Anreicherungsgrade waren unterschiedlich. In 20 Fässern sei das Uran in kernbrennstoffähiger Form vorhanden gewesen. „Der Höchstwert, der vom Umweltministerium bislang ermittelt worden ist, liegt bei 4,4 % Uran 235.“ („FR“, 21.1.88). Meint das die Isotopenzusammensetzung oder, weil hier nichts ausgeschlossen werden kann, den Anteil am gesamten Faßinhalt? Dann nämlich werde es sich um stark angereichertes Uran handeln.
Andererseits ist auch nicht auszuschließen, daß die Plutonium - Caesium - Verunreinigungen in den Nukem-Fässern nicht erst in Mol entstanden sind. Diese Spuren von abgebrannten Brennstäben können auch zu der Firma selbst zurückführen. Schon im Frühjahr 1987 hatten die hessischen Aufsichtsbehörden registriert, daß Nukem ihre genehmigte Umgangsmenge mit schwach bestrahltem Uran (30 kg) um das Achtfache überschritten hatte. Es handelte sich z.T. um Brennstoff aus Forschungsreaktoren mit niedrigem Abbrand. Der IAEO war das nicht aufgefallen. Dabei verdeckt die harmlose Bezeichnung der schwachen Bestrahlung, daß sich waffenfähiges Plutonium darin befinden kann, wenn auch nur in geringen Anteilen. Immerhin wurde ein Teil dieses Materials in den staatlichen Plutoniumbunker bei der Schwesterfirma Alkem überführt, was nicht gerade für seine Harmlosigkeit spricht. Was wurde aus dem anderen Teil?
Fassen wir zusammen: Ausgeschlossen ist, daß die Pu-Verunreinigungen in den Mol-Fässern auschließlich auf den genannten Reinigungsschlamm von dem belgischen BR-3-Reaktor zurückzuführen sind. Es muß auch andere Ursachen aus anderen kerntechnischen Anlagen dafür geben. Um sie nachzuweisen, müßte man die genauen Analyseergebnisse kennen. Ziemlich unwahrscheinlich ist, daß die Pu-Verunreinigungen ausschließlich von belgischem Material herrühren. Durchaus möglich ist es, daß sich in dem von der BRD nach Mol transportierten, als schwach- bis mittelaktiv deklarierten Abfall relevante Mengen von Spaltstoff befanden, die eine chemische Rückgewinnung lohnend erscheinen lassen – auch für militärische Atomprogramme.
Schließlich ist sogar das Unwahrscheinliche möglich, daß bestrahlte Brennelemente aus kommerziellen westdeutschen Atomkraftwerken verschoben wurden. Dazu müssen wir in die Vorgeschichte des Skandals zurückgehen, als von falschen Frachtpapieren und Proliferation noch nicht die Rede war. Am 4.9.87 berichtete die "Zeit" von einem Provisionsgeschäft der Transnuklear mit dem Preußenelektra-Sachbearbeiter Klaus Ramcke, der auf der Liste von Hans Holtz an oberster Stelle stand, d.h. mit rund einer dreiviertel Million den höchsten Betrag aus der schwarzen Kasse erhielt.
Ramcke sollte 220.000 DM erhalten, „wenn er der TN den Auftrag zur Entsorgung von radioaktiven Abfällen verschaffte, die bereits zerschnitten in einem Becken des Reaktors in Wergassen lagerten.“ schwach- bis mittelaktive Abfälle legt man aber nicht zerschnitten in ein Becken; dies tut man nur mit abgebrannten Brennelementen. Folglich war das in der Öffentlichkeit präsentierte Motiv für die „nützlichen Aufwendungen“ der Transnuklear von Anfang an falsch: Es ging nicht nur um schwach- bis mittelaktive Abfälle. Es ging sehr wohl auch um abgebrannte Brennelemente. Klaus Ramcke warf sich am 27.4.87 bei Hannover vor einen fahrenden Zug.
Ein illegaler Abfallkreislauf?
Eine Fülle weiterer Informationen hat der Atomskandal zutage gefördert – nicht weniger schwerwiegend als die Abfallverschiebungen. An erster Stelle wäre die führende Rolle der Nukem bei der Einschleusung namibischen Urans aus Südafrika in den Weltmarkt zu nennen. Durch „Umflaggen“ und „Ursprungs-Swaps“ werden die Beschlüsse der UNO und zahlreicher Staaten unterlaufen, keine nukleare Zusammenarbeit mit dem Apartheid-Regime einzugehen. Im Gegenzug hat die Bundesrepublik schon im letzten Jahrzehnt durch Transfer von Technologie und know how maßgeblich zur atomaren Aufrüstung beigetragen, wie auch der ehemalige IAEO-Direktor David Fischer vor dem Bonner Untersuchungsausschuß betonte.
Bekannt wurden frühere Plutoniumimporte der BRD aus Schweden und der Schweiz, Briefkastenfirmen von Nukem in der Schweiz und Luxemburg, offensichtlich um dubiose Handelgeschäfte zu tätigen, ungenehmigte inländische Unranvorräte – 6,6 Tonnen bei Transnuklear; eine Überschreitung um mehr als 200 Tonnen bei der Spedition Braunkohle – und bisher unbekannte, von Nukem verwaltete strategische Reserven des Bundes – 600Tonnen – ebenso wie ein Transnuklear-Lager im niedersächsischen Leese auf Bundeswehrgelände. Apropos Bundeswehr: Sie wäre im Bedarfsfall gewiß nicht darauf angewiesen, den Umweg über das Ausland oder über radioaktive Abfälle zu machen (…)
In Mol geht es – hauptsächlich – um die Frage der horizontalen Proliferation aus Belgien oder der Bundesrepublik an dritte Länder. Insbesondere geht es darum, welche Rolle „Abfall“-Lieferungen in diesem Zusammenhang spielen können. Beispielsweise hat Die Volksrepublik China in der Vergangenheit mehrfach ein Interesse am Import abgebrannter, aber noch nicht wiederaufgearbeiteter Brennelemente erkennen lassen. Dies wird für andere Staaten ähnlich gelten.
Jede/r mag für sich über das Gesetz Murphys sinnieren, wonach alles, was möglich ist, auch eintritt. Daß der Proliferationsverdacht "jeglicher Grundlage“ entbehre, ist jedenfalls die lächerlichste Episode dieser ganzen Geschichte. Beim Ziehen des Schlußstrichs war die Bundesregierung wieder einmal zu eifrig.
Detlef zum Winkel ist freier Journalist in Frankfurt/Main.