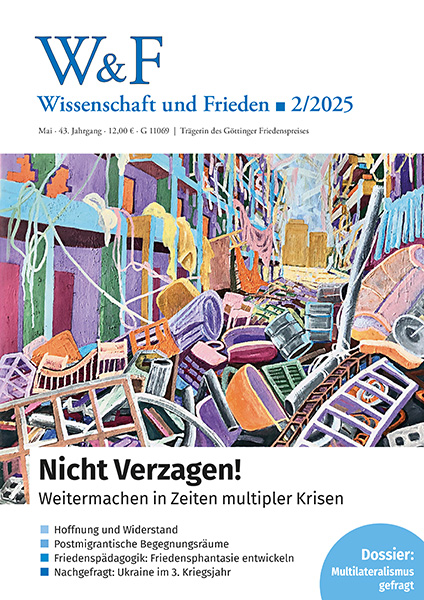Es stand in W&F
Perspektiven des Völkerrechts
Im Angesicht der Kriege, die in den letzten Jahren die Welt in Atem hielten, steht das Völkerrecht so stark in der Debatte wie seit langem nicht mehr. Mit Krisen, Kritiken und Perspektiven zur Erneuerung eines »Völkerrecht[s] in Bewegung« beschäftigte sich W&F 2/2021 und wagte eine Zwischenbilanz. In dieser Ausgabe argumentierte Hans-Joachim Heintze in seinem Beitrag »Blockierte Weltorganisation – Völkerrecht und Vereinte Nationen heute«, vor dem Hintergrund zerbrochener Hoffnungen bräuchte „die Welt stabile Regeln, wie mit Konflikten umzugehen ist. Diese finden sich in der VN-Charta, in deren Zentrum die Friedenssicherung steht. Die Verfahren zur Durchsetzung dieses Normenkataloges bedürfen nach einem Dreivierteljahrhundert der Anpassung an die neuen Gegebenheiten. Im Zentrum steht dabei das Völkerrecht, das sich von einem Recht der Souveränität zu einem Recht der Solidarität weiterentwickeln muss.“
Alternativer Umgang mit Bedrohung?
Welche Konzepte bestehen für Konfliktdynamiken »Jenseits der Eskalation« und einen alternativen Umgang mit Bedrohung? Hiermit beschäftigte sich die W&F 1/2023 auf der Suche nach anderen Lösungsansätzen. Damals, ein Jahr nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, bot Karim P. Fathi »Impulse für einen umfassenden und nachhaltigen Friedensprozess« im Russland-Ukraine-Krieg. Dabei fragte er, „was für einen nachhaltigen Frieden notwendig wäre“. Während Beiträge aus der Friedensforschung und -praxis dabei zu wenig beachtet würden und sogar zu Unrecht „Gegenstand von antipazifistischer Kritik“ geworden seien, könnten sie „über eine enge Debatte über Waffenlieferungen und militärische Erfolge hinausblicken. Wie kann ein nachhaltiger Frieden nach dem Ende des Russland-Ukraine-Kriegs gefunden werden, auch und gerade in Anbetracht seiner Tiefendimensionen? An welchen Stellschrauben könnte Friedenspolitik ansetzen?“
Berliner Notizen
Anmerkungen aus dem Politikbetrieb
Zuwachs für die Bundeswehr?
Der gesellschaftspolitische Diskurs um Krieg und Aufrüstung scheint sich nun auch in den Bewerbungen bei der Bundeswehr niederzuschlagen. Im vergangenen Jahr bewarben sich dort insgesamt 51.200 Menschen – 19 % mehr als in 2023. Im sogenannten »zivilen Bereich« stieg das Interesse um 41 %, Bewerbungen von weiblichen Anwärter*innen um 14 %. Trotz dieser alarmierenden Zahlen moniert die Bundeswehr insgesamt einen fehlenden Anstieg an Soldat*innen, denn zu viele Dienstleistende brächen ihren Dienst bereits in den ersten sechs Monaten ab.
Über den Zuwachs an Bewerber*innen bei der Bundeswehr hinaus werden in den Fraktionen aktuell verschiedene Gesetzesentwürfe diskutiert, die eine Aufstockung der Verteidigungsausgaben vorsehen.
Zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung
Die kommende Bundesregierung plant für die nächsten vier Jahre einiges an Einsparungen – neben dem Abbau von insgesamt acht Prozent der Stellen in der Bundesverwaltung sollen auch Förderprogramme und die finanzielle Unterstützung internationaler Organisationen und NGOs weniger Geld erhalten – die Tagesschau spricht von einer Milliarde Euro. Kommunen und Länder sollen hingegen stärker finanziell vom Bund unterstützt werden, insbesondere, wenn sie stark verschuldet sind. Unter dem Punkt »Sicheres Zusammenleben, Migration und Integration« kündigt die neue Koalition an: „Wir werden die europa- und verfassungsrechtlichen Spielräume ausschöpfen, um ein Höchstmaß an Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.“ Dazu zählt auch die Stärkung der Sicherheitsbehörden, die „Gründung eines nationalen Sicherheitsrats“, sowie die umstrittene „Vorratsdatenspeicherung“. Hinsichtlich des Ziels einer kurzfristig erhöhten Einsatzbereitschaft der Streitkräfte soll ein neuer Wehrdienst geschaffen werden, der „zunächst“ auf Freiwilligkeit basiert und sich in punkto „Attraktivität, Sinnhaftigkeit und Aufwuchsfähigkeit“ neu ausrichtet. Sowohl Wehrerfassung als auch Wehrüberwachung sind angestrebte Ziele. Auch beim viel diskutierten Thema Migration tritt die erwartete Verschärfung ein – so soll das Ziel der „Begrenzung“ in das Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden. Konkret werden, neben Zurückweisungen von Asylgesuchen an den Grenzen, alle humanitären Aufnahmeprogramme beendet, der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt und sogenannte „Migrationsabkommen“ sollen abgeschlossen werden. Das grundsätzliche Asylrecht soll erhalten bleiben.
Haushaltsausschuss beschließt Ukraine-Hilfen
Der Haushaltsausschuss hat erneut weitere Mittel zur Unterstützung der Ukraine und der Republik Moldau freigegeben. Es wurde sich auf eine überplanmäßige Ausgabe bis zur Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro und einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rund 8,3 Milliarden Euro bis 2029 geeinigt. Beantragt worden waren die Mittel vom Verteidigungsministerium.
In einer Vorlage der Regierung heißt es, der überplanmäßige und der außerplanmäßige Bedarf diene vorwiegend der Unterstützung der Ukraine durch die Beschaffung militärischer Ausrüstung bei der Rüstungsindustrie und Lieferung an das ukrainische Militär. Daneben diene der Mehrbedarf der Wiederbeschaffung von an die Ukraine abgegebenem Material der Bundeswehr. Außerdem werden nach Angaben der Bundesregierung angesichts der russischen Bedrohung Mittel für die ergänzende Ertüchtigung der zivilen und militärischen Sicherheitskräfte Moldaus zur Verfügung gestellt.
In der Debatte des Ausschusses erklärte die SPD-Fraktion ihre Zustimmung, die Unionsfraktion und die FDP schlossen sich ausdrücklich an. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen begrüßte, dass die Vorlage endlich beraten werden könne. Sie sahen die Dringlichkeit angesichts der dramatisch schwierigen Lage in der Ukraine als gegeben, seien doch alle diplomatischen Vorstöße bisher an Putin gescheitert. Die AfD-Fraktion bezeichnete die Entscheidung mit Blick auf die weit fortgeschrittenen Waffenstillstandsverhandlungen als kontraproduktiv. Die Linke und BSW äußerten sich ebenfalls ablehnend gegen die Waffenlieferungen.