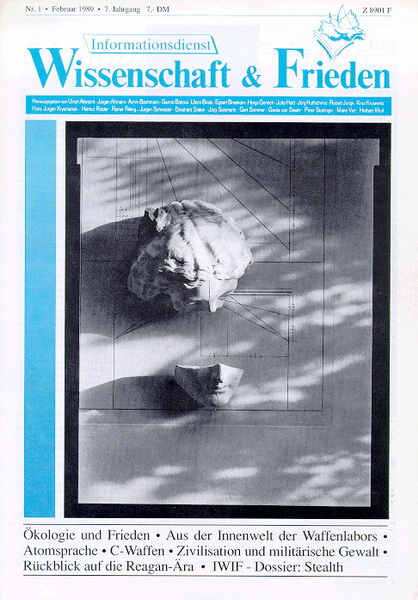Atomsprache und wie wir lernten, die Bombe zu streicheln (II)
Sex and death in the rational world of the defense intellectuals
von Carol Cohn
Obgleich mich die für die Sprache der Militärstrategen typische Mischung aus trockenen, abstrakten Begriffen und seltsamen Metaphern entsetzte, konzentrierte ich mich darauf, sie zu entschlüsseln und sprechen zu lernen. Zuerst mußte die Zunge daran gewöhnt werden, Abkürzungen auszusprechen.
Trotz jahrelanger Lektüre über Kernwaffen und atomare Strategien war ich weder auf die Menge der benutzten Abkürzungen noch auf die Art ihres Gebrauches vorbereitet. Ursprünglich hatte ich gedacht, sie seien bloß nützlich: Mit ihrer Hilfe kann man schneller schreiben und sprechen; ihre Funktion ist die des Abstrahierens, des Abstandnehmens von der hinter den Worten liegenden Realität; sie beschränken die Kommunikation auf einen Kreis von Eingeweihten – die Übrigen bleiben verständnis- und sprachlos vor der Tür.
Doch ich entdeckte noch andere unerwartete Dimensionen. Zum einen wirken viele dieser Ausdrücke beim Sprechen und Hören geradezu sexy. Eine kleine Überschallrakete, „dazu bestimmt, in jede erdenkliche sowjetische Luftabwehr einzudringen“, heißt SRAM (Short-Range Attack Missile). Auf U-Booten abschußbereit gehaltene Marschflugkörper (Submarine-Launched Cruise Missiles) werden »Slick'ems«, bodengestützte (Ground-Launched Missiles) »Glick'ems« genannt; luftgestützte Marschflugkörper (Air-Launched Cruise Missiles) sind magische »Alchems«.
Andere Abkürzungen, andere Funktionen: Das Flugzeug, in dem der Präsident angeblich über einem nuklearen Holocaust herumfliegen, Meldungen entgegennehmen und Befehle erteilen wird, wo als nächstes gebombt werden soll, wird »Kneecap« (Knieschützer) genannt (für NEACP, National Emergency Airborne Command Post, luftgestützter Befehlsposten im nationalen Notstand). Zwar glaubt kaum jemand, der Präsident könne tatsächlich noch die Zeit haben, es zu besteigen, oder daß – sollte es ihm gelingen – die Nachrichtensysteme funktionieren würden. Aber genau die Tatsache, daß man über dieses Konzept schmunzeln kann, macht es möglich, mit ihm zu arbeiten, statt es offen abzulehnen. Anders gesagt: Was ich im Zentrum für Nuklearstrategische Studien gelernt habe, ist, daß dieses Reden über Atomwaffen Spaß macht. Die Wörter sind schnell, sauber und unkompliziert, sie gehen leicht über die Lippen. Man kann sie dutzendweise in Sekunden herunterrasseln und dabei verlernen, über das nächste zu stolpern – oder gar über ihre Bedeutung für Menschenleben. Fast alle, die ich beobachtete – Professoren, Studenten, Falken, Tauben, Männer und Frauen – machten von diesen Wörtern mit Vergnügen Gebrauch. Manche von uns zwar mit einer bewußt ironischen Schärfe, doch das tat dem Vergnügen keinen Abbruch. Zum Teil lag der Reiz im Bewußtsein, daß wir in der Lage waren, mit einer Zeichensprache umzugehen, also die Macht besaßen, das Allerheiligste zu betreten. Wichtiger aber ist, daß die Aneignung dieser Sprache ein Gefühl von Herrschaft vermittelt, das Gefühl, Gebieter über eine Technologie zu sein, die letztendlich nicht beherrschbar ist, deren Macht aber das menschliche Fassungsvermögen transzendiert. Je länger ich mich im Zentrum aufhielt, je öfter ich an Gesprächen teilnahm, desto weniger Angst hatte ich vor dem Atomkrieg.
Die Verbannung konkreter Kriegsbilder
Wie kann die Tatsache, daß man eine Sprache sprechen lernt, eine derart starke Wirkung ausüben? Zum einen liegt es – wie schon erwähnt – an der abstrakten und sauberen technostrategischen Sprache, die konkrete Kriegsbilder verbannt. Doch es ist mehr als nur das: Ich habe erfahren, daß der Prozeß des Erlernens dieser Sprache mich selbst von der Realität des Atomkrieges entfernte. Meine Energien konzentrierten sich auf die Herausforderung, Abkürzungen zu entschlüsseln, neue Termini zu erlernen, Sprachkompetenz zu entwickeln – nicht jedoch auf die Waffen und Kriege, die die Vokabeln konkret beinhalten. Nachdem ich diesen Prozeß durchlaufen hatte, hatte ich weitaus mehr gelernt als nur eine andere – wenn auch abstrakte – Kategorie von Wörtern. Der Inhalt, die eigentliche Aussage dessen, worüber ich sprechen konnte, war ein völlig anderer geworden. Nehmen wir folgende zwei Beschreibungen, beide bezogen auf die Folgen eines atomaren Angriffs: „Alles war schwarz, in einer schwarzen Staubwolke verschwunden, zerstört. Nur die Flammen, die emporzuzüngeln begannen, hatten überhaupt Farbe. Allmählich wurden aus der Wolke, die wie ein Nebel war, Gestalten sichtbar, schwarz, haarlos, gesichtslos. Sie schrien mit Stimmen, die nicht mehr menschlich waren. Ihre Schreie übertönten das Stöhnen, das allenthalben aus dem Schutt aufstieg, ein Stöhnen, das aus der Erde selbst zu kommen schien.“1 „Unbedingt erforderlich sind Mittel und Wege zur Aufrechterhaltung einer Nachrichtenübermittlung in einer nuklearen Umwelt, einer Lage, zu der EMP-blackout, rohe und gewaltsame Beschädigungen der Systeme, schwere Sendestörungen usw. dazugehören.“ 2
Es ist ganz unmöglich, die im ersten Zitat wiedergegebenen Vorgänge in der Sprache des zweiten zu erfassen. Der Unterschied liegt nicht nur in der Wortwahl, der Lebendigkeit, sondern in ihrer inhaltlichen Aussage: Im ersten geht es um die Auswirkungen einer atomaren Explosion auf Menschen, das zweite beschreibt ihre Folgen für technische Systeme, deren Zweck es ist, die »Befehls- und Kontrollgewalt« über Kernwaffen sicherzustellen. Der Unterschied ist Ausfluß der je anderen Perspektive dessen, der spricht: Im ersten Fall ein Opfer, im zweiten ein »Täter«. Die Worte im ersten Zitat sind der Versuch einer Frau, das Grauen des menschlichen Leidens um sie herum zu benennen und zu fassen; dem Sprecher im zweiten Zitat geht es darum, die Möglichkeit eines atomaren Zweitschlages sicherzustellen.
Die technostrategische Sprache drückt nur die eine Perspektive aus: Die Perspektive dessen, der Atomwaffen einsetzt – nicht die ihrer Opfer. Wer diese Expertensprache spricht, dem bietet sich nicht nur die Gelegenheit, Abstand und ein Gefühl der Beherrschbarkeit zu gewinnen sowie seine Energien auf einen anderen Schwerpunkt zu verlagern; er/sie kann sich auf diese Weise auch dem Gedanken verweigern, selbst Opfer eines Atomkrieges zu werden. Was immer man tief im Innern von der Wahrscheinlichkeit eines atomaren Krieges weiß oder zu wissen glaubt, gleich, welch Schrecken oder Verzweiflung das Wissen um die Realität des Atomkrieges auch immer auslösen könnte: Jene, die die technostrategische Sprache sprechen, dürfen, ja müssen sich der Erkenntnis entziehen, flüchten davor, den Atomkrieg aus der Perspektive der Opfer zu sehen – mit Hilfe ihrer Sprache.
Vermutlich ist die reduzierte Angst vor einem Atomkrieg, die sowohl Neulinge wie auch langjährige Experten des technostrategischen Diskurses allgemein an sich erleben, eine Folge der Charakteristika dieser Sprache selbst: Distanz, die man sich aufgrund der abstrakten Begrifflichkeit leisten kann; das Gefühl, alles im Griff zu haben, das sich einstellt, sobald man die Sprache beherrscht; die Tatsache, daß ihr Inhalt und Anliegen Inhalt und Anliegen der Täter sind, nicht die der Opfer. Im Prozeß der Sprachaneignung wandelt sich der Sprecher vom passiven und ohnmächtigen Opfer zum kompetenten, schlauen und mächtigen Lieferanten atomarer Drohungen und atomarer Sprengkraft. Die ungeheuren Destruktionskräfte der nuklearen Waffensysteme werden zu Auswüchsen des Ich, nicht zu dessen Bedrohung.
Eine Welt der Abstraktionen
Ich benötigte nicht lange, um die Sprache des Atomkrieges und den größten Teil der in ihr enthaltenen Spezialinformationen zu erlernen. So verlagerte sich der Schwerpunkt meines Interesses rasch von der Beherrschung der technischen Informationen und doktrinären Geheimcodes auf die Suche nach der rationalen Begründung jener Doktrin, die ich erlernte. Da tieferliegende Gründe im Alltagsgeschäft der Verteidigungsplaner nicht eben häufig diskutiert werden, mußte ich beginnen, vermehrt Fragen zu stellen. Obwohl es mich zunächst reizte, meine neu erworbene Kompetenz im Bereich des technostrategischen Jargons unter Beweis zu stellen, gelobte ich mir, normales Englisch zu sprechen. Das Resultat: Egal, wie gut informiert meine Fragen, wie fundiert und umfassend mein Wissen waren: Benutzte ich anstatt des Expertenjargons normales Englisch, antworteten mir die Männer, als hätte ich keine blasse Ahnung, ein schlichtes Gemüt oder gar beides. Meine ausgeprägte Abneigung gegen eine gönnerhafte Behandlung wie mein Hang zum Pragmatismus hatten zur Folge, daß dieses Experiment nur von kurzer Dauer war. Ich verlegte mich erneut auf das einschlägige Vokabular, sprach von »Eskalationsdominanz«, »Präemptivschlägen« und – einer meiner Lieblingsausdrücke – »Sub-Holocaust-Engagement«. So ebnete ich mir den Weg zu langen, elaborierten Diskussionen, in denen ich eine Menge über technostrategische Rationalität und über Manipulierbarkeit erfuhr.
Aber je besser ich in diesem Diskurs wurde, desto schwieriger wurde es, meine eigenen Ideen und Werte auszudrücken. Denn die technostrategische Sprache schloß zwar Dinge, über die zu sprechen ich nie zuvor in der Lage war, ein, andere dafür aber radikal aus. Ein drastisches Beispiel: Das Wort »Frieden« kommt in diesem Diskurs nicht vor. Die weitestgehende Annäherung daran heißt »strategische Stabilität«, ein Begriff, der sich auf ein quantitatives und qualitatives Gleichgewicht bei den Waffensystemen bezieht – nicht auf die politischen, sozialen, ökonomischen und psychologischen Bedingungen, die »Frieden« meint. Hinzu kommt, daß man sich, wenn man das Wort »Frieden« ausspricht, sofort selbst das Etikett des tumben Aktivisten statt des ernstzunehmenden Professionellen anheftet. War ich schon unfähig, meine Bedenken in dieser Sprache auszudrücken, so war es noch störender, daß es mir zunehmend schwerer fiel, sie überhaupt in meinem eigenen Kopf zu behalten. Wie fest auch immer ich mir vorgenommen hatte, mir der hinter den Worten verborgenen blutigen Realität bewußt zu bleiben – ich merkte doch immer wieder, daß ich am Bezugspunkt »Menschenleben« nicht festhalten konnte. Ich konnte tagelang herumgehen und über Kernwaffen reden, ohne auch nur ein einziges Mal an die Menschen denken zu müssen, die von ihnen verbrannt werden würden.
Es ist überaus verlockend, dieses Problem einfach den Worten zuzuschreiben, den abstrakten Begriffen, den Euphemismen und den gesäuberten, freundlichen Abkürzungen mit ihrem Sex-Appeal. Dann nämlich bräuchte man einzig die Worte auszutauschen – gemäß dem Rezept: Man bringe die militärischen Planer dazu, statt »Begleitschaden« »Massenmord« zu sagen, und ihr Denken wird sich ändern. Das Problem ist aber nicht, daß die Sicherheitsstrategen sich durch den Gebrauch abstrakter Begriffe von der Realität entfernen. Es gibt keine Realität hinter den Worten, bzw. die Realität, von der sie reden, ist selbst eine Welt der Abstraktionen. Die Abschreckungstheorie – wie auch ein Großteil der strategischen Doktrin – wurde erfunden, um die eigene Logik abstrakt zusammenzuhalten, ihre Gültigkeit wird mit der eigenen Logik beurteilt. Diese abstrakten Systeme wurden entwickelt, um „das Undenkbare zu denken“ (Herman Kahn) – nicht, um Verhältnisse auf dem Boden der Tatsachen zu beschreiben und zu kodifizieren.
Der Bezugspunkt technostrategischen Denkens: Waffen
Die Idee eines »begrenzten Atomkrieges« beispielsweise ist nicht nur deshalb eine brutale Verzerrung, weil sie das Leiden und Sterben von Menschen, das durch jeden Einsatz von Atomwaffen verursacht wird, als »begrenzt« bezeichnet, oder weil der »begrenzte Atomkrieg« eine Abstraktion ist, die den Blick auf die hinter jedem Kernwaffeneinsatz liegende menschliche Realität verstellt. Das Problem ist auch, daß ein »begrenzter Atomkrieg« an sich ein abstraktes Konzept ist – von Computern entworfen, ausgestaltet und vervollkommnet.
In dieser abstrakten Begriffswelt sind die hypothetischen, ruhigen und rationalen Akteure so umfassend informiert, daß sie genau wissen, welches Kaliber von Kernwaffen der Gegner gegen welche Ziele eingesetzt hat. Sie verfügen über die adäquaten Befehls- und Kontrollmechanismen, um sicherzustellen, daß ihre Reaktion das exakte Gleichgewicht zum Angriff herstellt. Kein Frontkommandeur würde hier seine taktischen Atomwaffen auf dem Höhepunkt einer verlorenen Schlacht einsetzen. Unsere rationalen Akteure wären im Angriffsfall absolut frei von Emotionen und politischem Druck. Grundlage ihres Handelns wäre einzig und allein ein durch und durch perfektes mathematisches Kalkül, gemessen in Megatonnen. Vom begrenzten Atomkrieg zu sprechen, heißt deshalb, in einem System zu denken und zu handeln, das faktisch abstrakt und auf groteske Weise realitätsfern ist. Weil dieses Konzept so abstrakt ist, geht eine beschreibende Sprache völlig an der Sache vorbei.
Diese Erkenntnis half mir einerseits zu verstehen, warum ich solche Schwierigkeiten hatte, den Bezug zu konkreten Menschenleben aufrechtzuerhalten. Andererseits erklärte sie wenigstens zum Teil die bizarren und surrealen Äußerungen der Experten. Trotzdem begriff ich immer noch nicht alles. Wie etwa ist folgende Aussage zu verstehen: „Die strategische Stabilität des Regimes A beruht auf der Tatsache, daß beide Seiten zu keiner Zeit irgendeinen Anreiz zum Erstschlag haben. Da es ungefähr zwei Sprengköpfe erfordert, um ein feindliches Silo zu zerstören, muß ein Angreifer zwei Raketen aufwenden, um eine gegnerische zu zerstören. Ein Erstschlag entwaffnet den Angreifer. Der Angreifer steht am Ende schlechter da als der Angegriffene.“ 3
Das Heimatland des »Angegriffenen« ist gerade von – angenommen – 1000 Atombomben verwüstet worden, von denen jede höchstwahrscheinlich über die 10 bis 100fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe verfügt. Und der Angreifer, dessen Heimatland noch unversehrt ist, »steht am Ende schlechter da«?
Ich vermochte den Sinn dieses Gedankens erst zu erfassen, als ich mich schließlich fragte: Wer – oder was – ist hier das Subjekt? Im technostrategischen Diskurs bezieht sich alles auf die Waffen, nichts auf Menschen. Der Angreifer steht deshalb am Ende schlechter da als der Angegriffene, weil ihm weniger Waffen verbleiben; sonstige Faktoren – etwa die Frage: Was geschah dort, wo die Waffen abgeworfen wurden? – sind für die Gewinn- und Verlustrechnung ohne Bedeutung.
Die Tatsache, daß die Subjekte strategischer Paradigmen Waffen sind, hat einige wesentliche Folgen. Die erste und wohl wichtigste ist, daß es keine Möglichkeit gibt, den Tod von Menschen oder eine menschliche Gesellschaft zu diskutieren, solange man sich einer Sprache bedient, die einzig geschaffen wurde, um über Waffen zu sprechen. Der Tod von Menschen ist dann nichts weiter als ein »Begleitschaden« – Nebensache angesichts des eigentlichen Subjekts.
Als ich dies begriffen hatte, konnte ich mir auch erklären, was mich zunächst überrascht hatte: Die meisten Leute, die diese Arbeit verrichten, sind im großen und ganzen nette, ja, gütige Männer, viele sogar mit liberaler Gesinnung. Ihr Motiv, so argumentieren sie häufig, sei die Sorge um die Menschen. Aber im Laufe der Zeit eignen sie sich bei ihrer Arbeit eine Sprache und ein Denkschema an, in dem Menschen nichts mehr zu suchen haben. Und so kann das Wesen und Ergebnis ihrer Arbeit in tiefen Widerspruch zu ihren ursprünglichen Motiven geraten.
Hinzu kommt folgendes: Wenn Waffen den Bezugspunkt bilden, dann wirkt es fast schon unangemessen, zu verlangen, daß innerhalb des Paradigmas menschliche Belange zu berücksichtigen seien. Fragen, die die gefühllose Sprache strategischer Analyse durchbrechen, weil ihr Hauptinteresse den Menschen gilt, können leicht abgetan werden. Zwar wird niemand behaupten, sie seien unwichtig; aber für das anstehende Geschäft gelten sie nun einmal als laienhaft und deshalb als irrelevant. Der Diskurs der Experten ist hermetisch abgeschottet. Man kann über Waffen reden, die bestimmte Völker und deren »way of life« schützen sollen, ohne auch nur ein einziges Mal die Frage zu stellen, ob sie diese Schutzfunktion denn erfüllen können bzw. ob sie das beste Mittel dafür sind, oder ob es nicht gar sein könnte, daß diese Waffen all das zerstören, was sie schützen sollen. Das aber sind Fragen, die auf einem anderen Blatt stehen.
Dieser spezifische Diskurs ist bislang die einzige Antwort auf die Frage, wie Sicherheit zu erlangen sei, die als legitim anerkannt wird. Wäre das Thema »Waffen« nur eines unter vielen, die in diesem Zusammenhang diskutiert würden, oder eines, das mit anderen Themen verknüpft würde, dann fiele die Tatsache, daß strategische Paradigmen sich nur auf Waffen beziehen, nicht mehr so sehr ins Gewicht. Wenn wir aber sehen, daß denen, die sich für den Frieden engagieren wollen, von den Experten nur ein Fachwissen und eine Sprache offeriert werden, die sich ausschließlich auf Waffen beziehen, dann wird eine erschütternde Grenzziehung manifest: Es wird deutlich, welche Gefahr diese Sprache birgt, warum es – hat man sie sich einmal zu eigen gemacht – so schwer wird, das Primat der Menschlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Falle der Militärlogik
Innerhalb weniger Wochen war mir das, was ich zuvor bemerkenswert gefunden hatte, selbstverständlich geworden. Während des Lernens der Sprache veränderte sich meine Perspektive. Ich stand nicht mehr jenseits dieser undurchdringlichen Mauer aus technostrategischer Sprache, doch als ich zum Insider geworden war, war mir der Blick auf die Mauer verstellt. Ich hatte nicht nur gelernt, die Sprache zu sprechen: Ich hatte begonnen, in ihren Kategorien zu denken. Ihre Fragen wurden zu meinen Fragen, ihre Begrifflichkeit prägte meine Antworten auf neue Ideen. Wie die weiße Königin in Alice im Wunderland begann ich, vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge zu glauben. Nicht, daß ich überzeugt gewesen wäre, ein »chirurgisch sauberer Counterforce-Schlag« beispielsweise sei wirklich möglich. Aber irgendein Stück doktrinärer Logik, mit dem ich arbeitete, ging schon von der Möglichkeit solcher Schläge wie von einer ganzen Menge anderer unmöglicher Dinge aus.
Ich hatte das, was ich als Realität erkannte, offenbar nicht mehr im Griff. So konnte ich zum Beispiel eine neue strategische Rechtfertigung für einen Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen ungeheuer aufregend finden und lange darüber diskutieren, inwiefern dies für die Struktur der US-Streitkräfte in Westeuropa Vorteile gegenüber der bisherigen Politik brächte. Ein oder zwei Tage später hielt ich dann plötzlich inne und war entsetzt darüber, daß ich mich so stark mit der militärischen Rechtfertigung für den Nichteinsatz von Kernwaffen beschäftigt hatte – als ob die moralische nicht genügte. Das, wovon ich da eigentlich sprach, die Massenverbrennung von Millionen von Menschen durch einen atomaren Angriff, war meinem Denken entglitten.
Ein anderes Beispiel: Es kam vor, daß ich Vorschläge hörte, die mir – verglichen mit dem üblichen Rüstungskontroll-Diskurs – unendlich besser erschienen. Zunächst versuchte ich dann herauszuarbeiten, weshalb die Vorschläge besser waren; dann suchte ich nach Wegen, Gegenargumente zu parieren. Schließlich dämmerte mir, daß diese beiden Vorschläge zwar durchaus verschieden klangen, dennoch aber eine Menge an Voraussetzungen gemeinsam hatten, von denen auszugehen ich nicht bereit war. Zunächst gab mir dies das Gefühl, eine neue Erkenntnis gewonnen zu haben. Plötzlich jedoch ging mir auf, daß ich das alles eigentlich schon vor meinem Eintritt in die Gemeinde der Militär-Experten gewußt, doch dann vergessen hatte: Allmählich wurde mir klar, daß ich in eine Falle getappt war.
Die Notwendigkeit exakter Sprachanalysen
Seither sind meine Probleme mit der technostrategischen Sprache nicht verschwunden. Die Versuchung, das Erlernte auch anzuwenden, bleibt groß; doch in dem Maße wie der Spaß am Umgang mit ihr wächst, steigt zugleich auch ihre Gefährlichkeit. Der Versuch, Atomstrategen mit ihren eigenen Mitteln argumentativ zu bezwingen, verführt zum Denken innerhalb ihrer Regeln und zum stillschweigenden Akzeptieren der unausgesprochenen Voraussetzungen ihrer Denkmodelle.
Trotzdem ist das Sprachproblem für mich inzwischen in den Hintergrund getreten, weil sich an seine Stelle neue Fragen geschoben haben. Fragen, die zwar immer noch nicht die gleichen sind wie die eines Insiders, auf die ich aber nicht gekommen wäre, hätte ich mich nicht in ihren Kreisen bewegt. Viele sind eher praktischer Art: Welche Individuen und Institutionen sind eigentlich verantwortlich für die endlose »Modernisierung« und Weiterverbreitung von Kernwaffen, und was gewinnen sie dabei? Welche Rolle spielt die techno-strategische Logik in ihrem Denken? Wie sähe eine vernünftige, wirklich defensive Sicherheitspolitik aus? Andere sind eher philosophischer Natur, fragen danach, was für einen Begriff von »Realität« die Verteidigungsintellektuellen für sich in Anspruch nehmen und wie sich begründen läßt, daß dieser falsch ist. Wie sähe eine alternative Logik aus?
Daß sich mein Hauptinteresse von der Sprache ab, und anderen Problemen zugewandt hat, ist durchaus nicht untypisch. Andere Neulinge im Kosmos der militärischen Experten haben sich ähnlich geäußert: Die kaltblütigen, abstrakten Diskussionen hätten sie zunächst außerordentlich beeindruckt, das sei jedoch bald vergangen, und sie hätten bemerkt, daß die Sprache selbst nicht das Problem ist. Ich meine allerdings, es wäre ein Fehler, diese ersten Eindrücke einfach zu ignorieren. Zwar ist die Sprache nicht das eigentliche Problem, doch enthüllt sie eine ganze Reihe von in unserer Kultur begründeten und von ihr akzeptierten Mechanismen. Erst diese aber ermöglichen es, in Institutionen zu arbeiten, in denen man seinen Lebensunterhalt damit verdient, die Weiterverbreitung von Kernwaffen voranzutreiben und die Massenverbrennung von Millionen von Menschen zu planen: Eine abstrakte, saubere und beschönigende Sprache, die sexy ist und deren Gebrauch Spaß macht; ein Paradigma, dessen Bezugsgröße Waffen sind; eine Bildlichkeit, die die Massenvernichtung domestiziert und verniedlicht, die »fühllose« und »fühlende« Materie vertauscht, Tod mit Geburt, Zerstörung mit Schöpfung verwechselt. Mit alldem können die Benutzer dieser Sprache sich der Realität dessen, worüber sie sprechen und den Realitäten, die sie durch den Diskurs schaffen, radikal entziehen.
Eine exakte Sprachanalyse bietet gute Ansätze, die Legitimität zu erschüttern, mit der die Verteidigungsexperten den Diskurs über atomare Fragen beherrschen. Werden sie wegen der kaltblütigen Unmenschlichkeit der von ihnen geplanten Szenarien kritisiert, reagieren sie, indem sie sich hinter dem Hochaltar der Rationalität verschanzen. Kritiker des nuklearen Status quo werden als irrational, unrealistisch und zu emotional – kurz: als »idealistische Aktivisten« – abgestempelt. Doch wenngleich die glatte und glänzende Oberfläche des Diskurses, seine Abstraktheit und der technische Jargon ihre Behauptungen zu bestätigen scheinen: Ein Blick unter die Oberfläche fördert anderes zutage. Dort finden sich homoerotische Untertöne, heterosexuelle Herrschaftsgelüste, der Drang nach Kompetenz und Führerschaft, die Lust an der Zugehörigkeit zu einer privilegierten Gruppe und das Auskosten des Genusses, von höchster Wichtigkeit, gleichsam ein Glied in der Gemeinde der »Atompriester«, zu sein. Wie kann man in Menschen, die solche Werte und Erfahrungen verkörpern, Muster besonnener Objektivität sehen?
Die Mechanismen des Sich-Distanzierens und Dementierens sowie die emotionalen Untertöne in diesem betont männlichen Diskurs – all dies wird bereits deutlich, lauscht man der technostrategischen Sprache. Doch erst wenn man sie lernt, entdeckt man, wie abstrakt das eigene Denken werden kann, wie sich das Interesse auf isolierte Details verlagern und das Überleben von Waffen wichtiger werden lassen kann als das Überleben von Menschen.
Viele Gegner des gegenwärtigen atompolitischen Kurses entscheiden sich, diese Sprache zu erlernen, weil sie die Maßstäbe für die öffentliche Diskussion setzt. Selbst wenn sie Fachausdrücke für nicht sonderlich wichtig halten, glauben manche doch, die Sprache einfach deshalb beherrschen zu müssen, weil man ansonsten kaum Anerkennung bekommt. Aber wer sie lernt, verändert sich. Man erweitert nicht schlicht das eigene Wissen und Vokabular, sondern taucht in eine andere Denk-Weise ein, die nicht nur die Analyse von Kernwaffen, sondern auch die von militärischer und politischer Macht und schließlich die des Verhältnisses von menschlichem Zweck und technologischen Mitteln beeinflußt.
Sprache – kein neutrales Transportmittel für Informationen
Diese Sprache und dieses Denken sind keine neutralen Transportmittel für Informationen. Sie wurden zumeist von mathematisch oder ökonomisch geschulten Männern entwickelt, die es sich zum Zweck gesetzt hatten, rationelles Denken über den Einsatz von Kernwaffen zu ermöglichen. Daß eine auf diese Weise entstandene Sprache für etwas anderes als das Nachdenken über den Einsatz von Atomwaffen nicht besonders geeignet ist – wen wundert's?
Diejenigen, die das Kalkül der US-amerikanischen Atompolitik für hoffnungslos fehlgeleitet halten, befinden sich in einem besonders ernsten Dilemma: Weigern sie sich, die Sprache zu lernen, verurteilen sie sich selbst zum Hofnarren am Rande der Szene. Doch lernen und nutzen sie den Jargon, dann schränken sie nicht nur ihre Aussagekraft drastisch ein, sondern leisten überdies der Militarisierung des eigenen Denkens Vorschub.
Ich kann keine Lösung dieses Dilemmas anbieten, möchte dennoch mit dem Versuch schließen, unser Denken und vielleicht sogar das Problem selbst neu zu formulieren. Schlägt man die Strategie ein, die Sprache zu lernen, dann muß man sich über eines im Klaren sein: Wenn wir Außenseiter meinen, daß wir mit dem Erlernen und Sprechen dieser Sprache uns zu einer Stimme wandeln, die als legitim anerkannt wird, und wenn wir voraussetzen, daß wir so an politischem Einfluß gewinnen, dann setzen wir auch voraus, daß die Sprache selbst tatsächlich die Kriterien und Denkstrategien artikuliert, auf deren Grundlage Kernwaffen entwickelt und Stationierungsentscheidungen gefällt werden. Das ist zum Großteil Illusion. Ich gehe davon aus, daß dem technostrategischen Diskurs eher die Funktion von Tünche zukommt, die Funktion einer ideologischen Patina, die die wirklichen Gründe für solche Entscheidungen verdeckt. Statt Entscheidungen zu inspirieren und ihnen Gestalt zu geben, legitimiert er meist politische Ergebnisse, die aus gänzlich anderen Gründen zustandegekommen sind. Wenn das richtig ist, erheben sich ernste Zweifel hinsichtlich der Frage, wie groß der politische Nutzen wäre, den wir aus der Anwendung dieser Sprache ziehen könnten, und ob er jemals die potentiellen Probleme und Kosten aufzuwiegen vermag.
Wer auf der Suche nach einer gerechteren und friedlicheren Welt ist, hat – so denke ich – eine doppelte Aufgabe: Eine demontierende wie auch eine rekonstruierende, beide eng miteinander verknüpft. Den technostrategischen Diskurs zu demontieren, bedeutet, ihn aufmerksam zu beobachten und abzubauen. Die dominante Stimme militarisierter Männlichkeit und Zusammenhänge leugnender Rationalität spricht in unserer Kultur so laut, daß es für jede andere Stimme schwierig bleiben wird, gehört zu werden. Und zwar so lange, bis diese Stimme etwas von ihrer Macht verliert zu bestimmen, was wir hören und wie wir die Welt gestalten sollen.
Die zweite, rekonstruierende Aufgabe bedeutet, kreativ zu sein und überzeugende alternative Zukunftsentwürfe anzubieten, andere Vorstellungen von Rationalität zu entwickeln, vielfältige und phantasievolle alternative Stimmen zu schaffen – Stimmen, die im Gespräch miteinander neue Möglichkeiten von Zukunft erschaffen werden.
Der vorstehende Beitrag wurde während eines Forschungsaufenthalts von Carol Cohn am Center for Psychological Studies in the Nuclear Age in Cambridge Massachusettes verfasst. Vorstehende Analyse erschien zuerst im Bulletin of the Atomic Scientist, June 1987, p. 17–24, die erweiterte Fassung in: Signs. Journal of Women in Culture and Society 1987, vol. 12, no. 4; die Übersetzung fertigten Hedda Wagner (Frankfurt) und Sabine Lang (Berlin) an.
Anmerkungen
1 Hisako Matsubara, Cranes at Dusk (Garden City, New York: Dial Press, 1985) Zurück
2 Gen. Robert Rosenberg, „The Influence of Policy Making on C3I“, speaking at the Harvard Seminar, Command, Controll, Communications and Intelligence, p. 59 Zurück
3 Charles Krauthammer, Will Star Wars Kill Arms Control?, New Republic (Jan. 21, 1985),pp. 12 - 14 Zurück
Den -> ersten Teil veröffentlichten wir in der Ausgabe 5/88 des INFO's.