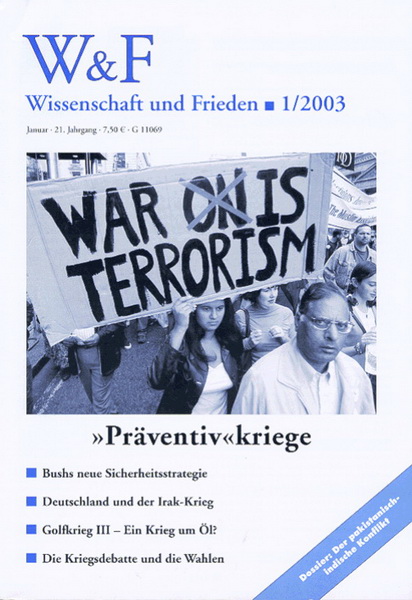Sind Kriegseinsätze Nebensache?
Über den Einfluss der »Kriegsdebatte« auf die Wahlen
von Dietmar Wittich
Es war eine Novität, und kaum jemand hat es bemerkt: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik befanden sich zu Wahlzeiten deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen, darunter auch in Kampfeinsätzen, und doch hat diese Tatsache im Wahlkampf keine – genauer sogar eine abnehmende – Rolle gespielt. Das Resultat scheint paradox. Obwohl der Anteil der Kriegsgegner in der deutschen Bevölkerung nicht gerade klein ist, endeten die Wahlen mit einem totalen Erfolg derer, die diese Kriegseinsätze politisch zu verantworten haben beziehungsweise ihnen zustimmen. Die einzige politische Kraft, die sich konsequent gegen den Einsatz militärischer Mittel bei internationalen Konflikten stellt, erlitt eine Niederlage, blieb deutlich unter fünf Prozent und ist nur noch mit zwei Einzelabgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten. Der Vorgang bedarf der Analyse.
Fünfzig Jahre haben die Deutschen darauf verzichtet, ihre Soldaten in anderer Herren Länder zu schicken. Nun wurde eine Wende von grundlegender Bedeutung vollzogen, mit dem »Krieg gegen den Terror« wurde eine Neuordnung der Welt in Angriff genommen, und Deutschland ist als Juniorpartner der USA mit dabei. Gäbe es in Deutschland darüber eine öffentliche Diskussion, würde sich sehr rasch zeigen: Die Wiederentdeckung des Krieges als Mittel deutscher Politik ist im Lande nicht unumstritten. Es ist zwar keine Mehrheit, aber es sind auch nicht wenige, die militärische Gewalt und deutsche Kriegsbeteiligung ablehnen. 40 bis 45 Prozent der Deutschen sind Kriegsgegner, aber ihre Positionen kommen in der veröffentlichten Meinung kaum vor.
Die unmittelbaren Reaktionen der Deutschen auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 waren Entsetzen über die unerwartete Grausamkeit, Ablehnung von Terror und Angst vor Terror sowie eine weitgehend einhellige und durch alle Lager gehende Solidarität mit den USA und ihrer Bevölkerung. Die internationale Sicherheit stieg zu einem der wichtigsten Problemfelder in der öffentlichen Wahrnehmung auf. Die von Gerhard Schröder verkündete »uneingeschränkte Solidarität« der Bundesrepublik konnte sich darauf stützen, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung sich für eine Unterstützung der USA durch Deutschland aussprachen. In den folgenden Tagen kündigte der US-Präsident Bush einen „monumentalen Kampf zwischen Gut und Böse“ an, und schon war die Rede vom „größten Militäreinsatz seit dem Zweiten Weltkrieg“. Die öffentliche Meinung in Deutschland reagierte darauf gespalten, eine knappe Hälfte war dafür, gegen Urheber und Hintermänner des Terrors mit militärischer Härte vorzugehen. Allerdings waren zugleich etwa 60 Prozent dagegen, dass dazu auch Bodentruppen eingesetzt werden sollten. Die Luftangriffe auf Afghanistan, die Anfang Oktober begannen, hielten knapp 80 Prozent der Deutschen für gerechtfertigt. Aber schon bald mischten sich Zweifel hinein, dass die USA nur militärische Ziele angriffen, darauf vertrauten nur 60 Prozent der Deutschen, 40 Prozent zweifelten daran, im Osten mehr als die Hälfte. Diese Tendenz verstärkte sich in den folgenden Tagen. Je länger sich die Luftangriffe hin zogen, desto weniger Deutsche hielten sie für einen sinnvollen Beitrag zu Bekämpfung des Terrorismus, die Relationen waren schließlich 53 zu 47, im Osten waren die Zweifel schon deutlich stärker.
Bereits Mitte Oktober wurde in den Medien darüber spekuliert, ob Bundeswehrtruppen bei den Kampfhandlungen in Afghanistan eingesetzt würden. Zu diesem Zeitpunkt waren nur knapp 40 Prozent der deutschen Bevölkerung für einen Bundeswehreinsatz, reichlich 60 Prozent waren dagegen, im Westen etwa 55 Prozent, im Osten mehr als drei Viertel. Als Anfang November die Entscheidung des Bundestages über einen solchen Einsatz tatsächlich anstand, gab es in der Bevölkerung insgesamt immer noch eine Mehrheit gegen den Einsatz der Bundeswehr, aber diese Mehrheit kam allein durch das Meinungsbild im Osten zustande, im Westen hielten sich Befürworter und Gegner von Bundeswehreinsätzen inzwischen die Waage.
Anfang März waren diese Einsätze knapp zwei Monate im Gange. Der Nachrichtenlage nach waren dort eingesetzte Bundeswehrangehörige mit Schutz- und Sicherheitsaufgaben betraut, über Verwicklungen in Kampfhandlungen wurde nichts bekannt. Entsprechend hatte sich das Meinungsbild in der deutschen Öffentlichkeit verändert. Nunmehr stimmten 58 Prozent der Deutschen den Einsätzen der Bundeswehr in Afghanistan zu und 42 Prozent lehnten sie ab, eine mehrheitliche Akzeptanz somit bei gleichzeitig recht starker Ablehnung. Zugleich hatte sich das Meinungsbild zwischen Ost und West stark auseinander entwickelt. Es stellte sich nahezu seitenverkehrt dar, im Westen stimmten knapp zwei Drittel den Einsätzen zu, im Osten lehnten sie ebenso viele ab. Einige Tage danach kam es zu den ersten toten und verwundeten deutschen Soldaten in Afghanistan. An den Relationen im Meinungsbild hatte sich jedoch wenig verändert, nunmehr stimmten noch 56 Prozent den Einsätzen zu, die Ablehnung war um 2 Prozent auf nunmehr 44 Prozent angewachsen. Die Befürwortung hatte in West und Ost abgenommen, aber die Relationen waren unverändert geblieben. In einem halben Jahr war somit die anfängliche leichte Mehrheit gegen Bundeswehreinsätze in Afghanistan in eine leichte Mehrheit von Befürwortern dieser Einsätze umgeschlagen.
Das war die Situation, bevor in Deutschland bekannt wurde, dass deutsche Soldaten auch an Kampfhandlungen beteiligt sind. Im Zusammenhang mit den ersten Toten und Verletzten im März sickerte an die Öffentlichkeit, dass etwa Hundert Angehörige des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr bei den Bodenkämpfen der Operation »Anaconda« mit im Einsatz waren. Diese Information über den Einsatz von Bundeswehrsoldaten bei Bodenkämpfen im Osten Afghanistans hatte eine deutliche, aber keine umwälzende Veränderung in der öffentlichen Meinung mit sich gebracht. Es war insgesamt eine sehr knappe Mehrheit von 51 Prozent der Deutschen, die den Einsatz der KSK-Soldaten richtig finden, 45 Prozent lehnten diesen Einsatz ab, 4 Prozent hatten sich dazu keine Meinung gebildet.
Insgesamt stellte sich damit das Meinungsbild in der Bundesrepublik auch zu Beginn des Wahlkampfes stabil dar. Während die politischen Eliten der Bundesrepublik Deutschland voll auf den Kurs setzen und ihn praktizieren, dass die Bundeswehr sich beteiligt am »Krieg gegen den Terrorismus«, der ein Krieg für eine neue Weltordnung ist, können sie sich dabei in der Bevölkerung nur auf eine sehr dürftige Mehrheit stützen. Mit zwischen 40 und 45 Prozent haben die Gegner von Militäreinsätzen gleichfalls starke Positionen. Skepsis in dieser Frage ist und bleibt in Deutschland sehr verbreitet.
Bemerkenswert ist, dass es bis zum Wahltag insgesamt bei diesen Relationen geblieben ist, es hat nicht etwa einen Umschwung im Meinungsbild zu dieser Frage gegeben, wie sich anhand empirischer Analysen vom September belegen lässt.
Fast drei Viertel der Deutschen hielten es für richtig, dass allein die UNO Maßnahmen für die Sicherung von Frieden und Menschenrechten ergreifen kann. Lediglich 23 Prozent hielten das nicht für richtig. Knapp 3 Prozent haben die Frage nicht beantwortet. Die Meinungsbilder in West und Ost waren dabei nahezu identisch. Im Kontext der Fragestellung bedeutet das, dass nach Mehrheitsauffassung die Legitimierung durch die UNO die Voraussetzung ist für die Beteiligung einzelner Länder.
Wie stand es nun mit der Legitimation, dass die westlichen Zivilisationen für die Sicherung von Frieden und Menschenrechten eine besondere Verantwortung hätten und deshalb zu militärischen Operationen berechtigt wären?
Die Meinungen dazu waren deutlich gespalten. 48 Prozent hielten diese Argumentation für richtig und sahen damit die USA und die Nato zu entsprechendem Eingreifen legitimiert. Aber fast ebenso viele, nämlich 47 Prozent, hielten das nicht für richtig. Die entsprechende Argumentation, die bereits bei dem Krieg gegen Jugoslawien 1999 eingesetzt worden war, und die entsprechende politische Praxis hatten also nach wie vor keine Mehrheit in der Bevölkerung. Die politische Gegenposition kann auf einen erheblichen Rückhalt in der Öffentlichkeit verweisen. Zugleich waren erhebliche Unterschiede im Meinungsbild zwischen West und Ost erkennbar. Im Westen waren 51 Prozent für eine besondere Verantwortung der westlichen Länder, immerhin 43 Prozent erklärten sich dagegen. Im Osten sprach sich mit 61 Prozent eine deutliche Mehrheit dagegen aus, Zustimmung äußerten nur 37 Prozent.
Auch bezüglich einer Beteiligung Deutschlands waren die Meinungen geteilt. Allerdings waren die Relationen etwas anders. Insgesamt hielt eine knappe Mehrheit von 54 Prozent die Auffassung für richtig, dass zur Durchsetzung von Frieden und Menschenrechten Deutschland sich mit seinen Verbündeten an Kriegseinsätzen beteiligen könne. 42 Prozent waren es, die das nicht für richtig hielten. Die große parlamentarische Mehrheit, die entsprechende politische Entscheidungen getragen hat und trägt, kann sich also nur auf eine schmale Zustimmung in der Bevölkerung in dieser Frage stützen. Politische Gegenpositionen haben somit gleichfalls eine starke Unterstützung.
Bezüglich der allgemeinen Frage, ob militärische Mittel überhaupt zur Lösung internationaler Konflikte und zur Durchsetzung von Menschenrechten geeignet sind, erwies sich das Meinungsbild als gespalten. 48 Prozent hielten generell militärische Mittel für nicht geeignet, 47,4 Prozent vertraten die gegenteilige Position, knapp 5 Prozent hatten dazu keine Meinung geäußert. Der West-Ost-Unterschied war deutlich. Im Westen schlossen sich 46 Prozent der Meinung an, dass militärische Mittel ungeeignet sind, im Osten waren 54 Prozent dieser Meinung. Im Westen waren 49 Prozent gegen diese Meinung, im Osten waren das nur 41 Prozent.
Die Analyse unter politischen Aspekten offenbarte allerdings Widersprüche. Zwar zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den Anhängerschaften der einzelnen Parteien. Am häufigsten wurde die Meinung, dass diese Mittel dafür ungeeignet sind, in den Wählerschaften der Grünen (62 Prozent) und der PDS (60 Prozent) geteilt. Aber auch bei der SPD (55 Prozent) und der FDP (52 Prozent) waren leichte Mehrheiten dieser Meinung. Bei der CDU standen immerhin auch 42 Prozent auf dieser Position. Auch bei den Unentschlossenen und den Nichtwählern waren diese Anteile beachtlich. Das heißt aber zugleich, dass die Differenz zwischen Meinungen erheblicher Teile der Wählerschaft und den Positionen und politischen Entscheidungen der Parteien unmittelbar vor den Wahlen keinen hinreichenden Grund bildete, diese Parteien nicht zu wählen. Und am Wahltag selbst zeigte sich, dass diese Frage für zuvor Unentschlossene letztlich auch nicht wahlentscheidend war.
Ähnlich gespalten waren die Meinungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, also zur direkten Beteiligung des deutschen Staates, in dem Wahlen anstanden, am Einsatz eben dieser militärischen Mittel.
Zu diesem Zeitpunkt war die schon oft gemessene leichte Mehrheit von 55 Prozent der Meinung, dass die Bundeswehr diese Einsätze weiter wahrnehmen sollte. Insgesamt 45 stimmten dieser Aussage nicht zu. Umgekehrt stellen sich die Relationen bezüglich eines vollständigen Rückzuges der Bundeswehr, hier stimmten reichlich 44 Prozent für und reichlich 55 Prozent gegen den Rückzug. Anders waren die Relationen in den Meinungen zum Einsatz von schwerem Gerät (Spürpanzer, Kriegsschiffe) und Kampftruppen (Kommando Spezialkräfte). Für deren Rückzug gab es eine leichte Mehrheit von 57 Prozent.
Während US-Regierung eine Ausweitung des »Krieges gegen den Terrorismus« auf den Irak schon seit Monaten ankündigte, stieß das von Beginn an auf eine breite Ablehnung. Bereits im Frühjahr waren etwa drei Viertel der Deutschen dagegen. Im August forcierte George W. Bush jun. seine Ankündigungen von Kriegsoperationen. Nach einigem Zögern erklärte der Bundeskanzler für die Regierung, dass sich Deutschland nicht daran beteiligen werde. Das entsprach dem Meinungsbild in der deutschen Öffentlichkeit. Seit Anfang August war beobachtet worden, dass sich weiterhin knapp drei Viertel der Deutschen sowohl gegen die Ausweitung wie gegen eine deutsche Beteiligung daran aussprachen. Es waren fast zwei Drittel, die der ablehnenden Haltung der Bundesregierung zustimmten, im Westen geringfügig weniger, im Osten etwas mehr. Für falsch hielt weniger als ein Drittel die Haltung der Bundesregierung. Anfang September waren es mit über 70 Prozent noch mehr, die der Haltung der Regierung zustimmen, und nur noch ein Viertel hielt sie für falsch.
Auch in dieser Frage zeigten sich Widersprüche. Nur 38 Prozent der Deutschen hielten diese Aussagen für glaubhaft. 58 Prozent hielten sie nicht für glaubhaft und sahen sie im Zusammenhang mit Wahlkampftaktik. Im Osten war dabei die Skepsis noch deutlich stärker als im Westen. Insgesamt war damit zu konstatieren, dass eine große Mehrheit in Deutschland eine Ausweitung des Krieges auf den Irak und eine Beteiligung Deutschlands daran ablehnt. Damit übereinstimmende Aussagen der Bundesregierung finden eine entsprechend breite Zustimmung, die allerdings von einer verbreiteten Skepsis begleitet wird.
Aber entscheidend war – und das blieb bis zu den Wahlen so –, dass mit dieser Erklärung der damals amtierenden Bundesregierung gegen eine deutsche Beteiligung an einem Krieg gegen den Irak das Friedensthema erfolgreich an den Rand gedrängt wurde und aus den öffentlichen politischen Auseinandersetzungen verschwand. Insgesamt war die Stimmungslage in der Gesellschaft in den Wochen vor den Wahlen widersprüchlich. In der Problemwahrnehmung hatten Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Situation deutliche Priorität, andere Problemkomplexe erschienen diesen gegenüber deutlich nachgeordnet. Das betraf neben solchen Problemen wie Bildung und sozialen Ungerechtigkeit eben gerade auch die Fragen der internationalen Sicherheit und der Einsätze militärischer Mittel. Noch ein Jahr zuvor hatte dieses Thema für eine Mehrheit der Deutschen Priorität, jetzt wurde es kaum noch als bedeutsam angesehen. Der SPD und den Grünen, in deren Umfeldern große Anteile von Kriegsgegnern sind, ist es in diesem Zusammenhang gelungen, zuvor drohende Abwanderungen von Wählerinnen und Wählern zu vermeiden.
Die Unzufriedenheit mit der Politik auf Bundesebene war groß im Wahljahr in der Gesellschaft der Deutschen. Entsprechend war die Akzeptanz der rosa-grünen Regierungsparteien relativ niedrig und wurde vom Zuspruch zu den schwarz-gelben Oppositionsparteien übertroffen. Auch die PDS schien davon zu profitieren, vor allem ihr konsequentes Eintreten gegen Krieg und Kriegseinsätze deutscher Soldaten hatte ihr im Laufe des letzten Jahres einen Akzeptanzgewinn gebracht. So war es, bis das Hochwasser kam. Als es abgeflossen war, war die Unzufriedenheit im Lande nicht geringer, aber der Vorsprung der Oppositionsparteien war dahin. Am Ende – im Ergebnis der Wahlen – waren die alten Regierungsparteien auch wieder die neuen, die Konservativen und die Liberalen hatten sich stabilisiert, konnten aber eine Mehrheit nicht erreichen. Die Linkssozialisten blieben deutlich unter 5 Prozent und sind im Parlament nur durch zwei direkt gewählte, fraktionslose Abgeordnete vertreten.
Zweifellos ist es so, dass die Relativierung der Krieg-Frieden-Problematik mit Nachteilen für die PDS verbunden war. Allerdings muss sie sich auch die Frage gefallen lassen, warum sie nicht entschiedener für dieses für sie profilbestimmende Thema gekämpft hat. Gleichzeitig können die Gründe ihrer Niederlage nicht auf das Thema Krieg-Frieden reduziert werden. Für die PDS gibt es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Schritt von Gregor Gysi und einen deutlichen Akzeptanzverlust in der Öffentlichkeit. Dessen Rücktritt wirkte gleichsam als Initialzündung für den Niedergang der PDS. Dass es bis zu den Wahlen dabei, blieb hängt zum einen mit Prioritäten in der Stimmungslage und sicher auch mit dem Lagerwahlkampf zusammen, der die PDS an den Rand drückte, aber zum anderen auch mit der Wahrnehmung ihrer politischen Substanz. Der PDS wurden in den letzten Wochen vor den Wahlen nur in sehr geringem Umfang Kompetenzen zugeschrieben, und auch ihr Personal wurde wenig wahrgenommen.
Auch ist die Tatsache, dass die PDS an die Regierungsparteien Wähler verlor – an die SPD im Osten, an die Grünen im Westen, kein Beleg dafür, dass die Antikriegs-Aussagen ausschlaggebend waren. Das zeigt ein Blick auf die Wählerwanderungen: 1998 hatte die PDS ein positives Wanderungssoldo zu den anderen Bundestagsparteien, nur zu den sonstigen Parteien gab es einen Verlust. Bei den Wahlen vom 22. September 2002 hat die PDS nahezu durchweg Verluste zu verzeichnen.
Zu den Parteien gibt es die größten Verluste der PDS gegenüber der SPD, 1998 hatte sie noch einen Wanderungsgewinn von 80 Tausend, jetzt ist es ein Verlust von 290 Tausend. Auch von der CDU gab es 1998 noch einen Wanderungsgewinn von 90 Tausend, jetzt wurden an sie 50 Tausend verloren. Selbst an die FDP, von der 1998 noch 10 Tausend gewonnen worden waren, gibt es jetzt einen Verlust von 20 Tausend. Gegenüber den Grünen, von denen es 1998 noch einen Gewinn von 40 Tausend gegeben hatte, ist das Saldo diesmal ausgeglichen. An die sonstigen Parteien waren 1998 noch im Saldo 50 Tausend verloren worden, 2002 gibt es einen Gewinn von 20 Tausend.
Die PDS hat vor allem Wähler verloren bei jungen Leuten (sie hat den niedrigsten Erstwähleranteil aller Parteien, selbst die sonstigen Parteien liegen insgesamt darüber), bei in Ausbildung befindlichen, besonders bei jungen Frauen, bei höher Gebildeten, bei Angestellten generell, bei Selbstständigen, bei Arbeitslosen und bei Menschen ohne kirchliche Bindung. Man kann daraus schlussfolgern, dass sich damit Entwicklungen der letzten Jahre, in denen es der PDS zu gelingen schien, in die jungen, dynamischen und kreativen Potenziale der Gesellschaft vorzudringen, wieder umgekehrt haben. Dies sind allerdings zugleich Gruppen, in denen die Ablehnung von Krieg und deutscher Kriegsbeteiligung besonders stark ist.
Objektiv existiert in der Gesellschaft eine Gemengelage ungelöster Probleme und Konflikte. Die Einsätze deutscher Soldaten in Afghanistan, am Horn von Afrika, auf dem Balkan und anderswo gehören dazu. An dieser Gemengelage haben die Wahlen nichts verändert. SPD und Grüne haben die Wahlen kaum deshalb gewonnen, weil ihnen die Lösung der Probleme zugetraut wird, sondern weil Mehrheiten glauben, dass sich eine solche Regierung mit etwas größerer Behutsamkeit zu ihnen verhalten wird. Schon jetzt wird deutlich, dass die im Amt bestätigte Bundesregierung in ihrer Ablehnung einer Ausweitung des »Krieges gegen den Terrorismus« nicht sehr konsequent ist, die Differenz zur US-Regierung ist eher taktischer Natur. Für eine wirklich sozial orientierte Reformpolitik und als parlamentarische Stimme für die etwa 30 Millionen Kriegsgegner in Deutschland wäre eine linke Opposition wichtig gewesen.
Dietmar Wittich ist Soziologe in Berlin, Mitglied der Redaktion von »Utopie kreativ«, Forschungen und Publikationen zu politischer Soziologie und Ungleichheitsforschung, zuletzt: Wahlzeiten, Kriegszeiten, andere Zeiten, Hamburg 2001.