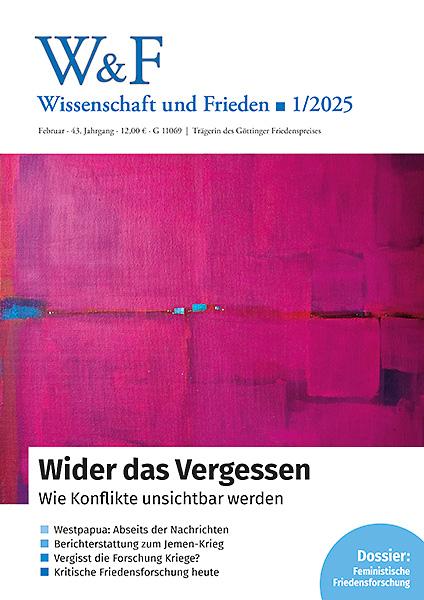Florian Kiebel (2024): The Accountability and Legitimacy of the Wagner Group. An Analysis Based on Critical Security Theory. Baden-Baden: Nomos. ISBN 978-3-6890-0149-0, 140 S., 39 €.
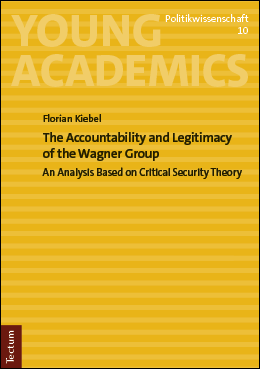
Private Militärfirmen profitieren von Kriegen und Konflikten. Derzeit verfolgt vor allem Russland, durchaus erfolgreich, mit ihnen in Afrika eine »Söldner-Diplomatie«. Diese Firmen operieren in einer rechtlichen Grauzone und untergraben häufig das staatliche Gewaltmonopol. Das Völkerrecht hat nur bedingt Geltung für sie, weil sie weder als Soldat*innen noch als Zivilist*innen nach der Genfer Konvention eingestuft sind.
Viele dieser Firmen haben zu Recht einen schlechten Ruf, weil man sie oftmals als skandalträchtig und schießwütig erlebt hat – man denke nur an die Beispiele der Wagner-Gruppe in der Ukraine, die Gefängnisinsassen als Kanonenfutter benutzte, oder vor zwanzig Jahren den Fall der amerikanischen Firma »CACI Systems« und ihre Rolle bei den berüchtigten Verhören von Gefangenen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib.
Der Einsatz privater Dienstleister und Kampftruppen außerhalb der staatlichen Streitkräfte ist nicht neu und die Motive für den Einsatz der Privaten sind sehr vielfältig. Ihre Aktivitäten wurden in der wissenschaftlichen und politischen Debatte ab Anfang der 2000er Jahre gut aufgearbeitet. Das heutige Russland hat aus den Erfahrungen der USA und anderer Länder gelernt und setzt seit den 2010er Jahren gezielt derartige Firmen ein. Schlagzeilen machte dabei vor allem die Wagner-Gruppe im Ukrainekrieg. Aber auch deren Rolle in Afrika ist von Bedeutung. In vielen afrikanischen Ländern, in denen sich in den letzten Jahren Militärs an die Macht putschten, ist Russland mittlerweile mit Wagner-Truppen und anderen privaten Militärfirmen aktiv.
Das Wagner-Geflecht ist in Russland nur die Spitze des Eisbergs. Es existieren schätzungsweise 30 größere Militärfirmen, auf die die russische Regierung zunehmend zurückgreift, zumeist außerhalb Russlands. Nachdem einzelne Firmen zu mächtig zu werden drohten, versuchte das Verteidigungsministerium in den letzten Jahren, die Kontrolle über die Firmen wieder zurückzugewinnen. Mit der Umstrukturierung will man die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Den gescheiterten Marsch auf Moskau 2023 verstand das Establishment der Streitkräfte zu Recht als Herausforderung. Deshalb werden die Firmen jetzt eindeutig der außenpolitischen Ideologie untergeordnet. Diese Art »Söldner-Diplomatie« ist also eine Kombination aus Profitgier der Firmen, die Krieg als Geschäft betrachten, und der ideologischen Agenda des russischen Staates.
Die hier besprochene Arbeit von Florian Kiebel hat für die Erforschung dieser privaten militärischen Akteure zwei Ziele: Erstens will der Autor möglichst präzise Daten über die Wagner-Gruppe zusammenzutragen. Damit erweitert er den Wissensstand über diesen Privatakteur, sind doch immer noch viele Dinge unbekannt. Gut aufgearbeitet sind in diesem Band die Wagner-Einsätze in Syrien sowie in diversen afrikanischen Ländern. Zweitens fragt er nach der im Titel genannten »accountability and legitimacy« der Wagner-Gruppe, im Deutschen etwas umständlich mit Rechenschaftspflicht und Legitimität übersetzt. Dieser zweite Aspekt ist die gut gelungene Innovation dieses schmalen Bändchens.
Nach einer ausführlichen Diskussion kritischer Sicherheitsstudien der 1990er Jahre wendet sich der Autor seinem eigentlichen Anliegen zu und erklärt, wie das Konzept der »accountability and legitimacy« auf private Militärfirmen und konkret auf die Wagner-Gruppe anzuwenden ist. Dieser Ansatz klingt zunächst sehr theoretisch, denn private Militärfirmen zur Unterstützung der Streitkräfte oder gar bei Kampfhandlungen einzusetzen, ist geradezu eine ausgeklügelte Strategie von Regierungen, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen und in einer rechtlichen Grauzone zu operieren. Im Zweifelsfall können sie behaupten, wie dies Wladimir Putin lange mit Bezug auf die Wagner-Kämpfer tat, nichts mit deren Aktivitäten zu tun zu haben.
Im zentralen Teil der Veröffentlichung analysiert der Autor die Beziehungen der Wagner-Truppen auf drei verschiedenen Ebenen. Erstens zu den jeweiligen »territorialen Staaten«, in denen sie operieren: vor allem im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, in Mosambik und in Mali. Weiterhin wird das Verhältnis zum russischen Staat untersucht (speziell mit dem Fokus der Wagner-Einsätze in der Ukraine) und schließlich auf der internationalen Ebene. Die Ergebnisse sind ernüchternd.
Zwar gibt es ausreichend rechtliche Möglichkeiten, private Militärfirmen zur Verantwortung zu ziehen, aber meistens operieren diese Firmen in Ländern, in denen die Rechtsstaatlichkeit viel zu wünschen übriglässt. Es fehlt der politische Wille, die Firmen juristisch zu belangen.
Auf der Ebene des russischen Staates war kaum zu erwarten, dass die Firma Wagner, ihre Führung oder auch die Kombattanten für Kriegsverbrechen in der Ostukraine zur Rechenschaft gezogen würden. Schon die Tatsache, dass vom Kreml lange Zeit der Einsatz privater Militärfirmen rundheraus geleugnet wurde, ließ erkennen, dass die russische Regierung nicht an einer Aufarbeitung von Fehlverhalten oder Verbrechen interessiert war. Erst als der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, seine Truppen in Richtung Moskau marschieren ließ und damit die Autorität des Verteidigungsministeriums und des Kremls infrage stellte, reagierte man seitens der Regierung. Bekanntlich kam Prigoschin bei einem dubiosen Flugzeugabsturz ums Leben und »Wagner« wurde mit seinen Einsätzen in Afrika zum »Africa Corps« umetikettiert und unter die Kontrolle des Verteidigungsministeriums gestellt.
Für die internationale Ebene konstatiert Kiebel, dass im Prinzip zwar der Internationale Strafgerichtshof private Militärfirmen und ihre Mitarbeiter*innen bei schwerwiegenden Verbrechen zur Rechenschaft ziehen könnte, aber die Analyse zeigt die engen „Grenzen der internationalen Gemeinschaft (…). Bis jetzt ist kein Contractor zu einem Prozess in Den Haag geschickt worden.“ (S. 106) Interessant und innovativ ist, dass der Autor die rechtlichen Möglichkeiten und deren praktische Grenzen für alle drei Ebenen sorgfältig durchdekliniert.
Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, Firmen zur Verantwortung zu ziehen, Strafanzeigen zu erlassen, welche Herausforderungen und welche Hürden existieren, solide und effektive rechtliche Grundlagen zu schaffen, wird durch Kiebels Arbeit sehr klar. Wer immer auch sich mit dem Graubereich beschäftigt, in dem private Militärfirmen operieren, wer immer sich mit den staatlichen und internationalen rechtlichen Möglichkeiten zur Kontrolle dieser Firmen beschäftigt, sollte diese Arbeit zur Kenntnis nehmen.
Herbert Wulf