Re-Rezension
William J. Lederer, Eugene Burdick (1958): The Ugly American. New York: W. W. Norton & Company. (Deutsche Ausgabe: Ebd. (1966): Der häßliche Amerikaner. Hamburg: rororo Taschenbuch). 150 S., deutsche Ausgabe: Preise antiquarisch, englische Ausgabe: 15,95 $.
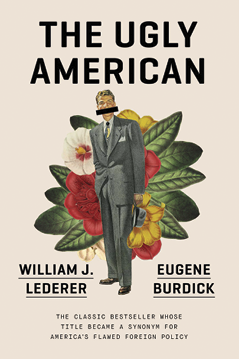
Das prägende Merkmal der aktuellen US-Außenpolitik ist die Geltungssucht der USA und die damit einhergehende Rücksichtslosigkeit, ja sogar Feindseligkeit gegenüber anderen Ländern. Während der Anspruch, die Welt zu dominieren oder zumindest die Spielregeln zu diktieren, schon lange ein Kennzeichen der amerikanischen Politik war, ist die unverhohlene Arroganz neu, mit der die Trump-Regierung diesen Dominanzanspruch durchzusetzen versucht.
Die globale militärische, wirtschaftliche und kulturelle Vorherrschaft der USA (das »amerikanische Jahrhundert«) erreichte in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Höhepunkt. In dieser Zeit, zu Beginn des Kalten Krieges, zeigte die US-Außenpolitik gegenüber neuen unabhängigen Staaten oft eine koloniale Haltung und es mangelte an Verständnis und Respekt für deren unterschiedliche Kulturen und Normen. In ihrem Bestseller von 1958, »The Ugly American«, analysierten die beiden amerikanischen Autoren William J. Lederer und Eugene Burdick – beide mit langjähriger Erfahrung im US-Militär und in der Außenpolitik – dieses Verhalten mit erstaunlicher Klarheit und Präzision. Buchrezensionen zielen in der Regel auf Neuerscheinungen ab. Um die Parallelen und Unterschiede zwischen der damaligen und der heutigen Außenpolitik besser zu verstehen, lohnt die (abermalige) Lektüre dieses Klassikers, der vor einem dreiviertel Jahrhundert erschien.
Das Buch war damals für das politische Establishment in den USA ein Schock. Die Autoren, die ihre kritische Analyse in Form eines Romans präsentierten, die allerdings auf realen Ereignissen amerikanischer Aktivitäten in Südostasien basierte, wollten damit die US-Außenpolitik beeinflussen. Es ist eine Enthüllung über die Arroganz, Inkompetenz und Korruption – einschließlich des Rassismus –, mit denen die USA zu Beginn des Kalten Kriegs ihren globalen Einfluss ausbauen und sichern wollten. Der Roman beleuchtet auch das persönliche Verhalten von Mitarbeiter*innen des Außenministeriums: ihr Streben nach persönlichem Profit, ihre herablassende Haltung gegenüber einheimischem Personal und Partnern sowie ihren Wunsch, nach amerikanischen Standards zu leben oder in einer amerikanischen Blase, egal wo auf der Welt. Das Fehlverhalten der amerikanischen Diplomat*innen stand im krassen Gegensatz zu Homer Atkins, dem Protagonisten des Buches von Lederer und Burdick, der die Probleme und Anliegen der Einheimischen verstand und vor Ort praktische Projekte zur Verbesserung ihrer Lebenssituation umsetzte.
Die beiden Autoren deckten die Schwächen amerikanischer Macht und Versuche zur Einflussnahme in dem fiktiven südostasiatischen Land Sarkhan auf, indem sie sowohl erfolgreiche als auch gescheiterte Projekte als Beispiele heranzogen. Das Buch ist auch heute noch hochaktuell, da kulturelle Insensibilität, die Missachtung internationaler Normen und erzwungene Kooperation nach wie vor Kennzeichen der US-Außenpolitik sind. Ende der 1950er-Jahre hatte das Buch erheblichen politischen Einfluss. Angeblich las auch Präsident Dwight D. Eisenhower das Buch, und die Idee von Präsident John F. Kennedy zur Gründung des »Peace Corps«, das 1961 vom US-Kongress ins Leben gerufen wurde, soll maßgeblich von den Erkenntnissen aus »Der häßliche Amerikaner« geprägt worden sein. Interessanterweise existiert das Peace Corps im Gegensatz zur mittlerweile aufgelösten USAID noch heute. Seit den frühen 1960er Jahren haben mehr als 240.000 junge US-Amerikaner*innen in über 140 Ländern mitgearbeitet. Dadurch ist ein Kreis von kulturell sensiblen und hilfsbereiten jungen Menschen entstanden.
Doch der »häßliche Amerikaner« kommt zurück: DOGE, das »Department of Government Efficiency« unter der ursprünglichen Leitung von Elon Musk, ist ein Paradebeispiel dafür, wie wenig Rücksicht die Regierung heute auf die Realität in der Welt nimmt und wie sehr sie auf die Interessen Amerikas fokussiert ist. Das Peace Corps betont auf seiner Website nach wie vor, dass es auf »Diversität« setzt und einem globalen Ansatz verpflichtet ist. Dies ist angesichts der aktuellen ideologischen Kampagne gegen Diversität und der »America First«-Politik überraschend. Doch wie lange wird dies noch die Mission des Peace Corps sein (können)?
Zwischen der Zeit, in der »Der häßliche Amerikaner« spielt, und der heutigen US-Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik bestehen deutliche Parallelen, aber auch Unterschiede. Wie die Figuren und Ereignisse im Roman legen auch die Vertreter*innen der Trump-Regierung oft Arroganz und ein mangelndes Verständnis für die Gegebenheiten anderer Länder an den Tag. In den 1960er Jahren lag das Problem in der mangelnden Sensibilität und dem Unwissen der US-Vertreter*innen vor Ort und in der Bürokratie; heute sitzt der »häßliche Amerikaner« an der Spitze, und die problematische Politik findet von oben herab per Dekret wider besseres Wissen statt.
Damals wurden kritische Stimmen in Washington gehört, und man versuchte, das Bild des unhöflichen und rücksichtslosen »Gringo« zu korrigieren, indem man eine regelbasierte Außenpolitik zu verfolgen suchte. Heute sind erpresserische Maßnahmen unter dem Motto »America First« zur offiziellen Staatsideologie geworden. Trumps »Make America Great Again«-Bewegung (MAGA) ist offen nationalistisch und chauvinistisch. Damals lag der Fokus darauf, das Vertrauen und die Sympathien („the hearts and minds“) der Menschen in anderen Ländern zu gewinnen. Obwohl dies oft misslang (insbesondere in Vietnam, dem Schauplatz der Handlung dieses Romans), strebte die offizielle Politik zumindest an, das negative Image der USA zu verbessern. Einer der Botschafter im Roman, Louis Sears, bittet seinen Vorgesetzten im Außenministerium, ihm Mitarbeiter zu schicken, auf die er stolz sein kann.
Heute ist der Ansatz völlig anders. Trumps Politik gegenüber Einwanderer*innen unterstreicht die fremdenfeindliche Haltung, ebenso wie seine Drohgebärden gegenüber anderen Regierungen (z. B. Kanada, Grönland und Panama) und seine militärischen Aktionen (z. B. gegen Iran und nun gegen Venezuela), seine respektlose Behandlung anderer Staatschefs (z. B. von Präsident Wolodymyr Selenskyj), die Verbreitung wissenschaftlich widerlegter Falschinformationen zu Klima- und Gesundheitspolitik, sein Rückzug aus internationalen Abkommen und multilateralen Institutionen sowie seine wirtschaftsschädlichen und willkürlichen Zölle. Gäste im Weißen Haus werden kritisiert, diskriminiert, belehrt und beleidigt – alles vor laufenden Kameras. Der Präsident verhält sich wie ein Sultan, umgeben von Claqueuren und Hofnarren, von Schmeichler*innen und Ideolog*innen.
Nur amerikanische Interessen zählen. Ob es sich dabei tatsächlich um echte amerikanische Interessen handelt, ist fraglich. Doch sie werden unerbittlich und konfrontativ durchgesetzt. Das Bild des »häßlichen Amerikaners« symbolisierte vor allem den moralischen Niedergang der US-Außenpolitik, das Unwissen und den Mangel an Empathie. Die Trump-Regierung bemüht sich erst gar nicht, als wohlwollende Hegemonialmacht wahrgenommen zu werden. Viele Regierungen, einige US-Medien, Tech-Konzerne, Richter*innen und Universitäten dulden, teils zähneknirschend, das undiplomatische Verhalten der Regierung, die öffentlichen Beleidigungen und die peinliche Selbstdarstellung des Präsidenten, weil sie Vergeltung und Repressalien, wie beispielsweise Arbeitsplatzverlust oder systematische Diskriminierung, fürchten. Trump scheint kein Problem damit zu haben, als »häßlicher Amerikaner« gesehen zu werden. Er verfolgt seine narzisstische Politik der Verunsicherung und Erpressung, eine Art »mad man«-Theorie, solange ihn genügend Staats- und Regierungschef (von Wladimir Putin bis Kim Jong-un, von Narendra Modi bis Mark Rutte) als »Freund« bezeichnen oder ihn gar für den Friedensnobelpreis nominieren.
In einem auf Fakten basierenden Epilog betonen die beiden Autoren des Romans, dass es sich zwar um ein fiktives Land handelt, die beschriebenen Ereignisse – von denen einige tragisch waren – aber tatsächlich stattgefunden haben. „Allzu oft kommt es zu solchen Ereignissen“, schreiben Lederer und Burdick. „Wir sind überzeugt, dass sich, wenn solche Dinge weiterhin geschehen, ein Muster von Katastrophen abzeichnet.“ (S. 254) Daher ist das Buch auch heute noch lesenswert.
Das Thema der kulturellen Aneignung, das das Verständnis und die Wertschätzung anderer Kulturen verfälscht oder gar ausnutzt, war in den 1950er und 1960er Jahren noch kein Thema. Das Buch wurde aus der Perspektive des Kalten Krieges geschrieben, ohne die ideologische Auseinandersetzung zwischen den beiden Blöcken kritisch zu hinterfragen. Es gab nur »die Guten« und »die Bösen«. Einige der beschriebenen Erfolgsgeschichten, insbesondere im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, erscheinen aus heutiger Sicht und angesichts der Erfahrungen aus Jahrzehnten der Entwicklungshilfe etwas naiv. Dennoch sind bescheidener und respektvoller Umgang mit anderen Kulturen sowie die Anerkennung der Rechtsstaatlichkeit anstelle des »Rechts des Stärkeren« unverzichtbare Voraussetzungen für eine nachhaltige Zusammenarbeit. Dies steht im krassen Gegensatz zum kurzsichtigen, gewinnorientierten »Deal-Making«-Ansatz des aktuellen US-Präsidenten. Aus all diesen vielen Gründen ist das Buch weiterhin eine gewinnbringende Lektüre.
Diese Rezension erschien in leicht abgewandelter Form zuerst auf Englisch auf dem Blog des Toda Peace Institute am 1.10.2025.
Herbert Wulf


