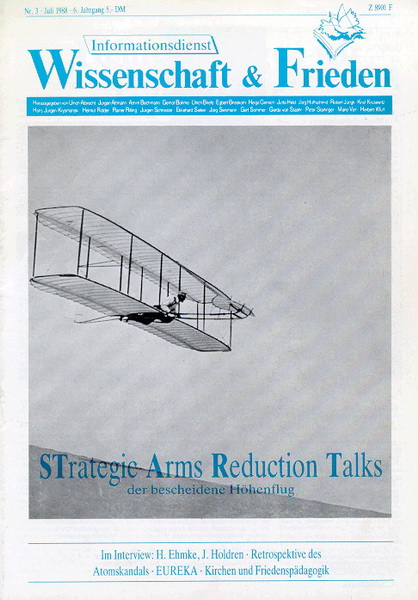Thesen zur Diskussion: Hochschulen des Friedens
von Frank Iwer
Ich will mich in diesem Artikel beziehen auf den Beitrag von Gernot Böhme im Infodienst 2/87, der, wie es scheint, im folgenden zu wenig Beachtung gefunden hat. Dabei ist mein Ausgangspunkt jedoch ein anderer: eine "gemessen an friedlichen Zwecken Überkapazität an Wissenschaft und Technik" vermag ich nicht zu erkennen. Im Gegenteil, Frieden ist heute das hervorragendste wissenschaftliche und auch technische Problem, hier ist das gesamte humanistische Potential der Wissenschaft und ihrer Träger gefordert: Wie kann Abrüstung zuverlässig verifiziert werden? Wie können die Feindbilder und damit die Triebkräfte weiterer Aufrüstung abgebaut werden? Wie können Konzepte globaler und politisch kontrollierter Sicherheit aussehen? Welche Schritte zur Entwicklung einer neuen Abrüstungstechnik (z.B. zur Vernichtung des spaltbaren Materials oder der Chemiewaffen) sind nötig? Und über allem die Frage, wie die globalen Menschheitsprobleme (Ökologie, Entwicklung, Ernährung, Energie,…) gelöst werden können. Die Rolle der Wissenschaft zur Lösung all dieser Fragen wächst – es gibt heute nicht nur eine „Verwissenschaftlichung des Krieges“, wie Böhme schreibt, sondern eine Verwissenschaftlichung aller gesellschaftlichen Probleme und vor allem ihrer Lösungsmuster.
Deshalb muß heute auch der Problemkreis der Verantwortung weiter gefaßt werden. Eine Verweigerung gegen oder sogar eine Verhinderung von Rüstungsforschung reicht, so bedeutend dies auch wäre, nicht mehr aus! Die Anforderungen an die Wissenschaft hat heute eine neue Qualität. Das führt unmittelbar zu
These 1: Es geht heute zuallererst darum, ob und wie die Wissenschaft als Ganzes diesen Anforderungen gerecht werden kann.
Die individuelle und „aggressive“ Form von Verweigerung gegen eine Instrumentalisierung und die Wahrnahme von Verantwortung hat in den letzten Jahren ein beachtliches Maß erreicht; von den „Göttinger 18“ bis zur Gründung des Vereines der Naturwissenschaftler vor wenigen Wochen liegt ein kontinuierlicher und in letzter Zeit beschleunigter Aufbau von Initiativen und Tätigkeiten, von Ringvorlesungen über 3 erfolgreiche Hochschulfriedenswochen bis hin zu bedeutenden Kongressen.
Allerdings steht diese Entwicklung und das dahinterstehende Engagement von vielen wissenschaftlichen Tätigkeiten unter einem doppelten Druck:
Zum einen bedarf es immer noch des individuellen Mutes, sich „gegen den Strom“, und sei es nur der Gleichgültigkeit, zu stellen, währen gleichzeitig der materielle Druck z.B. in Richtung rüstungsrelevanter Forschung wächst.
Und zum zweiten bleiben individuelle Entscheidungen, gemessen an der Größe der Anforderungen, letztlich wenig wirksam, es geht vielmehr um Orientierungen der Wissenschaft als Ganzes. Hier reicht im übrigen auch eine Verweigerung nicht mehr aus, es sind vielmehr die gestalterischen Fähigkeiten der Wissenschaft gefragt.
Böhme arbeitet dieses Problem ganz richtig als kollektive Verweigerung heraus, worunter er z.B. Beschlüsse von Hochschulinstanzen gegen Rüstungsforschung versteht. Nur, und das ist mein zentraler Kritikpunkt an seinem Artikel, bleibt er dabei stehen, diese an sich richtige Erkenntnis gegen das Prinzip der Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit zu stellen, ohne diesen Widerspruch anzugehen. Damit bleiben seine Ausführungen aber konsequenz- und orientierungslos. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn es sich „nur“ um ein philosophisches Problem handeln würde; es ist aber von unmittelbarer praktischer Relevanz, die Frage zu beantworten, wie über individuelle Lösungen hinaus die Wissenschaft insgesamt ihrer Verantwortung nachkommt. Und der Zeitfaktor, den wir dafür zur Verfügung haben, ist (wegen des notwendigen Vorlaufes) eher kleiner als der zur Lösung der globalen Probleme!
Der Verweis auf die „Freiheit der Wissenschaft“ sollte uns nicht abhalten: zum einen erhebt §1 des Grundgesetzes die Fragen der Menschenwürde und Menschenrechte und damit die Herstellung von Frieden und Gerechtigkeit zu obersten Prinzipien. Daraus abgeleitete Beschlüsse von Hochschulorganen über eine ausschließliche Friedensorientierung von Forschung und Lehre scheinen mir mit dem GG durchaus vereinbar. Und zum anderen kann der Umkehrschluß auf ein „individuelles Recht auf Rüstungsforschung und Waffenproduktion“ doch wohl nicht ernsthaft gezogen werden.
Dennoch bleibt, daß wir die „Freiheit der Wissenschaft“ in Rechnung stellen, schon wegen der berechtigter Sorgen der wissenschaftlich Tätigen vor Vereinnahmungen.
Das gilt auch für Überlegungen, das Problem Ververantwortung auf rein administrativem Weg „lösen“ zu wollen: ein staatliches Verbot von Rüstungsforschung oder Erlasse über Forschungsschwerpunkte und Zielkataloge sind sicherlich möglich, wären aber in ihren Wirkungen begrenzt. Zum einen wegen der hinreichend bekannten „Dual-Use-Problematik“, speziell in Fragen der Grundlagenforschung; und zum anderen wegen der so nicht zu streichenden positiven Oberzeugungen der Träger von Wissenschaft. Dies muß aber geschehen, um humanistische Potentiale vollständig mobilisieren zu können.
Ich wende mich damit nicht gegen solche Verbote, sie sind erforderlich und in Ländern wie z.B. NRW auch möglich, nur eben: begrenzt.
Der Widerspruch, wie er von Böhme aufgemacht wird, kann nur in die Richtung gelöst werden: können an den Hochschulen, auf allen Ebenen, Bedingungen geschaffen werden, in denen die Wissenschaft insgesamt und ihre Träger ihrer friedenssichernden, globalen und humanistischen Verantwortung nachkommen können? Und: Was können wir für so definierte „Hochschulen des Friedens“ tun?
These 2: Neben äußeren Faktoren wie dem Grad der Unabhängigkeit und der gesellschaftlichen Diskussion entscheidet sich die Frage der Verantwortung der Wissenschaft maßgeblich am Grad der praktizierten Demokratie, der Offenheit für neue Inhalte und der Transparenz.
Ich will hier nicht vertiefend auf den Problemkreis der wesentlich auch finanziellen Unabhängigkeit eingehen; dies ist ein Problem, dem wir in der nächsten Zeit wohl zunehmende Aufmerksamkeit widmen müssen. Es sollte Klarheit darüber herrschen, daß eine humanistische und friedensorientierte Wissenschaft nicht denkbar ist bei gleichzeitiger Verpflichtung gegenüber Interessengruppen oder gar bei finanzieller Abhängigkeit von Auftraggebern. Verwiesen sei nur auf den Beitrag von Prof. Buckel in der Schriftenreihe Wissenschaft und Frieden, Nr. 10,1988 beim BdWi erschienen.
Wissenschaft und Hochschulen sind kein Elfenbeinturm, ihre inhaltliche Weiterentwicklung wird auf Dauer nicht gegen gesellschaftliche Basistrends möglich sein. Deshalb ist es begrüßenswert, wenn jetzt, wie z.B. in NRW, eine breite gesellschaftliche Diskussion über Anforderungen an die Wissenschaft auch von Seiten der Arbeiterbewegung sowie der Friedens-, Frauen- und Umweltbewegung zunimmt. Dies ist ein wichtiger Schritt gegen eine Vereinnahmung fr ausschließlich kurzfristige Produktionsinteressen.
Praktizierte, nicht nur formale Demokratie, das ist eine wesentliche Antwort, die die Wissenschaftler gegen alle Instrumentalisierungsversuche setzen können. Demokratie, das verlangt öffentliche und intensive Diskussionen darüber, wie sich die Hochschule gegenüber Anforderungen „von außen“ stellt, von Drittmittelgebern, Interessengruppen, dem Staat. Dies ist eine zentrale Schnittstelle für die Frage der Verantwortung; bei allen Anforderungen muß geprüft werden, ob sie mit dem Überprinzip „friedensorientierte und humanistische Wissenschaft“ übereinstimmen. Das entspricht leider noch nicht der Realität: So wurde jetzt z.B. in Wuppertal durch Zufall bekannt, daß an der GH für die Firma Internuklear ein Teilchenbeschleuniger entwickelt wird; eine Diskussion darüber steht bislang noch aus.
Demokratie, das bedeutet nach innen eine ständige, auch fächerübergreifende Diskussion darüber, ob die gesetzten Studien-, Forschungs- und Wissenschaftsschwerpunkte und Themen wirklich „auf der Höhe der Zeit“ sind und in welche Richtung und mit welchen Mitteln sie ggf. zu verändern sind.
Eine größere Offenheit in Forschung und Lehre für die Aufnahme solcher globalen Themen und Probleme ist erforderlich. Dabei bedarf es von Seiten der Wissenschaft, wie Prof. Dürr verschiedentlich darlegte (siehe Schriftenreihe Nr. 10), auch neuer Methoden und Herangehensweisen: die Betrachtung der Gesamtheit der Probleme zueinander, von allgemeinen Fragestellungen, also dem „Makrokosmos“, und die Bearbeitung hochspezialisierter Einzelfragen, dem „Mikrokosmos“, bedingen einander und müssen einander durchdringen.
Das erfordert auch neue Fragen der Interdisziplinarität, eines Zusammenkommens von natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Methoden sowie die Entwicklung neuer Ansätze.
Nötig ist ein höheres Maß an Transparenz der Forschung. Das bedeutet zuallererst, jegliche Ansätze von Geheimforschung an den Hochschulen zu unterbinden und keine Arbeiten zu machen, die der Geheimhaltung unterliegen. Aber auch die ist zu erweitern: Transparenz erfordert eine Offenlegung zumindest der Hauptrichtungen und Oberziele von Forschungsschwerpunkten genauso wie ihre öffentliche Erörterung.
Diese Kriterien scheinen mir neben der Bereitschaft und Fähigkeit zu mehr internationaler Kooperation die wesentlichen Anforderungen an eine Veränderung der Wissenschaft und damit auch der Hochschule zu sein.
Offenkundig ist es für die Erarbeitung einer Gesamtvorstellung über Hochschulen des Friedens und einer entsprechenden Handlungsperspektive notwendig, die weitere Informationsarbeit (Stichwort: Aufklärung) zu verbinden mit der Frage der Reform der Institution Hochschule. Hierfür will ich im folgenden 2 Vorschläge zur Diskussion stellen:
These 3: Wir brauchen neue Ansätze von Friedensforschung und -lehre!
Friedensforschung, das ist in der BRD und gerade auch an den Hochschulen (z.B. Hamburg) eine vornehmlich politikwissenschaftlich orientierte Spezialistenangelegenheit. Eine naturwissenschaftlich-technische Friedensforschung, wie sie in den USA z.T. betrieben wird (z.B. am MIT), ist bei uns praktisch nicht existent. Aber allein der Problembereich „Abrüstung“ bedarf einer Reihe gerade auch naturwissenschaftlich-technischer Problemlösungen; man denke nur an die Fragen der Verifikation von Abrüstungsmaßnahmen und Atomtests.
Aber es liegt auch im Charakter der Sache, daß zunehmend interdisziplinäre Vorgehensweisen auch zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften erforderlich sind. Dementsprechende interdisziplinäre Forschungs- und Lehrprojekte zu initiieren und einzurichten ist deshalb sinnvoll und notwendig. Erste Beispiele sind geschaffen: so wird an der Uni Bochum jetzt ein solches Projekt eingerichtet mit den, Thema Verifikationsfragen konventioneller Abrüstung“, an dem Physiker, Völkerrechtler, Historiker etc. zusammenarbeiten werden. In eine ähnliche Richtung zielt das Darmstädter Projekt (s. E. Kankeleit in „Wissenschaft und Frieden“ Nr. 10).
Meines Erachtens ist eine dritte Erweiterung hin zu einer „alternativen Friedensforschung und -lehre“ erforderlich: ausgehend von den oben gemachten Überlegungen steht heute an jeden Fachbereich und an jede Disziplin die Anforderung, sich mit friedensrelevanten Fragestellungen des eigenen Bereichs zu befassen und sie in Forschung und Lehre zu integrieren. Die Einrichtung von Friedensprofessuren am Fachbereich, wie sie jetzt z.B. in der Mathematik an der Uni Hamburg eingefordert wird, scheint hierfür der gangbarste Weg zu sein.
These 4: Beschlüsse zur „Friedensverpflichtung“ und gegen Rüstungsforschung müssen verbunden sein mit der Einrichtung von Friedensbeauftragten an Hochschulen (und Fachbereichen)!
Schon heute gibt es an einer Reihe von Hochschulen Beschlüsse gegen die Durchführung von Rüstungsforschungsprojekten, so z.B. an der FH Hamburg und Gießen. Sie sind immer verbunden mit der Verpflichtung einer Förderung der Friedenstätigkeit und des Friedensbewußtseins unter den Hochschulangehörigen.
Dabei bestehen zugleich 2 Probleme: zum einen werden sie, wie in Hamburg geschehen, durch die Aufsichtsbehörde in Kernbereichen revidiert. Und zum anderen ist unklar, wie sie in der Praxis umgesetzt werden können, wo doch Administrieren nur bedingt hilft. Genau hierauf zielt die Einrichtung eines Friedensbeauftragten mit entsprechenden Kompetenzen.
Ich weiß aus einer Reihe von Gesprächen, daß dieser Vorschlag zunächst durchaus Kontroversen hervorruft. Doch allein das, eine große, hochschulöffentliche Diskussion über Anforderungen und Ansprüche an die Wissenschaft wäre ein lohnendes Ergebnis dieses Vorschlages, von den entsprechenden Signalwirkungen in den politischen Raum hinein einmal ganz abgesehen. Aber darum geht es nicht in erster Linie, sondern der Vorschlag zielt auf unmittelbar wirksame Veränderungen in den Hochschulen in Richtung einer Wahrnahme von Verantwortung.
Ein solcher Friedensbeauftragter müßte zunächst offiziell sein, er sollte unmittelbar mit der Leitung, z.B. als Vizepräsident, verbunden sein. Seine Aufgabe wäre die Durchführung eines eigenen Arbeitsprogrammes im Auftrag der Hochschule, das auf die Förderung der Friedensarbeit und die Herstellung von mehr Transparenz und Diskussionen vor Entscheidungen abzielt. Dazu gehören
- eine regelmäßige Durchführung von Friedenswochen, u.U. in Verbindung mit DIES
- eine Verbesserung der Information der Hochschulöffentlichkeit über Projekte, Erfahrungen und Forschungsvorhaben über geeignete Medien (z.B. Friedenszeitung)
- die Initiierung und Unterstützung von fächerübergreifenden Diskussionen über globale Anforderungen, aber auch über Fachfragen von allgemeinem Interesse
- die Initiierung und Unterstützung von fächerübergreifenden Projekten (wie z.B. in Bochum).
Darüber hinaus wäre eine (zumindest) beratende Stimme in Fragen von Studienordnungen und Forschungsschwerpunkten anzustreben, er sollte Vorschlagsrecht für Anschaffungen (z.B. Literatur) und Berufungen haben. Notwendig wären jährliche Tätigkeitsberichte; eine Zusammenarbeit mit einer statusübergreifenden Projektgruppe sowie eine jährliche Friedensversammlung zur Diskussion und Erarbeitung von weiteren Vorschlägen wäre sinnvoll.
Soweit erste Überlegungen. Um ein letztes Problem aufzuwerfen: es geht hier ausdrücklich nicht um den Aufbau eines Delegationsmechanismus, um die Gründung einer „Ersatzfunktion“ für die Friedensaktivisten, an die die Verantwortung dann weitergegeben werden kann, sondern um die Herausbildung von Bedingungen, in denen eine verantwortliche Wissenschaft, sei es in Studium, Forschung oder Lehre, erst stattfinden kann.
Es wäre also keine „administrative Lösung“ und insofern mit den Befürchtungen von Fremdeingriffen vereinbar; es wäre vielmehr der Aufbau eines „Selbstschutzmechanismus“, der auch weiterhin das aktive Handeln und Engagement aller in der Wissenschaft Tätigen verlangt, dieses aber unterstützt, vernetzt und wirksamer zur Geltung bringt.
Die hier entwickelten Vorschläge bieten darüber hinaus eine reale Perspektive, gemeinsame Handlungskonzepte von Studierenden, Lehrenden und Forschenden zu entwickeln und zum tragen zu bringen, was zwingend erforderlich ist, um an den Hochschulen erkennbare Schritte in Richtung einer friedenssichernden und humanen Wissenschaft zu gehen.
Frank Iwer Vereinigte Deutsche StudentInnenschaften Projektbereich Frieden