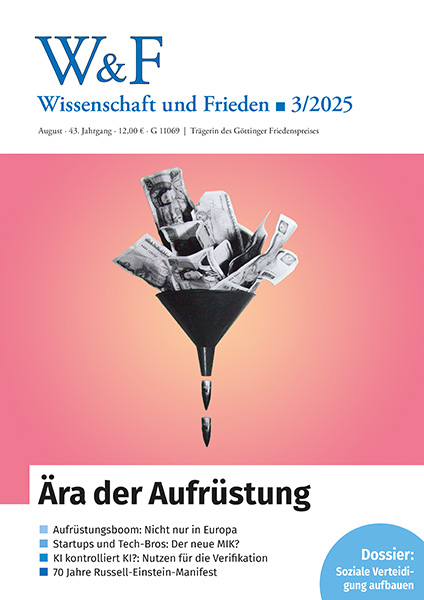Umkämpftes Erinnern in der postmigrantischen Gesellschaft
Tagung der DGS-Sektionen »Soziale Probleme Soziale Kontrolle« und »Migration und ethnische Minderheiten«, Hochschule München, 23.-25. Juni 2025.
Als hochkarätig besetztes Podium zur Frage »Erinnern als Kritik? Postmigrantische Erfahrungen, Kämpfe und Perspektiven im Gespräch« eröffneten die Autorin Lena Gorelik, der Antirassismus- und Antidiskriminierungsberater Hamado Dipama, Newroz Duman von der Initiative 19. Februar Hanau und die Ethnologin und ehemalige Präsidentin des Goethe-Instituts Carola Lentz die gemeinsame Frühsommertagung »Umkämpftes Erinnern in der postmigrantischen Gesellschaft«.
Hauptanliegen der dreitägigen Tagung war es, gegenwärtige Erinnerungskämpfe in den Blick zu nehmen. Dabei sollten zwei Stränge der Erinnerungsarbeit in Deutschland zusammengebracht werden. Zum einen Auseinandersetzungen um rechte, rassistische und antisemitische Gewalt in der BRD und DDR nach 1945 und zum anderen um die deutsche Kolonialgeschichte.
Auf dem Eröffnungspodium wurde ein eindrückliches Einvernehmen über die Gemeinsamkeiten der Kämpfe um Erinnerung deutlich. Unabhängig davon, ob das Gedenken an Opfer rechter Gewalt wenige Jahre zurückliegt, transgenerationale und biographische Erfahrungen thematisiert werden oder in postkolonialer Aufarbeitung Jahrzehnte zurückliegende Kolonialerfahrungen und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart erinnert werden: Umkämpft ist das Erinnern nicht nur im Konkurrieren um Aufmerksamkeit und personelle oder finanzielle Ressourcen. Auch der langanhaltende und tägliche Kampf um Anerkennung in der Gesellschaft wurde deutlich. Erinnerungsarbeit und damit verbundene Kämpfe sind dabei stets mit Kritik an bestehenden Machtverhältnissen verbunden.
In über 30 Beiträgen wurden viele der auf der Podiumsdiskussion angesprochenen Themen im Laufe der Tagung vertieft. Auch hier gelang es, wissenschaftliche, empirische Forschungsarbeiten mit aktivistischen Stimmen zu integrieren. Im Laufe der Tagung bestand zudem viel Raum für Vernetzung für die über 100 Teilnehmenden aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Der erste Tag startete mit einer Forschungswerkstatt für Forschende in der Qualifizierungsphase, die zum Themenkomplex »Erinnern und rechte Gewalt« arbeiten. In den darauffolgenden zwei Tagen wurden die Beiträge entlang von acht Panels thematisch präsentiert, von denen hier nur einige erwähnt werden können.
Im ersten Panel ging es um plurales bzw. multidirektionales Erinnern. Darin präsentierten Katharina Brizić und Leyla Ferman das Projekt »FERMAN. Mehrsprachiges Erinnern eines Genozids«, in dem es um die Erarbeitung einer umfassenden Erinnerungsarbeit zum anhaltenden Völkermord an der ethno-religiösen Gemeinschaft der Ezid*innen geht. Im Rahmen des Projektes bauten die Beteiligten eine Web-Plattform auf und entwickelten verschiedene Ausstellungen und Bildungskonzepte. Ein Vorteil bestand hier darin, dass – anders als bei der Gedenkarbeit zur NS-Vergangenheit, in der eine Auseinandersetzung mit historischen Prozessen zur gesellschaftlichen Erinnerungsarbeit notwendig ist – aufgrund der Aktualität des Gedenkens von Grund auf etwas Neues aufgebaut werden konnte.
Eine internationale Perspektive, wie mit Erinnern umgegangen wird, brachte Alia Wielens ein. In ihrem Beitrag fragte sie nach der Verhandlung pluraler Erinnerungen an französischen Gedenkstätten. Mit dem Forschungsfokus auf den Umgang mit Objekten zeichnete sie nach, wie versucht wird, den Geschichten und dem Erinnern verschiedener Opfergruppen gerecht zu werden. Übergreifend stellte sie hier eine Marginalisierung von weiblichen Perspektiven fest.
Das zweite Panel beschäftigte sich mit dem Gedenken im öffentlichen Raum als einer »Praxis der Problematisierung«. Hier untersuchte Andrea Horni die diskursiven Kämpfe um die Änderung von Straßennamen am Beispiel der Halit-Straße in Kassel. Ҫağan Varol gab einen Einblick, wie aktivistische Arbeit über unternehmerisches Stadtmarketing entpolitisiert werden kann, wie dies auf der Kölner Keupstraße in der Erinnerung an die Opfer des dortigen Nagelbombenanschlags des »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) 2004 beobachtet werden kann.
»Umkämpfte Repräsentationen« diskutierte das dritte Panel, in welchem von Chris Zisis filmisches Material über griechische Arbeitsmigrant*innen in Deutschland, bzw. der Umgang damit thematisiert wurde. So waren der Film und Bilder von Demonstrationen – und damit visuelle Repräsentationen von Widerständen gegen soziale Missstände und Arbeitsverhältnisse – lange nicht zugänglich. Mit großem Aufwand ist es nun wieder möglich, diese weiter zu beforschen und in ein kollektiven Bildgedächtnis zu integrieren.
Über Aushandlungsprozesse in Dialogformaten zwischen Kunst und Wissenschaft berichteten Lina Mitschke, Melanie Ohst und Júlia Wéber und zeigten zum einen eine gelungene Kooperation von Aktivismus, Wissenschaft und der Kuration einer Ausstellung. Zum anderen machten sie deutlich, wie in der Auseinandersetzung mit DDR-Kunst eine antirassistische Sensibilisierung des Publikums vor verschiedenen Herausforderungen steht. Wurde in einem Forum zur Ausstellung »Black and White« in der Kunsthalle Rostock ein Bild des Künstlers als Kritik am US-amerikanischen kapitalistischen System sowie an der Ausbeutung Schwarzer Menschen gesehen, war die rassismuskritische Einordnung erforderlich, dass die bildliche Darstellung ebensolche Gewalt- und Unterdrückungserfahrungen reproduziert.
Über die Auseinandersetzung mit einer Bronzeskulptur im öffentlichen Raum, die zunächst dem Gedenken ausgebeuteter Frauen im Konflikt zwischen Japan und Korea gewidmet war, sprach Nhu Ý Linda Nguyễn. Diese Skulptur wurde im Zuge verschiedener Aushandlungen von Erinnern und Gedenken – als sogenannte »Friedensstatue« in mehreren Städten aufgestellt – zum globalen Symbol für den Kampf um Anerkennung für Frauen, die in Kriegen und Konflikten gezielt und z.T. systematisch Opfer sexualisierter Gewalt wurden.
Mit drei Möglichkeiten der Stadterkundungen konnten die Konferenzteilnehmenden die Eindrücke der Tagung dann in Stadtrundgängen zu »Postkolonialen Spuren in München« oder »Orten rechten Terrors in München« verarbeiten. Auch der Besuch der Ausstellung »What the City« des Münchner Stadtmuseums und das Gespräch mit dem Historiker und Kurator des Ausstellungsmoduls »Racist City«, Dr. Simon Goeke, wurde rege angenommen.
Am dritten Konferenztag thematisierte Emre Arslan im siebten Panel unter dem Titel »Erinnern, Staat, Kritik«, wie kollektives Gedächtnis und symbolische Ordnungen in Kämpfen um das Gedenken an die NSU-Opfer zusammentreffen. Er untersuchte, inwiefern symbolische Ordnungen unter anderem als machtvolle Kommunikation des Staates anlässlich des Gedenkens an die Opfer des NSU produziert werden.
Yassir Jakani referierte zu »(Un-)sichtbare Gewalt und umkämpfte Spuren in der deutschen Erinnerungskultur: Zur Anerkennung rechtsextremer Todesopfer«. Dabei vollzog er einen Perspektivwechsel von der täterzentrierten Perspektive auf »rechte Gewalt als Terrorismus« zu einer opfer- bzw. betroffenenzentrierten Perspektive. Dies erlaube es, Kontinuitäten aufzuzeigen von den 1990er Jahren bis in die Gegenwart. Rechte Gewalttaten lassen sich mit einer betroffenenzentrierten Perspektive nicht nur als Einzeltaten, sondern als terroristisch einordnen, insofern sie eine Atmosphäre der Angst und Unsicherheit vor Angriffen in einer indirekten Zielgruppe erzeugen. Somit kann eine Linie gezogen werden von neonazistischen Schlägertrupps und Brandanschlägen in den 1990er Jahren bis hin zu Anschlägen des NSU (bis 2011) oder rechter Gewalttaten wie jener im OEZ in München (2016) oder in Halle (2019).
Aus der Vielfalt der Beiträge und verhandelten Themen wurde deutlich, dass die Kämpfe um Erinnern und Gedenken sehr unterschiedlich sein können. Zugleich ließ die offene und konstruktive Diskussion in der bewussten Auseinandersetzung mit verschiedenen Erinnerungskämpfen den Raum, um Wissenschaft und aktivistische Arbeit sowie verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Ein Fazit über die Beiträge auf der Tagung kann somit sein, dass die Erinnerungskämpfe trotz der jeweiligen Singularität der Erfahrungen dennoch nicht alleine gekämpft werden müssen.
Alia Herz-Jakoby