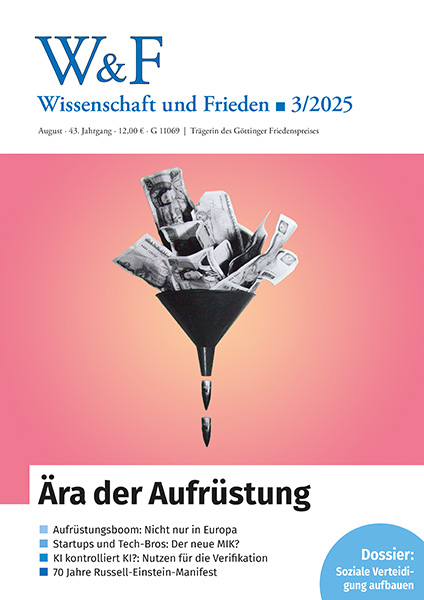Unsichtbare Zeitlichkeit
Ein Gewalt-Analyserahmen für Friedenspraxis in Zeiten der Polykrise
von Cora Bieß und Marcel Vondermaßen
Die wachsende Militarisierung und die allgegenwärtige Berichterstattung über Krieg prägen unseren Blick auf gewaltvolle Konflikte und deren Folgen − doch was bleibt dabei unsichtbar? Während Gewaltverständnisse im Kontext von Krieg oft auf akute Zerstörung fokussiert sind, entfalten sich viele Formen von Gewalt auch zeitlich versetzt und langsamer. Wir erweitern den Ansatz der »langsamen Gewalt« von Rob Nixon hier in zweierlei Hinsicht: Durch eine neue Analysekategorie der synchronen und asynchronen Gewalt und durch einen zeitlich und räumlich differenzierten Gewaltbegriff. Beides soll heutiger Friedenspraxis und -politik in Zeiten der Klimakrise neue konzeptionelle Impulse bieten.
In seinem wegweisenden Buch »Slow violence and the environmentalism of the poor« beschrieb Rob Nixon (2011) das Konzept der »langsamen Gewalt«. Nixon erfasste diese in Form einer schleichenden, oft unsichtbaren Umweltzerstörung, die sich über Dekaden entfalten kann und die dann – so seine gerechtigkeitsfokussierte Brille – vor allem marginalisierte, arme Gemeinschaften trifft. Diese Gewaltform wird selten medienwirksam thematisiert, obwohl sie massive ökologische und soziale Folgen hat. Nixon rückte damit – zwar nicht als erster, so doch sehr wirkungsvoll – die Zeitdimension und die ungleichen globalen Auswirkungen von Umweltkrisen stärker in den Fokus der Friedensforschung.
Diesen konzeptionellen Impuls nehmen wir auf, und erweitern ihn anhand aktueller Beispiele. Uns ist dabei wichtig zu betonen, dass durch die Fokussierung auf langsame und asynchrone Gewalt das Leid, das durch Formen schneller Gewalt verursacht wird, weder geschmälert noch verglichen, sondern kontextualisiert und ergänzt werden soll.
Vier Dimensionen der Gewalt
Kriege, hier verstanden als Bündel von Gewaltakten, die mit militärischen Mitteln ausgetragen werden, zerstören die Lebensgrundlagen von Lebewesen über einen langen Zeitraum, aber nicht alle Folgen sind sofort ersichtlich. Kriege sind Mischformen von vier Gewaltdimensionen: schneller und langsamer, synchroner und asynchroner Gewalt (vgl. Tabelle 1). So ergänzt scheint uns der Ansatz von Nixon eine umfassende Gewaltanalyse zu ermöglichen.
Nicht nur Kriege als Ganzes, sondern auch einzelne Handlungen müssen mehrdimensional betrachtet werden: So hat beispielsweise der Einsatz von Atomwaffen direkte Folgen, wie Organschäden durch die Druckwelle oder Boden- und Wasserkontamination, aber auch langfristige Auswirkungen, wie ein erhöhtes Krebsrisiko. Akte von Vertreibung haben eine Gewaltdimension, die die Betroffenen sofort betrifft (Flucht), aber es entstehen auch Traumata, die jahrzehntelang, manchmal sogar intergenerational (asynchron) nachwirken. Armut wiederum kann sowohl synchron als auch asynchron wirken: einerseits als alltägliche, permanente Erfahrung von »zu wenig«, andererseits in Form von Langzeit- und Spätfolgen wie verkürzte Lebenszeit oder gesundheitliche Probleme. Diese können beispielsweise auftreten, wenn man als Kind armutsbedingt unterernährt war oder keine Gesundheitsvorsorge erhalten hat.
- Schnell: Schnelle Gewalt tritt meist in Form von direkter Gewalt auf. Bei kriegerischen Handlungen wird medial häufig der Fokus auf schnelle Gewalt gelegt. Beispiele: Bombenabwürfe, Kampfhandlungen
- Langsam: Langsame Gewalt bezeichnet Phänomene, die langfristig wirken, ohne dabei weniger gewaltvoll zu sein. Beispiele: Versteppung von Land, Dürren
- Synchron: Synchrone Gewalt liegt vor, wenn der Gewaltakt und dessen Folgen direkt aufeinander folgen. Ursache-Wirkung wird in der Situation direkt miteinander in Verbindung gebracht. Beispiel: Verletzungen, Waldbrand
- Asynchron: Asynchrone Gewalt tritt nicht unmittelbar, sondern zeitverzögert und räumlich versetzt auf. Durch den zeitlichen Abstand zwischen Ursache und Wirkung ist sie zudem schwerer oder gar nicht den eigentlichen Auslösern oder Verursachenden zuzuordnen. Beispiele: Chemikalien, Biodiversitätsverlust
Tabelle 1: Die vier Gewaltdimensionen
Alle vier Analysekategorien (vgl. Tab. 1) schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern können sich sogar in ihrer Wirkung aufaddieren oder Wechselwirkungen hervorrufen. Um zu einer Einschätzung zu gelangen, wie gewaltvoll eine Situation oder Handlung ist, müssen daher alle vier Gewaltdimensionen miteinbezogen werden.
Ein Beispiel für eine oft nicht beachtete Folge von Kriegen ist ihre Auswirkung auf Klima und Umwelt: Kriegsführung verursacht hohe CO2-Emissionen. So verbraucht ein Langstreckenbomber vom Typ B-52 in einer Stunde so viel Treibstoff wie eine Person durchs Autofahren im Schnitt in sieben Jahren.1 Wird ein intergenerationales Gerechtigkeitsverständnis berücksichtigt, das auch zukünftige Generationen in den Blick nimmt, führen der CO2-Ausstoß und andere Umweltzerstörungen durch die Kriegsführung zu Klimaungerechtigkeit, von der insbesondere zukünftige Generationen, Natur und Lebewesen betroffen sein werden.
Während »langsame Gewalt« Phänomene beschreibt, die schwer oder nicht sichtbar sind, weil die Wirkungen langsam voranschreiten (Versteppung) oder in sehr viele, jeweils für sich genommen scheinbar wenig gewaltsame Akte zerfallen (Armut), gibt es bei asynchroner Gewalt einen zeitlichen Abstand zwischen Ursache und Wirkung. Die Auswirkungen sind nicht direkt, sondern zeitlich, und teilweise räumlich, versetzt spürbar.
Anwendungen der Vier-Felder-Matrix
Wir haben die unterschiedlichen Dimensionen in einer Vier-Felder-Matrix aufgeführt (vgl. Tab. 2). So entsteht auch ein Verständnis davon, dass Asynchronität nicht zwangsläufig weniger gewaltvoll ist. Die Auswirkungen können auch sehr konkret oder akut relevant sein: Ein Beispiel dafür bilden die Waldbrände im Juli 2025 in Ostdeutschland. Aufgrund des erhöhten Sicherheitsrisikos durch im Boden liegende Munition und Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg, die in dem Gebiet zu detonieren drohten, konnte kein Feuerwehreinsatz durchgeführt werden. Hier wird deutlich, wie sich die Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs mit der Klimakrise verschärfen und Wechselwirkungen erzeugen können: Einerseits steigt durch langanhaltende Hitze- und Dürreperioden, die durch die Klimakrise verstärkt auftreten, die Gefahr von Waldbränden. Andererseits kann die Munition selbst Auslöser eines Waldbrands werden, wenn sie durch starke Hitzeeinstrahlung detoniert (Abdi-Herrle 2023; Tagesschau 2025). In diesem Beispiel ist die Explosion von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg 2025 eine asynchrone, direkte Gewaltform. Sie kann schnell zur Zerstörung der Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Natur führen. Die Folgen der Klimakrise zeigen sich dagegen oftmals langsam und asynchron. Sie können aber auch in Form von Wetterextremen direkt und schnell in Erscheinung treten. Dabei sind die Ursachen ein komplexer und langwieriger globaler Prozess.
|
Gewalt- |
Schnell |
Langsam |
|
Synchron |
● Kampfhandlungen, ● Bombenabwürfe ● Vergewaltigung ● Vertreibung (als Akt) |
● Radioaktive Verseuchung ● Verunreinigtes Süßwasser ● Versteppung ● Armut |
|
Asynchron |
● Landminen ● Streumunition ● Autonome Drohnen1 ● Blindgänger von Fliegerbomben |
● CO2-Emissionen ● Verlust der Biodiversität ● Armut ● Vertreibung (als Trauma) |
Tabelle 2: Die vier Gewaltdimensionen in Beispielen
Eigene Darstellung
1) Autonome Drohnen sind Waffensysteme, die so programmiert werden, dass sie nach vorher festgelegten Parametern selbstständig Entscheidungen treffen können – etwa darüber, wann und ob sie ein Ziel angreifen. Die eigentlichen Handlungen dieser Drohnen, wie etwa ein Schuss, erfolgen nicht durch einen unmittelbar vorhergehenden Befehl eines Menschen, sondern basieren auf Entscheidungen, die Menschen bereits Stunden oder Tage zuvor bei der Programmierung und Konfiguration der Drohne getroffen haben. Die Autonomie bezieht sich somit auf die operative Ausführung, nicht auf die strategische Kontrolle.
Ein anderes überregionales Beispiel ist die Versenkung von bis zu 1,6 Millionen Tonnen Munition und Kriegsgerät in Nord- und Ostsee nach dem zweiten Weltkrieg.2 Dies hat schon Fischer*innen das Leben gekostet, die in einem Fangnetz eine Bombe an Bord geholt hatten (Kiel 2025).
Derartige Gewaltpotenziale sind nicht nur historische Altlasten, sondern können auch zur Konsequenz gegenwärtiger Kriegsführung werden. Antipersonenminen werden bis heute in mehreren Kriegsgebieten verwendet (siehe Landmine Monitor 2024). Bis Juni 2025 erklärten allein Polen, Estland, Lettland, Litauen, Finnland und die Ukraine die Absicht, aus der Ottawa-Konvention zum Verbot von Antipersonenminen auszutreten. Dadurch entsteht potenziell ein erhöhtes asynchrones Gewaltpotential (siehe Handicap International et al. 2025). Denn die „menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen belasten die Zivilbevölkerung langfristig, insbesondere in benachteiligten und geschwächten Regionen, in denen die Menschen oft keine andere Wahl haben, als dort zu leben und ihr Land trotz der Verminung zu bewirtschaften.“ (ebd.).
Aus diesem Zitat wird deutlich, dass aus klassismussensibler Perspektive Menschen in Armut vermutlich die am stärksten betroffene Gruppe sein werden. Denn Reiche haben das Geld, ihr Grundstück räumen zu lassen oder woanders hinzuziehen. Sarah Njeri (2023) zeigt am Beispiel Angolas, dass auch Jahrzehnte nach Kriegsende ganze Gemeinden noch immer durch Landminen isoliert sind. Während wohlhabende Menschen verminte Gebiete meiden können, indem sie auf sichere Reisemöglichkeiten wie das Flugzeug zurückgreifen, bleibt dies für armutsbetroffene Menschen unerschwinglich. Die Landminen behindern zudem nicht nur die sichere Fortbewegung, sondern hemmen auch die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen – wodurch es dort für armutsbetroffene Menschen noch schwieriger wird, der Armut zu entkommen.
Zudem sind Auswirkungen möglich, die nicht nur zeitliche, sondern auch räumliche Distanz zum Gewaltgeschehen aufweisen. Diese können in anderen Weltgegenden auftreten, also weit über das eigentliche Kriegsgebiet hinaus, und sogar globale Folgen nach sich ziehen. Gegenwärtige Kriege zeigen, wie es aufgrund globaler Verflechtungen zu weltweiten Versorgungs- und Lieferengpässen bei Grundnahrungsmitteln und Medikamenten kommen kann (bspw. Weizenkrise im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine). Dies kann zu einem Anstieg von Hunger und Armut in anderen Regionen führen, die sich im schlimmsten Fall als Kaskadeneffekte gegenseitig verstärken. Kriege bringen daher asynchrone und teilweise räumlich entgrenzte Folgen mit sich, die vorher nicht abschätzbar sind und deshalb im Kalkül der kriegsführenden Parteien auch selten berücksichtigt werden.
Diese Folgen können noch lange nach Kriegsende nachwirken, weshalb das Konzept der asynchronen Gewalt nicht nur das Verständnis von Gewalt und Krieg, sondern auch das von Frieden zeitlich und räumlich erweitert. Wenn Frieden als Prozess des Gewaltabbaus und der Stärkung von Gerechtigkeit verstanden wird, müssen globale asynchrone Gewaltpotenziale frühzeitig adressiert werden, bevor sie Schaden anrichten.
Wider den verengten Blick auf schnelle Gewalt
Die Nichtthematisierung langsamer, asynchroner Gewalt hat praktische, politische Folgen: In Zeiten, in denen der Fokus auf schneller, synchroner Gewalt liegt, wird die Aufstockung von Mitteln für das Militär oftmals als alternativlos dargestellt. Gleichzeitig sind finanzielle Ressourcen für Bewältigung und Auswirkungen des Klimawandels, Soziales, zivile Krisenprävention und Friedensbildung von Kürzungen bedroht (vgl. PZKB 2025). Denn jede präventive Veränderung erscheint in solcher Logik als aufwändig, mühsam, nicht geeignet für eine akute Intervention, zu träge oder zu kostspielig.
Dominante mediale Diskurse konzentrieren sich dementsprechend vermehrt auf Fragen der eigenen militärischen Stärke, die in Form von schneller Gewalt auch schnelle Erfolge verspricht. Diese Konzentration auf das Jetzt, die oft nicht weiterdenkt als bis zu der Frage, wer den Krieg gewinnt oder verliert, betrachtet Auswirkungen von langsamer Gewalt und asynchrone Kaskadeneffekte oder Langzeitfolgen kaum oder gar nicht.
Dabei gäbe es Möglichkeiten dagegen zu steuern, beispielsweise könnte der Schutz vor asynchroner Gewalt als Pflicht für Kriegsparteien gestärkt werden. In der »Konvention über bestimmte konventionelle Waffen« (CCW) der Vereinten Nationen werden bereits Regeln für den Gebrauch bestimmter Waffentypen aufgestellt. Zum Beispiel regelt Protokoll II der CCW unter anderem den Gebrauch von Landminen und in Protokoll V werden kriegsteilnehmende Parteien für die Kampfmittelbeseitigung zur Verantwortung gezogen. Parallel dazu könnten sich Staaten zu einer Verschärfung von Protokoll V zusammenschließen. So ein Abkommen könnte asynchrone Gewaltformen als Kriegsfolgen anerkennen, zu Anstrengungen verpflichten, diese möglichst zu vermeiden bzw. nach Kriegsende die Gewaltpotenziale gezielt zu verringern und in all dem enger zusammenzuarbeiten. Zusätzlich verbietet das schon erwähnte Ottawa-Abkommen Unterzeichnerstaaten den Einsatz von Antipersonenminen. Es gilt, diese völkerrechtliche Errungenschaft auch in Zeiten zunehmender Militarisierung zu bewahren und die Prinzipien humanitärer Abrüstung zu stärken.
Dazu müsste jedoch das Gewaltpräventions-Dilemma überwunden werden, das für asynchrone Gewaltpotenziale in zweifacher Hinsicht gilt: Wenn Gewaltprävention wirkt, bricht keine direkte (schnelle) Gewalt aus und anderen Gewaltformen, wie zum Beispiel langsamer Gewalt, wird entgegengewirkt. Im Falle asynchroner Gewalt kann Gewaltprävention an zwei Stellen ansetzen: Sie verhindert den Aufbau des Gewaltpotenzials (z.B. Minen werden nicht gelegt) oder sie löst das Gewaltpotenzial gewaltarm auf (Minen werden geborgen bzw. gesprengt).
Jedoch lässt sich die Wirkung von Gewaltprävention schwer messen und medial transportieren, auch sie wirkt oftmals eher lang- als kurzfristig. Hinzu kommt, dass langsame, asynchrone Gewaltphänomene oft kein explizites Gegenüber kennen, das politisch oder militärisch besiegt werden kann. Das kann daran liegen, dass etwaige Verantwortliche bereits verstorben sind (im Beispiel der versenkten Kriegsmunition aus dem Zweiten Weltkrieg), kaum auszumachen sind (etwa bei Landminen) oder gar nicht als konkrete Einzelpersonen existieren, sondern systemisch wirken (Klimakrise, Biodiversitätsverlust). Unser Analyserahmen versucht demnach, die komplexen Wechselwirkungen zwischen zeitlich und räumlich entgrenzten Ursache-Wirkungsmechanismen aus betroffenenzentrierter Perspektive in den Fokus zu rücken und sie mit gegenwärtigen Diskursverschränkungen in Zeiten der Polykrise aus Militarisierung, Klimakrise und demografischem Wandel zu verbinden. Letzterer führt zu einer größer werdenden Gruppe alter Menschen in Machtpositionen, die über Langzeitfolgen entscheiden, von denen die nachfolgenden Generationen und Lebewesen in Zukunft betroffen sein werden. In diesem Verständnis geht unser Modell über das etablierte Gewaltdreieck von Galtung hinaus, indem es explizit die Verschränkung von beispielsweise Kriegsfolgen und Klimafolgen sowie Armut betrachtet.
Alle diese Faktoren führen dazu, dass ein Vorgehen gegen diese Phänomene sich nur schwer in politisches oder mediales Kapital umwandeln lässt. Das kann zudem dazu führen, dass vorschnell von »Frieden« und »Rückkehr zur Normalität« gesprochen wird, wenn schnelle, synchrone Gewalt gestoppt wird und das Engagement für einen nachhaltigen Abbau von Gewalt abebbt. Soll Gewaltminderung systemisch oder nachhaltig umgesetzt werden, kann sie jedoch nicht auf direkt und schnell greifbare Gewaltformen beschränkt werden.
Ganz konkret für Deutschland ist zu befürchten, dass die Neu-Priorisierung von Finanzmitteln im Haushalt langsame, asynchrone Gewaltformen nicht ausreichend kompensiert bzw. berücksichtigt. Gerade deshalb sollen durch unseren Analyserahmen auch die Handlungsoptionen der Politik drastisch erweitert werden – ohne in ein falsches Aufrechnen von präventiver Arbeit und konkreter Gewaltbeendigung zu geraten.
Wir hoffen, dass die hier entfaltete Perspektive ein Baustein auf dem Weg sein kann, um Formen langsamer und asynchroner Gewalt entsprechend ihrem Gewaltpotenzial sowohl in der Politik als auch in der breiteren Öffentlichkeit zu kommunizieren und ihnen gemeinsam entgegenzutreten.
Anmerkungen
1) Interview mit Neta Crawford, in: Die ZEIT (2023): Abrüsten fürs Klima? Nr. 45, 2.11.2023, S. 36.
2) Die Munitionsaltlasten wurden im Zuge der Entwaffnung Deutschlands versenkt und stellen auch eine Gefahr für die Umwelt dar. Das Bundesministerium für Umweltschutz adressiert mittlerweile diese Gefahr.
Literatur
Abdi-Herrle, S. (2023): Waldbrandgefahr. Und plötzlich explodiert der Wald. Die ZEIT online, 15.6.2023.
Handicap International et al. (2025): NGOs fordern Bundesregierung für mehr Einsatz gegen Antipersonen-Minen auf. Ottawa-Konvention muss gestärkt werden. Offener Brief an die Minister Wadephul und Pistorius. Berlin, 16.6.2025.
International Campaign to ban landmines (2024): Landmine Monitor 2024. Geneva: ICBL-CMC, 20.11.2024.
Kiel, V. (2025): Zeitbomben im Meer. Die ZEIT, Nr.8/2025, 20.2.2025, S. 30.
Nixon, R. (2011): Slow violence and the environmentalism of the poor. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Njeri, S. (2023): Ukraine war: after the shooting stops landmines will keep killing – as we’ve seen in too many countries. The Conversation (online), 30.8.2023.
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung (2025): Trotz verschärfter Weltlage – Bundesregierung hält an Kürzungen bei Friedensförderung fest. Pressemitteilung. Berlin, 25.6.2025.
Tagesschau (2025): Sachsen und Thüringen. Mehrere Waldbrände weiterhin nicht unter Kontrolle. tagesschau.de, 3.7.2025.
Dr. Cora Bieß übernimmt ab Oktober 2025 die Professur für Kindheitspädagogik an der Internationalen Hochschule in Stuttgart und ist bei Berghof Foundation im Bereich Friedensbildung tätig.
Dr. Marcel Vondermaßen ist wissenschaftlicher Koordinator am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen.