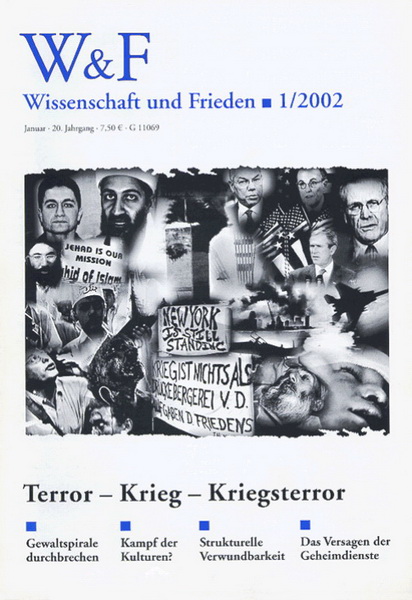Vom Elend einer militarisierten Außenpolitik
Die Bundeswehr im Kampfeinsatz in Afghanistan
von Jürgen Rose
Zum zweiten Mal nach 1999 entsenden Sozialdemokraten und Bündnisgrüne deutsche Soldaten mit einem expliziten Kampfauftrag in ein fremdes Land – nötigenfalls zum Töten und zum Sterben. Unter den Vorzeichen einer so genannten Normalisierung der deutschen Außenpolitik scheint ein solches Procedere zur Regel zu werden. Vergessen offenbar die einstmals so emphatisch betonte »Kultur der Zurückhaltung«, in der sich die bitter gelernten Lektionen einer in der Katastrophe kulminierten deutschen Politik mit kriegerischen Mitteln niedergeschlagen hatten. Ab sofort heißt es wieder: „Germans to the Front!“
Vor nunmehr sieben Jahren, als nach dem Ende des Kalten Krieges der Auftrag der deutschen Streitkräfte neu definiert wurde, formulierte der damalige Außenminister Klaus Kinkel einen Katalog politischer Prinzipien für eine Beteiligung der Bundeswehr an internationalen Militäraktionen1, welcher den ehemaligen, aber nunmehr offenbar überholten sicherheitspolitischen Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland widerspiegelte. Im Wesentlichen hatte sich diese Republik in einem langwierigen, bis vor das Bundesverfassungsgericht getragenen Disput auf folgende Prämissen verständigt, die erfüllt sein müssten, bevor die Bundeswehr in den Einsatz geschickt würde:
Erstens käme eine Beteiligung an internationalen Militäreinsätzen nur dann in Frage, wenn sie völkerrechtlich eindeutig zulässig wäre. Nur so wäre sichergestellt, dass durch solche Einsätze das Recht gewahrt und nicht neues Unrecht geschaffen würde. „Nichts schlägt so leicht in Barbarei um, wie der selbstgerecht geführte Kreuzzug gegen vermeintliche oder wirkliche Barbaren.“ (Rudolf Walther)2
Zweitens würde Deutschland solche Einsätze niemals alleine unternehmen, sondern sich nur im gemeinsamen Verbund mit anderen Partnern an Militäroperationen beteiligen, primär im Rahmen bestehender internationaler Institutionen wie z. B. UNO, OSZE, NATO oder WEU.
Drittens müssten folgende Fragen befriedigend beantwortet sein: Gibt es ein klares Mandat? Ist die militärische Aktion in sinnvoller Weise in ein umfassendes politisches Lösungskonzept eingebettet? Sind die verfügbaren Mittel hinreichend, um einer solchen Mission zum Erfolg zu verhelfen? Ist die Verhältnismäßigkeit zwischen dem erstrebten Ziel und den möglicherweise in Kauf zu nehmenden Zerstörungen gewahrt? Gibt es eindeutige Erfolgskriterien und damit eine absehbare zeitliche Begrenzung? Bestehen Überlegungen für den Fall, dass der angestrebte Erfolg sich wider Erwarten doch nicht erreichen lässt?
Viertens müssten je mehr es in Richtung Kampfeinsätze ginge, desto zwingender die Gründe sein, die eine deutsche Beteiligung erforderten. Je höher das Risiko für die Soldaten, um so höher müssten die Werte sein, die es zu verteidigen gälte. Das geforderte Risiko, unter Umständen auch für das eigene Leben, müsste für die eingesetzten Soldaten, aber auch für die Bevölkerung zu Hause, als sinnvoll und zumutbar empfunden werden.
Fünftens bedürfte die Teilnahme deutscher Streitkräfte an internationalen Militäreinsätzen gemäß der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes der parlamentarischen Zustimmung. Angesichts der politischen Tragweite solcher Einsätze und der möglichen Gefährdung der Soldaten wäre ein parteiübergreifender Konsens anzustreben. Der »Dienst am Frieden« sollte einigend wirken und nicht Anlass zu neuen Kontroversen geben.
Sechstens dürfte eine deutsche Beteiligung nicht konfliktverschärfend wirken. Dies könnte vor allem der Fall sein, wenn in den Einsatzregionen aus der Zeit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkrieges noch besondere Animositäten lebendig seien.
Legt man diesen Kriterienkatalog an den bevorstehenden Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan an, so drängen sich eine Reihe von Zweifeln auf. So scheint prima facie eine klare völkerrechtliche Grundlage für den Krieg gegen Afghanistan zu existieren, hat doch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach den Terroranschlägen von New York und Washington in mehreren Resolutionen das Recht auf Selbstverteidigung nach Art. 51 der UN-Charta bekräftigt und die NATO den Bündnisfall nach Art. 5 des NATO-Vertrages konstatiert. Eine genauere Analyse der einschlägigen Resolutionen Nr. 1368 vom 12. September 2001 sowie Nr. 1373 vom 28. September 2001 ergibt indessen, dass aus diesen mitnichten ein Freibrief zum uneingeschränkten Bombenkrieg gegen Afghanistan hervorgeht. Ganz im Gegenteil: Statt die Staaten zu einem solchen Krieg zu ermächtigen, fordert der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Staaten ganz konkret auf, zusammenzuarbeiten, um die Täter, Organisationen und Förderer der Terroranschläge von New York und Washington der Strafjustiz zuzuführen. Nicht völkerrechtliche Sanktionen gegen Staaten, sondern das internationale Strafrecht bezogen auf individuelle Personen erachtet demnach der Sicherheitsrat in der Resolution Nr. 1368 als adäquates Instrumentarium der Terrorismusbekämpfung.3 Besonders stellt der Sicherheitsrat darüber hinaus in seinen Resolutionen darauf ab, dass die Bekämpfung des internationalen Terrorismus’ in Übereinstimmung mit den Regelungen der UN-Charta und ausschließlich unter Anwendung rechtmäßiger Mittel zu geschehen habe.
In der Tat stellen die terroristischen Akte vom 11. September 2001 Verbrechen dar – Helmut Schmidt nennt sie zu Recht „Mammut-Verbrechen“4 –, begangen von kriminellen Tätern. Deren Ergreifung und Aburteilung indes fällt unter die Prärogative von Polizei und Justiz, nicht aber die des Militärs. Wer demgegenüber auf eine Terrorbekämpfung zuvörderst mittels militärischer Gewaltanwendung setzt, entwertet das Instrumentarium ziviler Konfliktregelung und kompromittiert die Idee von der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen.5 Noch größere Irritationen muss in diesem Kontext auslösen, wenn gerade die USA, die so betont das Wort »Gerechtigkeit« im Munde führen – man erinnere sich, dass die ursprüngliche Bezeichnung für den Anti-Terrorkrieg »Infinite Justice« lauten sollte –, mit aller Macht die Etablierung des 1998 in Rom beschlossenen Internationalen Strafgerichtshofes der Vereinten Nationen hintertreiben6. Letztlich muss es geradezu bizarr wirken, wenn eine Nation, die sich strikt weigert, gegebenenfalls die Aburteilung eines eigenen Staatsbürgers im Falle des Völkermordes, schwerster Kriegsverbrechen oder der Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor einem zukünftigen Internationalen Strafgerichtshof der Vereinten Nationen zuzulassen, zugleich das Recht beansprucht, die Auslieferung eines von ihr terroristischer Verbrechen Beschuldigten herbeizubomben, noch dazu ohne der Weltöffentlichkeit bisher stichhaltige, gerichtsfeste Beweise vorgelegt zu haben.
Auf den Punkt gebracht ergibt sich aus der völkerrechtlichen Analyse des Problemkomplexes »Internationaler Terrorismus«, dass, solange keinem einzelnen Staat oder einer Staatengruppe eine Handlung zugerechnet werden kann, die einem bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 der UN-Charta gleichzustellen ist, eine gesicherte völkerrechtliche Legitimation für militärische Maßnahmen nicht existiert – und zwar weder für die USA noch für die NATO.7 Im Hinblick auf die erstgenannte Voraussetzung für den Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan bleibt demnach festzuhalten, dass dieser auf einer völkerrechtlich schwankenden Grundlage steht, zumindest aber das Kriterium der eindeutigen Zulässigkeit nicht erfüllt.
Das Kriterium zwei ist erfüllt, da die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Streitkräften im NATO-Bündnis und darüber hinaus im Kontext einer geradezu weltumspannenden Koalition gegen den Terror agiert. Allerdings bleibt zu monieren, dass sich in dieser viel zitierten Koalition doch einige, gelinde ausgedrückt, schillernde Figuren befinden oder auch mit welcher Nonchalance aus Schurken Alliierte werden.
In Bezug auf das dritte Kriterium drängen sich die gravierendsten Einwände gegen die Teilnahme deutscher Soldaten am Anti-Terrorkrieg auf. Neben dem Umstand, dass es kein gesichertes völkerrechtliches Mandat für einen solchen Einsatz gibt, bleibt die Frage nach der politischen Zielsetzung dieses Krieges bis dato im Dunkeln. Da die direkten Angriffe auf die terroristische Infrastruktur Osama bin Ladens in den ersten Kriegswochen nicht den beabsichtigten Erfolg brachten, wechselten die USA ihre Strategie, vernichteten zunächst das Taliban-Regime und bombten die Vertreter der so genannten Nord-Allianz zurück an die Macht.
Die Paradoxie einer solchen Vorgehensweise illustriert der Umstand, dass die USA selbst gemeinsam mit Pakistan und Saudi-Arabien die Taliban Mitte der neunziger Jahre an die Macht gebracht haben. Damals meinte man den Bürgerkrieg, der Afghanistan in ein unerträgliches Chaos gestürzt hatte, beenden zu können, indem man mit Hilfe der Taliban eben jene Warlords, Stammesfürsten und Clanchefs von der Macht vertrieb, die man heute wieder in Amt und Würde bomben möchte. Welch absurde Logik, zunächst Beelzebub mit Satan zu vertreiben und jetzt wieder Satan mit Beelzebub. Trotz intensivster diplomatischer Bemühungen ist eine tragfähige politische Konfliktlösung für Afghanistan bis heute nicht einmal im Ansatz zu erkennen. Krieg ohne ein klares politisches Ziel zu führen, ist nach Clausewitz ein Kardinalfehler. Krieg bedeutet dann nämlich nicht die „Fortführung der Politik unter Einmischung anderer Mittel“, sondern die Abdankung von Politik und die Erhebung militärischer Gewaltanwendung zum Selbstzweck. Eine derartige Vorgehensweise lässt sich dann wohl mit Fug und Recht als Abenteurertum bezeichnen – und daran wollte sich diese Republik ja eigentlich nicht beteiligen, wenn man den Bundeskanzler richtig verstanden hat.
Darüber hinaus gibt aber auch die Art und Weise der militärischen Operationsführung zu erheblichen Zweifeln an deren Sinnhaftigkeit Anlass. Festzustellen ist zunächst, dass der Krieg in und über Afghanistan gemäß dem von den USA seit dem Golfkrieg 1991 entfalteten neuen Paradigma geführt wird; ein Schlüsselbegriff hierzu lautet »Revolution in Military Affairs«. Diesem Paradigma zufolge werden Kriege mit Hilfe von High tech-Waffensystemen, auf welche die USA und ihre Rüstungsindustrie ein Quasi-Monopol besitzen, aus der Distanz, mit überlegenen, weltraum- und luftgestützten Aufklärungsmitteln, modernster Informations- und Führungstechnologie sowie konkurrenzlos überlegenen Luftkriegsmitteln geführt, wobei eigene Verluste vermieden und gegnerische minimiert werden sollen. Bodengebundene US-Streitkräfte, die, wenn überhaupt, dann in geringer Stärke zum Einsatz kommen, dienen vornehmlich der Unterstützung des Luftkrieges mittels Aufklärung und Zielbeleuchtung sowie sonstigen Spezial- oder Kommandooperationen. Zudem streben die USA an, dass die Verbündeten oder jeweiligen Koalitionspartner deren Streitkräfte für den stets mit erheblichen Verlustrisiken verbundenen Einsatz am Boden bereitstellen. Schon der Verlauf des Kosovokrieges demonstrierte, wie effektiv dieses neue Paradigma der Kriegführung in die Tat umgesetzt wurde, und der Krieg in Afghanistan liefert eine erneute Bestätigung für dessen Wirkungsmächtigkeit.
In der Realität des Krieges gegen Afghanistan resultiert aus einer solchen Doktrin, dass ein ohnehin unbewohnbares Land noch unbewohnbarer gemacht wird. Während der Weltöffentlichkeit suggeriert wurde, dass die U.S.-Airforce selektiv und präzise die Infrastruktur von Osama bin Ladens Al Qaida sowie das rudimentäre Militärpotenzial der Taliban zertrümmerte, meldete der amerikanische Fernsehsender NBC unter Berufung auf einen hochrangigen Offizier der US-Streitkräfte, dass die US-Luftwaffe die entsprechend völkerrechtlicher Regularien deutlich gekennzeichneten Lager des IKRK in Afghanistan vorsätzlich bombardiert habe, um die dort deponierten Lebensmittel und Hilfsgüter nicht in die Hände der Taliban fallen zu lassen.8 Nach der Genfer Konvention inklusive Zusatzabkommen fallen vorsätzliche Angriffe auf humanitäre Einrichtungen unter die Kategorie der Kriegsverbrechen. Insgesamt sollen mehr als achtzig Prozent der IKRK-Strukturen in Afghanistan zerstört worden sein.9 Symbolhaften Gehalt besaß schon die Zerstörung eines Büros der Vereinten Nationen in Kabul zu Beginn der Bombardierungen, wobei vier lokale Mitarbeiter, deren Aufgabe darin bestand, im Rahmen eines humanitären UNO-Projektes Minen zu räumen, getötet worden waren.
Trotz der schnellen und effektiven Zerstörung der sehr begrenzten Anzahl militärischer Ziele von strategischer Bedeutung in den ersten Kriegswochen hatte sich das Taliban-Regime als äußerst widerstandsfähig erwiesen, wie das Pentagon zu seiner Überraschung zuzugeben genötigt war. Die U.S. Airforce ging daher dazu über, den Truppen der Nordallianz den Weg durch die Stellungen der Taliban freizubomben, wobei die Taktik des so genannten square bombings sowie Clusterbomben zum Einsatz gelangten. Darüber hinaus dürften auch die berüchtigten »Fuel-Air-Explosives« zur Anwendung gekommen sein, Aerosolbomben, die eine enorme Druckwelle erzeugen und Menschen – im Jargon der Militärs als »weiche Ziele« bezeichnet –, die sich in deren Wirkbereich befinden, die inneren Organe zerfetzen. Da die Kämpfe auch weiterhin nicht in einer menschenleeren Wüstenei stattfinden, sondern durchaus auch Siedlungen im Kampfgebiet liegen, führt diese Veränderung der operativen Konzeption dazu, dass mitunter ohne Rücksicht auf die örtliche Zivilbevölkerung ganze Dörfer umgepflügt und eingeäschert werden.
Ein weiterer Effekt des Krieges gegen Afghanistan liegt darin, dass Millionen Flüchtlinge angesichts der desaströsen Ernährungslage und des einsetzenden Winters dem Hunger- und Kältetod ausgesetzt sind, da die humanitären Hilfsorganisationen angesichts der Kriegshandlungen nahezu zur Untätigkeit verurteilt waren. In der Konsequenz bedeutet die Art der Kriegführung in Afghanistan, dass die gesamte afghanische Bevölkerung – Männer, Frauen, Kinder, Alte – quasi in Geiselhaft genommen wird für eine Handvoll Terroristen, die auf afghanischem Territorium operieren. Indem solchermaßen die Conditio sine qua non der Verhältnismäßigkeit von intendiertem Zweck und selektierten Mitteln schlechterdings ignoriert wird, ist der Krieg gegen Afghanistan, so wie er derzeit geführt wird, mit dem Völkerrecht und dem Kriegsvölkerrecht nicht zu vereinbaren.
Darüber hinaus lässt er sich auch unter moralischen Aspekten nicht rechtfertigen, weil er nämlich der Maxime folgt, es sei erlaubt, Unschuldige zu töten um andere Unschuldige zu rächen und potenzielle Opfer zukünftiger terroristischer Anschläge zu retten. Ein derartiges Kalkül ist selbstredend absurd. Wer weiterhin für uneingeschränkte Solidarität mit den USA im Krieg gegen Afghanistan plädiert, muss wissen, dass er damit einer unhaltbaren moralischen Maxime folgt.
Neben dem unermesslichen Leid, das der Krieg hervorbringt, ist er zudem unter politischen Aspekten völlig kontraproduktiv, da er nämlich das Gegenteil dessen bewirken wird, was eigentlich erreicht werden soll. Jeder von der westlichen Kriegsmaschinerie getötete Zivilist nährt den Hass in der islamischen Welt und treibt den Rattenfängern des Terrorismus neue Gefolgsleute zu. Militärische Gewaltanwendung ändert nicht das Geringste an den Ursachen für das Entstehen von Denkschablonen und Handlungsmustern, gemäß denen die Protagonisten im Heiligen Krieg gegen eine als gottlos und zutiefst ungerecht empfundene Welt ihre heldenhafte Selbstaufopferung unter Maximierung feindlicher Verluste zum höchsten Ziel erheben. Wie man es auch dreht und wendet: Mit Bomben und Raketen lässt sich die Spaltung der Welt in Arm und Reich nicht überwinden, mit einem »Kreuzzug gegen den Terrorismus« kein gerechter Frieden schaffen, mit militärischer Gewalt der Kampf um die Köpfe und Herzen der Menschen in der islamischen Welt nicht gewinnen.
Gewendet auf die eingangs aufgeworfene Fragestellung nach den Erfolgskriterien der militärischen Intervention resultiert aus den aufgezeigten Defiziten und Dilemmata, dass jene mitnichten in zufriedenstellender Weise beantwortet ist, sondern im Gegenteil höchst unklar bleibt. Darüber hinaus lässt sich auch überhaupt kein Ende des Krieges absehen, ganz im Gegenteil wird von offizieller Seite stets betont, dass der Kampf gegen den internationalen Terrorismus von sehr langer Dauer sein wird. Und schließlich sind bisher keinerlei Überlegungen betreffend eine so genannte Exit Strategy bekannt. Die kürzlich überraschend erzielten militärischen Erfolge gegen das Taliban-Regime bedeuten nämlich noch längst nicht die siegreiche Beendigung des Krieges in Afghanistan und schon gar nicht den Sieg im Kampf gegen den Terrorismus.
Zusammengefasst ergibt die Analyse von Kriterium Nummer drei des oben explizierten Prinzipienkatalogs, dass sich für keine der dort subsumierten Fragen eine zufriedenstellende Antwort findet. Eine Entsendung von Bundeswehrsoldaten in den Krieg gegen Afghanistan erscheint somit weder als zweckmäßig noch als gerechtfertigt. Auch die vierte Forderung stellt eine Schlüsselfrage dar: Sind die Gründe für das eventuelle Opfer deutscher Soldaten auf dem Schlachtfeld in Afghanistan wirklich zwingend? Rechtfertigen die terroristischen Attacken in den USA, wie grauenhaft und menschenverachtend sie sich auch immer darstellen, zweifelsfrei einen Kampfauftrag für die Bundeswehr und gibt es tatsächlich keinerlei Dissens über die Sinnhaftigkeit eines derartigen Kampfeinsatzes? Dies ist, beobachtet man die aktuelle politische Debatte sowie die Berichterstattung in den Medien, keineswegs der Fall. Ganz im Gegenteil, denn erstens ist zu konstatieren, dass in der demokratischen Öffentlichkeit in Anbetracht der politischen und militärischen Imponderabilien seit Wochen Skepsis und Kritik am Krieg der USA und Großbritanniens in Afghanistan wachsen. Zweitens aber lässt die von der Bundesregierung deklarierte Politik nach der Devise »uneingeschränkter Solidarität« mit den USA den Verdacht aufkeimen, dass es gar nicht so sehr die USA waren, die einen militärischen Beitrag der Bundeswehr unbedingt eingefordert haben, sondern vielmehr Gerhard Schröder und Joschka Fischer diesen den USA geradezu aufgenötigt haben, um Einfluss und Mitsprache Deutschlands im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zu bekommen.10 Dies mag man für politisch durchaus klug und zweckmäßig halten, dann sollte man es getreu dem Gebot der Wahrhaftigkeit der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit und den Soldaten der Bundeswehr aber auch so erklären.
Was die fünfte Forderung des Prinzipienkataloges betrifft, so hat nur eine äußerst knappe Mehrheit des Deutschen Bundestages dem Kampfeinsatz der Bundeswehr in Afghanistan zugestimmt. Die Art und Weise, wie dieser Beschluss seitens des Bundeskanzlers dem Parlament abgepresst wurde, bedeutet tendenziell ein Unterlaufen des vom Bundesverfassungsgericht mit Bedacht in sein Urteil vom 12. Juli 1994 formulierten Parlamentsvorbehaltes für den Einsatz der Bundeswehr jenseits der Landesgrenzen. Zugleich ist hinsichtlich der politischen Kontrolle des deutschen Militärs eine ganz klare und besorgniserregende Machtverschiebung weg von der Legislative und hin zur Exekutive zu konstatieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Kontroverse um den bevorstehenden Kampfeinsatz deutscher Soldaten andauern und sich im weiteren Verlauf des Krieges eher noch verschärfen. Im Hinblick auf die Legitimation des Bundeswehreinsatzes einerseits, die Moral der Truppe andererseits dürften sich aus diesem Sachverhalt nicht unerhebliche negative Implikationen ergeben.
Das letzte Kriterium, dass nämlich eine Beteiligung Deutschlands an einem Konflikt sich unter Berücksichtigung der besonderen historischen Spezifika deutscher (Militär-)Geschichte nicht verschärfend auswirken dürfe, erscheint im afghanischen Kontext eher irrelevant, da die Horden des Dritten Reiches bis in jene fernen Regionen nicht vorgedrungen waren.
Das abschließende Resümee im Hinblick auf die Erfüllung der einstmals so explizit reklamierten Prinzipien für einen Einsatz deutscher Streitkräfte fällt, was den Krieg in Afghanistan anbetrifft, sehr ernüchternd aus: Die Perspektive, auf dem Altar ominöser nationaler Interessen geopfert zu werden, wird in den Streitkräften jetzt und in der Zukunft erhebliche Zweifel sowohl am Sinn als auch an der Legitimität militärischen Dienens aufkommen lassen. Zusammengenommen mit der unübersehbar im Scheitern begriffenen Bundeswehrreform könnte sich daher die Lage für die deutschen Streitkräfte in ungeahnt prekärer Weise entwickeln.
Anmerkungen
1) Vgl. hierzu Kinkel, Klaus: Die Rolle Deutschlands bei Friedensmissionen, in: NATO-Brief, Oktober 1994, S. 6f.
2) Walther, Rudolf: Die Fiktion vom sauberen Waffengang, in: Die Zeit, Nr. 32, 2. August 2001, S. 41.
3) Vgl. hierzu Stuby, Gerhard: Internationaler Terrorismus und Völkerrecht, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 11/2001, S. 1333.
4) Vgl. Schmidt, Helmut: Das Mammut-Verbrechen, in: Die Zeit, Nr. 38, 13. September 2001, S. 1.
5) Vgl. Garzón, Baltasar: Die einzige Antwort auf den Terror – Bomben auf Kabul, Spezialkommandos, Jagd auf die Taliban: Das dient zuerst dem Wunsch nach Rache für den 11. September. Erfolg aber verheißt nur die Sprache des Rechts und der Richter, in: Die Zeit, Nr. 44, 25. Oktober 2001, S. 11.
6) Vgl. Schmidt-Häuer, Christian: Den Freunden ins Auge gestochen – Die amerikanische Regierung unterstützt das Gesetz gegen den Internationalen Strafgerichtshof und brüskiert die Vereinten Nationen, in: Die Zeit, Nr. 43, 18. Oktober 2001, S. 4.
7) Vgl. hierzu Stuby, Gerhard: Internationaler Terrorismus und Völkerrecht, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 11/2001, S. 1334.
8) Vgl. Rupp, Rainer: Im Visier: Rotes Kreuz. USA bombardieren Lager in Kabul absichtlich, in: Neues Deutschland, Nr. 256, 3./4. November 2001, S. 3.
9) Vgl. die entsprechende Meldung in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 252, 2. November 2001, S. 4; dort wird unter der Rubrik »Blick in die Presse« die französische Zeitung L’Humanité wie folgt zitiert: „Durch die US-Luftangriffe in Afghanistan wurden 80 Prozent der Infrastruktur des Roten Kreuzes zerstört, irrtümlich, wie die US-Regierung sagt. Doch ist der Irrtum nicht Wesenselement der amerikanischen Strategie? Am Anfang sollten die Ausbildungslager der Terrororganisation zerstört und bin Laden gefangen werden, jetzt beobachten wir eine Art ‚Startegie der Angst‘ mit Bombardierungen, damit sich die Bevölkerung von den Taliban abwendet.“
10) Vgl. hierzu den höchst aufschlußreichen Artikel von Josef Joffe in: Die Zeit, Nr. 47, 15. November 2001, S. 3. Dort wird die Leitung des DoD’s wie folgt zitiert: „Unser größtes Problem ist derzeit, dass wir die mannigfach angebotene Militärhilfe gar nicht richtig assimilieren und eingliedern können. (…) Wir erwarten nicht von jedem Land, dass es sich überall und immerdar beteiligt.“
Dipl. Päd. Jürgen Rose ist Oberstleutnant der Bundeswehr. Er ist gezwungen darauf hinzuweisen, dass er in diesem Beitrag nur seine persönlichen Auffassungen vertritt.