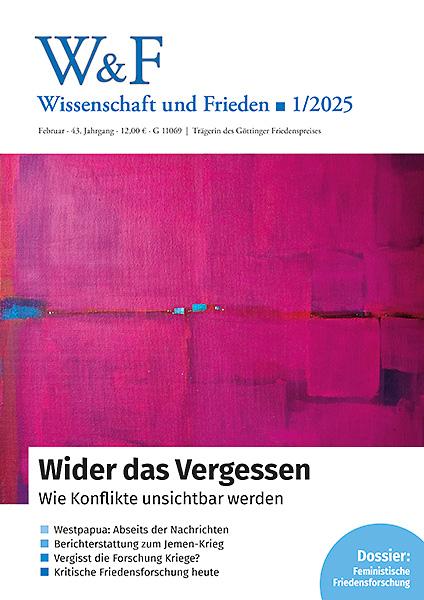Wer hat Angst vor Normativität?
Strategietagung des Arbeitskreis Historische Friedens- und Konfliktforschung, Universität Köln, 21.-22. November 2024
Die Historische Friedens- und Konfliktforschung (HFKF) zeichnet sich „durch eine am Friedensideal orientierte Normativität aus.“ (CfP der Tagung). Die Strategietagung des Arbeitskreises für Historische Friedens- und Konfliktforschung (AKHF) hatte daher zum Ziel, die Rolle dieser Normativität zu hinterfragen, aber auch die Europazentriertheit des Bereichs etwas zu lösen und epochenübergreifend zu arbeiten. Nicht alle diese Ziele wurden gleichermaßen erreicht: So fehlten außereuropäische Perspektiven weitgehend und Debatten um die historisch relevante Rolle von Gender und Diversität waren gar nicht vertreten. Dennoch war die Tagung ein Gewinn, denn gleich schon zu Beginn brach Petra Goedde in ihrer Keynote Lecture mit der Prämisse der Konferenz. Normativität sei nicht das zentrale Anliegen der Friedens- und Konfliktforschung. Auch die »allgemeine« Geschichtswissenschaft sei nicht frei von Normativität, und Normativität sei auch kein spezifisches Problem der Friedens- und Konfliktforschung. Zusammenfassend argumentierte Goedde, dass zentrale Anliegen der HFKF sein müssten, die Geschichte der Opfer bzw. Betroffenen von Gewalt, Krieg und Konflikten der Vergangenheit in den Vordergrund zu rücken, Analysen zu historischen Begriffsverwendungen von »Frieden« anzubieten und herauszuarbeiten, wie dies heute geschieht. Die Aufgabe der HFKF solle es nicht sein, Normen zu setzen oder Frieden in der Zukunft zu schaffen, sondern Wegweiser für moralisches Verhalten in der Gegenwart zu präsentieren.
Die drei nacheinander laufenden Panel der Konferenz standen für diese Frage der Suche nach den Wegweisern. Im ersten Panel der Konferenz, »An Kriege erinnern«, versuchten die Referent*innen die Frage nach der Funktion und den Formen des Erinnerns und deren Normativitäten zu beantworten. Die vier Vorträge blickten auf sehr unterschiedliche Erinnerungsprozesse, von Weltkriegserinnerung in Polen zur Erinnerung an die Militärdiktatur in Argentinien. In der Gesamtschau wurde in allen vier Beiträgen deutlich, dass gerade die nachträglichen Einordnungen und ihre (legitimierenden) Begrifflichkeiten systematisch mit den je entworfenen Bildern von Frieden und Versöhnung korrespondieren. So zeigte Maciej Górny am polnischen Beispiel, dass die sehr deutlich unterschiedliche Erinnerung an die beiden Weltkriege in der polnischen Gesellschaft doch gleichermaßen über viele Jahrzehnte exkludierend gewesen sei, mit einer Aufteilung in polnische und nicht-polnische Veteran*innen (wobei letztere oft verachtet wurden), feindlichen Einstellungen gegenüber Intellektuellen sowie geprägt war von grassierendem Nationalismus. Laut Górny gebe es jedoch Grund zum Optimismus, denn die Erinnerungskultur bewege sich inzwischen in eine deutlich andere Richtung.
Daniel Stahl zeigte am Beispiel Argentiniens auf, dass gerade die Vorstellungen davon, ob Frieden schon sei, erst noch erreicht werden müsse oder ob er erst in vollständiger Gerechtigkeit liege, direkt mit den angestrebten Maßnahmen (ob also Aufarbeitung, Kriegsverbrecherprozesse, u.ä. als wichtig empfunden würden) korrespondierten. Gerade die auf Menschenrechte und Gerechtigkeit ausgerichteten Vorstellungen der Aufarbeitung hätten das Erinnern an die Militärdiktatur wesentlich vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Gerechtigkeit verändert. Inzwischen jedoch sei ein Backlash zu beobachten. Die Prozesse gegen die Militärherrscher sollen rückabgewickelt werden, anstatt von Staatsterrorismus oder Militärherrschaft zu sprechen sei wieder die Rede vom internen »Krieg« zurückgekehrt, und die Vorstellung einer innergesellschaftlichen Befriedung durch Amnestie werde wieder populärer.
Martin Günzel betrachtete als Erinnerungsarbeit die Rechtfertigungsversuche des ehemaligen Premierminister Tony Blair für seine Entscheidung, Großbritannien am Irakkrieg beteiligt zu haben. Obwohl Blair inzwischen zugestehe, dass der Irakkrieg ein Fehler gewesen war, verteidige er nicht nur den Krieg im Irak, sondern legitimiere rückwirkend diese Form der Außenpolitik nach 9/11. Die Erinnerung an den Irakkrieg diene auch der Begründung und Legitimierung dieser liberal-interventionistischen Vorstellung von Krieg und Friedenserzwingung – und natürlich nicht zuletzt auch der »Rettung« der Erinnerung an Blairs Amtszeit.
Sarah Rausch analysierte legitimierende Sprachbilder vor dem Hintergrund der Aufarbeitung kolonialer Vergangenheiten in Deutschland und Frankreich. Auch wenn es mittlerweile in beiden Ländern aktive Versuche der Aufarbeitung gebe und Versöhnung angestrebt werde, so müsse gefragt werden, ob Versöhnung eine Chance für den Frieden sei. Gerade wenn vermeintliche »historische Wahrheiten« durch einen Wettkampf um die »Wahrheit« und Deutungshoheit einzelner Akteur*innen angeblich gefährdet würden und die völkerrechtliche Anerkennung von Kriegsverbrechen oder Völkermord ausbleibe, könne Erinnerung nicht ausreichend sein. Rausch problematisierte, dass man ohne die Beteiligung der Betroffenengruppen aus den ehemaligen Kolonien von einer neo-kolonialen Erinnerungspolitik sprechen müsse.
Im zweiten Panel wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern eine Militärgeschichtsschreibung ohne normativen Friedensbezug überhaupt möglich sein könnte. Anke Fischer-Kattner präsentierte in diesem Zusammenhang einen interessanten Fall aus der Frühen Neuzeit. Nach der Belagerung von Philippsburg 1734 setzte sich der Schriftsteller und Gelehrte Johann Michael von Loën vor dem Hintergrund der vielen zivilen Toten für eine andere Form der Konfliktbearbeitung ein, da er den Festungsbau und die Gewaltexzesse des Festungskrieges für zu grausam hielt. Als Lösung für dieses Problem schlug er die Ernennung von Friedensrichtern vor. Fischer-Kattner fasste zusammen, dass Friedensnormen hier in einem engen Zusammenhang mit Gewalterfahrungen stünden.
Jan-Martin Zollitschs Vortrag sowie Hendrik Simons Vortrag problematisierten die allgemein verbreiteten Vorstellungen von der Kriegsgewaltslogik im 19. Jahrhundert, demnach es ein naturrechtlich hergeleitetes »Recht zum Kriege« gegeben hätte und als natürlicher Austrag verstanden worden sei. In Zollitschs Fall am Beispiel des Deutsch-Französischen Krieges (1870/71) und in Hendrik Simons Fall am Beispiel liberaler Völkerrechtler aus dem »langen 19. Jahrhundert« wurde sehr deutlich, dass es vielmehr aus der Quellenlage ersichtlich wird, dass es große Bemühungen um Verregelung, Einhegung und Beschränkung der Gewalt gab. Dies drückte sich in Verschriftlichung von Normen (Zollitsch), der Entstehung humanitärer Organisationen für den Kriegsfall (Rotes Kreuz, Zollitsch) aber auch in den Debatten zum Kriegsvölkerrecht aus (Simon). Es gab rege Debatten über ein Kriegsverbot. Unter liberalen Juristen herrschte die Lehrmeinung, dass auf lange Sicht ein Kriegsverbot angestrebt werden müsse. Simon nutzte diese Debatten, um für eine stärker normativ ausgerichtete HFKF zu plädieren.
Christian Methfessel fokussierte auf umstrittene Gewaltexzesse und kontroverse Friedensverhandlungen in den Kolonialkriegen um 1900 aus Sicht der englischen und deutschen Öffentlichkeit. Gewaltexzesse, so debattierte man normativ, widersprächen europäischen, bzw. »zivilisierten« Normen. Durch die Betonung auf das zivilisierte Europa hätten allerdings auch kriegsgegnerische Stimmen koloniale Deutungsmuster europäischer Überlegenheit weiter verstärkt. Auch bei den Friedensverhandlungen konnte Methfessel Kontinuitätslinien zwischen der öffentlichen Meinung und der Bereitschaft zur Verhandlung herstellen. So wären im deutschen Fall nicht-europäische Gegner nicht als verhandlungsfähig angesehen worden. Das pro-koloniale Lager habe einen klaren Sieg erwartet, was zu heftigen Gewaltausschreitungen in den Kolonien führte.
Im dritten Panel beschäftigten sich die Tagungsteilnehmer*innen mit Friedensvorstellungen und Friedensprozessen und deren Normativität. Valentin Bardet behandelte die Diskussionen über den »Umgang mit Deutschland« während der französischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wesentliche Grundlage der Arbeit waren Quellen der Seminare des »Centre d’etudes Germaniques« (1946 bis 1950). In den dort verfassten Forschungsarbeiten zeigte sich die prekäre Balance zwischen Wissensproduktion und Aussöhnung. Auch wenn pragmatisch kooperiert wurde, blieb ein starkes Misstrauen gegenüber der deutschen Bevölkerung. Man könnte, laut Bardet, von Annäherung aber nicht von Versöhnung reden.
Um mehr unruhige Versöhnung ging es bei Christoph Lauchts Vortrag zu den Anfängen der Städtepartnerschaft von Kiel und Coventry (1945-1955). Nach dem Zweiten Weltkrieg warnte der Kieler Bürgermeister Andreas Gayk vor dem Wiederaufstieg des Nationalismus. Ihm war die Völkerverständigung wichtig und Versöhnung sei die wichtigste Waffe gegen diese Tendenzen. Hierfür gründete Gayk zusammen mit engagierten Kieler Bürger*innen die »Gesellschaft der Freunde Coventrys«. Die Gruppe schmiedete Pläne zur Friedenserhaltung, setzte sich für einen Lehrstuhl in Kiel für Friedensforschung ein, und gründete die Kieler Woche, deren erstes Motto »Kiel im Aufbau« war. Trotz all dieser Erfolge rückte die Zukunftsorientierung der Initiative auch die Nazivergangenheit mehrerer Erneuerer Kiels in den Hintergrund.
Regina Stuber zeigte im letzten Vortrag der Tagung die normativen Muster und Denkfiguren im Kontext des Großen Nordischen Krieges (1700-1721) auf. Sie konzentrierte sich dabei auf die Friedenskonzeptionen Zar Peters I. Seine stark normativ geprägten Konfliktlösungsideen sollten die Ruhe im Heiligen Römischen Reich bewahren. Hierbei fungierten auch Gelehrte wie Gottfried Wilhelm Leibniz als praktische Diplomaten. In den überlieferten Quellen wird ersichtlich, wie diese Diplomaten normative Begriffe wie »Ruhe und Sicherheit« gezielt einsetzten. Laut Stuber lässt sich so zeigen, dass die Friedens- und Allianzkonzeptionen des Zaren an die europäischen Diskurse adaptiert wurden, die zu der Zeit stark von Normativität geprägt waren.
Am Ende konnte die Konferenz die Frage nach dem Stellungswert von Normativität in der modernen Friedens- und Konfliktforschung zwar nicht beantworten, aber viele Denkanstöße bieten, auch über die Rolle von Historiker*innen in der Öffentlichkeit.
Anna E. Gehl