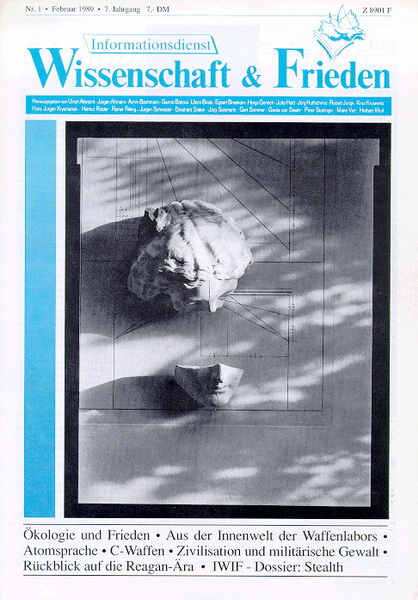Wo Amerika heute liegt
Ein Rückblick auf die Ära Reagan
von Bernd Greiner
Niemand wird bestreiten, daß sich die politische Landschaft Amerikas gewaltig verändert hat. 1989 ist nicht 1979, von 1969 ganz zu schweigen. Was aber ist heute anders? Wann wurde das Alte vom Sockel gestoßen? Und warum? Wer war die treibende Kraft? Es lohnt sich, bei amerikanischen Querdenkern nachzulesen, z.B. bei Journalisten wie Thomas Edsall und Hedrick Smith, Ökonomen wie Gar Alperovitz, Barry Bluestone und Bennett Harrison, Politikwissenschaftlern wie Philip Stern, Thomas Ferguson und Joel Rogers oder Soziologen wie Michael J. Weiss. Ihr Befund: Als Ronald Reagan 1980 die Bühne betrat, waren die Rollen bereits verteilt. Ihm blieb nichts weiter übrig, als die neuen Spielregeln vom Teleprompter zu verlesen und dem Publikum vorzugaukeln, es seien die eigenen. Die Reaganauten stellten keine Weichen. Ein politisches Original war der Kalifornier zweifellos – aber alles andere als originell. Der Kaiser spielte in geliehenen Kleidern. Wer also den großen Umbau in Politik und Gesellschaft verstehen will, wird in den 80er Jahren nicht fündig werden. Der Wendepunkt liegt zehn Jahre vor Reagans Zeit. In den 70er Jahren wurden die Karten im politischen Machtpoker neu gemischt und die Koordinaten der politischen Ökonomie neu verlegt.
Die Umbrüche in den 70er Jahren
Der Startschuß kam aus Unternehmerkreisen: »Profit-Squeeze« hieß das magische Wort. In der Tat: In den 70er Jahren war es schwieriger geworden, Gewinne einzustreichen. Die Impulse der Kriegswirtschaft bleiben aus, nachdem die letzten Truppen aus Vietnam abgezogen waren; ein Kartell erdölproduzierender Länder diktierte die »terms of trade« für den wichtigsten Rohstoff; ausländische Konkurrenz eroberte Schritt für Schritt den amerikanischen Markt und verschonte auch das Allerheiligste nicht: Seit 1978 importierten die USA erstmals mehr Autos als sie exportierten. Das Ergebnis war absehbar und konnte Ende der 70er Jahre in den Statistiken abgelesen werden. Die Profite lagen damals niedriger als zu Beginn der 60er Jahre. Und ein neuerlicher »Kriegsboom«, der wie in den 30er, 40er, 50er und 60er Jahren rasche Abhilfe hätte schaffen können, war nicht in Sicht. Darin sieht Gar Alperovitz den wesentlichen Grund für die unerwartet aggressive Gegenwehr des Kapitals. Führende Unternehmen kündigten die seit Franklin Delano Roosevelts »New Deal« eingeübte »Sozialpartnerschaft« mit den Gewerkschaften und schalteten auf »soziale De-Regulierung« um. Gewerkschaftliche Vertretungsrechte werden ebenso bekämpft wie betriebliche Sozialleistungen und staatliche Vorschriften zum Umwelt- und Arbeitsschutz. Nachdem die Pharma- und Ölindustrien vorgeprescht waren, gab es kein Halten mehr. In großem Stil wurden Kapital und Ausrüstung in Niedriglohnländer oder in »gewerkschaftsfreie Räume« des amerikanischen Südens und Südostens verlegt. Billige und willige Arbeiter gab es dort zuhauf, stieg die Zahl der Einwanderer in dieser Zeit doch wieder markant an. Die Gewerkschaften waren völlig unvorbereitet. Sie wurden buchstäblich an die Wand gespielt – ein Vorgang, der Historiker und Sozialwissenschaftler noch lange beschäftigen wird. Bennett Harrison und Barry Bluestone sehen darin eine beispiellose ökonomische und soziale Polarisierung des Landes. Ob eine solche These haltbar ist, werden vergleichende historische Analysen zeigen müssen. Unstrittig ist allerdings, daß den Gewerkschaften scharenweise die Mitglieder davonliefen, ob in der Schwer- oder Konsumgüterindustrie, ob im Bergbau oder im Bauwesen. Ende der 70er Jahre war klar, daß von saisonalen oder konjunkturellen Schwankungen nicht die Rede sein konnte. Die Gewerkschaftsbewegung befand sich in einem (bis heute fortwährenden) epochalen Niedergang. In zehn Jahren verloren z.B. die United Steel Workers 46% ihrer Mitglieder (490.000) und die International Ladies' Garment Workers Union 42% (152.000); 260.000 gaben ihre Mitgliedskarten an die International Association of Machinists and Aerospace Workers zurück, 176.000 an die United Automobile Workers. In den neuen Wachstumsbranchen zwischen Dienstleistung und High Tech rieb man sich die Hände. Closed Shop? Nie gehört! Wer in die Gewerkschaft wollte, mußte sich anderweitig umschauen. Kein Wunder also, daß Mitte der 80er Jahre gerade noch 17,5% der Lohn- und Gehaltsempfänger gewerkschaftlich organisiert waren. (1954 waren es doppelt so viele gewesen).
Die jungen Reformer
Soziale und ökonomische Umbrüche rufen immer politische Reformer auf den Plan. Der Zangengriff des Kapitals hatte kaum begonnen, als eine »neue Generation« von Politikern selbstbewußt verkündete, sozialstaatliche Intervention und Umverteilung hätten ausgedient. Wer waren diese Reformer? Thomas Edsall und Hedrick Smith haben sie porträtiert. Sie sind jung, weiß, mittelständisch, wohlhabend, vom Vorstadtmilieu geprägt, pragmatisch und machthungrig; sie kennen Rassen- und Klassenkonflikte allenfalls aus dem Geschichtsunterricht, geben sich aber dennoch progressiv und alternativ; legen großen Wert auf politisches »Image« und »Symbolik«; lassen Heerscharen von Medienberatern, Meinungsforschern und PR-Agenten für sich arbeiten; und hecheln ständig dem Zeitgeist hinterher. Verständlich, daß ältere Kollegen in ihnen nur »show horses« sehen wollen. Aber die »show horses« fanden und finden Anklang. Warum? Wahrscheinlich, weil sie eine mittelständische Klientel verläßlich bedienen. Die Neuen zeigen Zähne, wenn die soziale De-Regulierung allzu weit getrieben wird und auf den Besitzstand des Mittelstandes überzugreifen droht. Über die Renten- und Krankenversicherung (»social security«) lassen sie nicht mit sich reden – eher sollen die Wohlfahrtsempfänger mit noch weniger auskommen; oder die Gewerkschaften auf neue Tarifverträge verzichten.
Prominent wurden die »jungen Reformer«, als sie die großen Themen der Zeit in Parteien und Parlamenten zur Sprache brachten: Frieden, Umwelt, Abtreibung, Homosexualität, Scheidung. Hier zeigten sie programmatisches Geschick. Ihr Aufstieg in den 70er Jahren stützte sich auf einen klassischen Polit-Poker mit den Konservativen: Bereitwillig überließen sie diesen die Agitation gegen Sozialstaat, regulierte Industriepolitik, Wohlfahrt und sonstige »unproduktive Ausgaben«. Zugleich vereinnahmten sie jene, die den Radikalismus der Konservativen in anderen Fragen nicht teilten. Der »unabhängige Wähler« war geboren: er votierte bei Präsidentschaftswahlen für die Republikaner, bei Abstimmungen zum Kongress für die Demokraten. Die Konservativen verstanden das Signal. Auf Dauer würden sie zum Kompromiß mit den »jungen Reformern« gezwungen sein.
Die Neuen konnten sich als politische Kraft etablieren, weil sie ihre Stellung institutionell absicherten. Zunächst eroberten sie Schlüsselstellungen innerhalb der Demokratischen Partei. Allgemeine Aufmerksamkeit war ihnen stets sicher, z.B. anläßlich der Parteitage. Traditionell benachteiligte Gruppen schickten starke Delegationen; Schwarze, Frauen und Umweltschützer konnten erstmals ein Wort mitreden. Die Kehrseite der Reform zeigte sich bei den Wahlen 1976 und 1978. Die Reformer hatten die alten Regeln nicht demokratisiert, sondern zu ihren Gunsten umgeschrieben. Die eingeschriebenen Mitglieder durchschauten immer weniger, nach welchen Kriterien die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters, des Gouverneurs, des Senators oder des Präsidenten aufgestellt wurden. Das Ergebnis: immer mehr weigerten sich, bei der Kandidatenkür der Partei mitzumachen. Insbesondere Schwarze und Wähler der Unterschicht blieben den Parteiversammlungen fern. Bald waren der Mittelstand oder die »high tech«-Demokraten unter sich. Entsprechend fielen jetzt auch die Wahlparolen aus.
Ein historischer Zufall verhalf den »jungen Reformern« zum endgültigen Durchbruch: der Watergate-Skandal. Des Republikaners Nixon und seiner Partei überdrüssig, schickten die Wähler 1974 und 1976 gleich dutzendweise »demokratische Reformer« in den Senat und das Repräsentantenhaus. Kaum gewählt, inszenierten diese auch im Parlament einen institutionellen Putsch. Washington erlebte ein politisches Erdbeben, als die alten »Machtbarone« im Kongreß abgewählt wurden. Einige von ihnen hatten seit den Tagen des »New Deal« die wichtigen Ausschüsse, in denen Haushalte verabschiedet und Gelder verteilt werden, beherrscht. Die Tage zentralisierter Macht waren, buchstäblich über Nacht, vorbei. Kompetenzen wurden auf eine Vielzahl von »subcommittees« verteilt. Wer dort den Vorsitz stellte, war auch klar: die neuen »high tech«-Demokraten.
Die Entstehung einer politischen Industrie
Die institutionelle Reform der Neuen war so widersprüchlich und janusköpfig wie ihr Programm. Die Entmachtung der selbstherrlichen und altersstarren Ausschußvorsitzenden wurde als überfälliger Schritt begrüßt und allenthalben mit Beifall aufgenommen. Wer daraus allerdings auf hehre Ziele der Reformer schloß, hatte sich geirrt. Transparenz und Abbau der Hierarchien war ihr Anliegen nicht, nur Mittel zum Zweck. Ihnen ging es vielmehr um den eigenen Aufstieg – und zwar auf schnellstem Wege. Die Kontrolle über diverse Unterausschüsse versprach Macht und Einfluß und war eine willkommene Sprosse auf der Karriereleiter.
Einfluß allein reichte allerdings nicht aus. Gefragt war Geld – so viel wie möglich und gleichgültig aus welcher Quelle. Die »jungen Reformer« waren (und sind) ständig in Geldnot, weil sie ihre Karrieren auf eigene Faust planten. Sie rühmen sich der ideologischen und politischen Unabhängigkeit, frei von organisatorischen Fesseln und sonstigen Verpflichtungen jener, die innerhalb der Parteiapparate geblieben waren. Aber derlei Befreiung hatte ihren Preis. Die Neuen mußten ihren eigenen Apparat aufbauen, Berater und Wahlhelfer bezahlen, Umfragen finanzieren und Werbematerial auf eigene Rechnung verschicken – vor allem aber Sendezeit im Fernsehen kaufen. Das Fernsehen löste die Parteiversammlung als politische Arena ab. Und kassiert dafür seit Jahren Unsummen. Zwischen 1974 und 1986, rechnet Hedrick Smith vor, stiegen die durchschnittlichen Wahlkampfkosten eines Mitgliedes im Repräsentantenhaus von 56.539 $ auf 334.222 $; war der Betreffende Senator, so hatte er 1986 3,3 Millionen Dollar aufzubringen, sechsmal mehr als 1974. Philip Stern hat nachgerechnet und festgestellt, daß ein Senator heute während seiner gesamten Amtszeit Woche für Woche durchschnittlich 10.000 (!) Dollar eintreiben muß. Die Suche nach Financiers gehört mittlerweile zu den wichtigsten Tätigkeiten eines Kongreßabgeordneten. Ab und an werden auch Ausschuß- oder Plenarberatungen abgebrochen, damit die Herren Termine mit ihren Sponsoren wahrnehmen können.
Das »große Geld« ließ sich eine solche einmalige Gelegenheit natürlich nicht entgehen – zumal es seit 1974 völlig legal war, Kongreßabgeordnete von privater Seite finanziell zu unterstützen. Also gelang es den Privaten, unmittelbar darauf Einfluß zu nehmen, wie sich die politischen Kräfte in Washington neu formierten. Alte parlamentarische Machtgefüge waren zusammengebrochen, die Parteien in den Hintergrund gedrängt. Wer in der Hauptstadt den Überblick behalten und Einfluß nehmen wollte, mußte auf einzelne Abgeordnete zugehen und sie für seine Sache gewinnen. Aus der ehemals beschaulichen Lobby-Arbeit wurde von einem Tag auf den anderen eine »politische Industrie«. Allerorten schoßen »Political Action Committees« (PAC) aus dem Boden. Sie sollten und würden fortan Funktionen übernehmen, die bisher den Parteien vorbehalten waren – d.h. in erster Linie zwischen politischen Interessengruppen und dem Kongreß »vermitteln«. PACs registrieren und mobilisieren seither Wähler, entwerfen Wahlkampfstrategien, werben in der Öffentlichkeit um Geldspenden, treten für den Kandidaten X oder gegen die Kandidatin Y auf. 1974 gab es erst 608 solcher PACs; zehn Jahre später waren weit über 4.000 registriert. 1974 griffen sie mit 12,5 Millionen Dollar in den Wahlkampf zum Kongreß ein, 1980 bereits mit 55,2 Millionen und 1982 mit 83,1 Millionen. Die Beträge haben sich mittlerweile vervielfacht.
Selbstverständlich versuchten alle Interessengruppen, ihre Anliegen über PACs zu steuern. Die Farmer wie die Gewerkschaften, die Verbraucher wie die Umweltschützer. Aber niemand war so rührig und erfolgreich wie »big business«. 1976 gab es 89 »corporate PACs«; vier Jahre später waren es dreizehnmal so viele, nämlich 1.200. Hinzu kamen 400 PACs, die für Unternehmerverbände arbeiteten. 1980 waren weit über die Hälfte der 500 größten Industrieunternehmen (»Fortune 500«) in Washington mit einem PAC vertreten. Großbetriebe im allgemeinen sowie Firmen aus hochmonopolisierten Branchen (Luft- und Raumfahrt) und aus staatlich regulierten Sektoren (Pharma- und Ölindustrie) wählten den direkten »Zugang« zu Abgeordneten, um die Gesetzgebung zu beeinflussen. Hedrick Smith zitiert mehrere Insider, die sich nicht scheuten, die Vorgänge beim Namen zu nennen: Es fehlte (und fehlt) nur noch ein Schritt zur Bestechung. PACs verlassen sich darauf, daß »ihre Abgeordneten« im Sinne der Firma oder des Industriezweiges abstimmen. Da die Parlamentarier auf das Geld angewiesen sind, geben sie diesen Verpflichtungen nach.
In der Tat ist die Bedeutung der PACs – und gerade der »corporate PACs« – kaum zu überschätzen. Mittels ihrer haben sich die großen Firmen »politisiert« und eine völlig neue politische Infrastruktur aufgebaut. Heute sind sie auf allen politischen Ebenen präsent, vom Rathaus bis zum Weißen Haus – als »Investmentbanker« (Hedrick Smith) der Politik. Anfang der 80er Jahre hatten mehr Handels- und Kapitalgesellschaften ihren Hauptsitz in Washington als in New York; Anfang 1989 waren es über 3.500 (mit insgesamt 80.000 Angestellten). Seit über zehn Jahren finden sie optimale Bedingungen für eine »De-Regulierung« der Arbeitsbeziehungen und der Betriebsverfassungen vor.
Die PAC-Manager wußten bald, wie Interessen optimal zur Geltung gebracht werden konnten. Sie statteten hauptsächlich Amtsinhaber mit üppigen Spenden aus – man kannte ihr Umfeld, sie würden sich nicht einarbeiten müssen, unterhielten seit Jahren gute Verbindungen, wußten stets, was über wen zu welchem Zeitpunkt in Washington machbar war. Parteizugehörigkeit spielte (und spielt) für die PACs also eine untergeordnete Rolle. Funktion und Einfluß eines Abgeordneten waren ihnen seit jeher wichtiger als ideologische Ausrichtung. „PACs buy access, not ideology“, heißt es in Washington. In den 80er Jahren flossen 88% der PAC-Gelder an Amtsinhaber beider (!) Parteien – mit dem Ergebnis, daß potentielle Herausforderer wegen Geldmangels erst gar nicht zur Wahl antraten. 1980 galten nur noch 16% aller Parlamentssitze als umkämpft; bei 84% standen die Sieger von vornherein fest. Davon profitierten auch die »jungen Reformer« des Parlamentsjahrgangs 1974. Seit nunmehr 15 Jahren sitzen sie, von PACs wohlbedacht, in ihren Ämtern. 1986 z.B. wurden 97,7% aller Amtsinhaber wiedergewählt. Sie wurden gewählt, weil sie das meiste Geld für PR-Arbeit ausgeben konnten, gegen die wirtschaftskonforme »De-Regulierung« nichts einzuwenden hatten und Steuererleichterungen verabschiedeten – aber auch, weil die »neue Generation« in ihren Reihen für eine liberale Interpretation der »social issues« (Abtreibung, Schulgebet, Justizreform) eintrat und damit für viele mittelständische Wählergruppen attraktiv blieb. Von ihnen allerdings Initiativen zugunsten der Arbeiterbewegung, der Armen, sozial Schwachen und Obdachlosen zu erwarten, ginge völlig an der Realität vorbei. Sie sind als Gegner des »Sozialstaates« großgeworden; einen »Rückfall« kann sich heute keiner mehr leisten – es sei denn, er riskiert PAC-Geld, Amt und Karriere.
Das Programm der Reaganauten
Als Ronald Reagan 1980 die Bühne betrat, war der Umbau der Parteien und des Parlaments abgeschlossen. Ein politischer Anachronist, wer damals noch für die Einheit von sozialer Reform und bürgerlichen Freiheitsrechten stritt. Dieser Liberalismus, die wichtigste politische Hinterlassenschaft Franklin Delano Roosevelts, hatte als organisierte politische Bewegung abgedankt. Reagan war die Folge eines jahrelangen Erosionsprozesses. Stück um Stück, für die Zeitgenossen kaum merklich, war seit den frühen 70er Jahren sozialliberales Terrain abgetragen worden. 1980 war aber auch klar: Die Reaganauten würden sich damit nicht zufriedengeben. Alte Bastionen zu schleifen, genügte ihnen nicht. Sie strebten nach der Hegemonie, wollten eine neue Epoche konservativer Herrschaft begründen und ihr einen unverwechselbaren Stempel aufdrücken. „You ain't seen nothing yet“ lautete die griffige, vom Präsidenten selbst in Umlauf gesetzte Parole.
Die Etappen waren festgelegt. Erstens mußten die juristischen Fundamente des »Wohlfahrtsstaates« eingerissen werden. In den 60er Jahren hatten die Reformregierungen in Washington den Widerstand des konservativen Blocks nur auf dem Verordnungswege brechen können. Damals war den Länderregierungen vorgeschrieben worden, wozu die Steuergelder des Bundes eingesetzt werden sollten: z.B. für Schulbusse, um eine rassisch integrierte Erziehung zu gewährleisten; z.B. für Therapie und Rehabilitierung, um neue Wege der Verbrechensbekämpfung zu gehen; z.B. für Ausbildungsprogramme zugunsten benachteiligter Jugendlicher. Unter diesem Schutz konnten soziale Organisationen gezielt Hilfestellung leisten. Mehr noch, in vielen Großstädten entstanden Selbsthilfegruppen, wurden Modelle autonomer Sozialarbeit entwickelt. Dieses System wollte Reagan abschaffen und durch einen »New Federalism« ersetzen. Die Länder sollten künftig allein entscheiden, zu welchem Zweck und in welcher Höhe Sozialleistungen gezahlt würden. Ein Mitspracherecht der Kommunen oder gar der Betroffenen war selbstverständlich nicht vorgesehen. Die »soziale Frage«, so hofften die Reaganauten, würde auf diese Weise dem linksliberalen Zugriff der Großstädte entzogen und damit »entpolitisiert«.
Zweitens wollten Reagans Konservative den Überbau umkrempeln und die ideologische Erblast der 60er Jahre beseitigen. Endlos lang war ihre Klageliste – von der libertinären Sexualmoral über die Abschaffung des Schulgebets bis hin zum eingeschränkten Verkauf von Schußwaffen. Am wichtigsten aber war »Vietnam«. Die »Schmach der Niederlage« überwinden, hieß, zu neuen Interventionen bereit zu sein. Hier einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen, wäre den Konservativen manches politische Opfer wert gewesen.
Anfänglich sah es so aus, als würde der Durchbruch gelingen. Meinungsumfragen fielen zu Reagans Gunsten aus; die Republikaner hatten erstmals die Mehrheit im Senat; das Land wurde mit einem Netzwerk konservativer Denkfabriken und »Political Action Committees"überzogen; die Intellektuellen hatten sich mehrheitlich ins konservative Lager geschlagen. Und Reagan ließ in den ersten Monaten seiner Amtszeit den Kongreß nach seiner Pfeife tanzen – wie vordem allenfalls Lyndon B. Johnson oder Franklin Delano Roosevelt. Das Gramm-Latta-Gesetz aus dem Jahr 1981 bestätigte die schlimmsten Vermutungen: Die unteren 20% der Einkommensskala hatten die Lasten der sozialen »De-Regulierung« zu tragen. Den »working poor« und Wohlfahrtsempfängern wurden Leistungen radikal beschnitten, ob Geld für Weiterbildung, Arztrechnungen, Medikamente oder Miete. 1980 waren 25,5% des Bundeshaushalts für diese Zwecke aufgewendet worden; 1987 waren es nur noch 18,3%. Wie Emma Rothschildt in der „New York Review of Books“ zeigte, wurde ein seit den 60er Jahren sorgsam geknüpftes Netz radikal zerschnitten.
Triumph der Politik über die Ideologie?
Aber schon bald trat das Unerwartete ein: Reagan hatte nur Luft für zwölf Monate. 1982 war die innenpolitische Kraft des »Reaganismus« gebrochen. Seit dieser Zeit, Jahr für Jahr, lehnte der Kongreß die Haushaltsentwürfe des Weißen Hauses ab und korrigierte die schlimmsten Auswüchse. David Stockman, der ehemalige Budgetdirektor, hat in seinem Buch „Triumph der Politik“ wortreich und wehleidig Klage geführt. Die Politik habe die Ideologie in die Schranken gewiesen und den »großen Entwurf« zunichte gemacht. Stockman hatte recht. Die Konservativen waren zu Kompromissen gezwungen, mußten zeitweise sogar den Rückzug antreten. Alle Versuche, stabile parlamentarische Mehrheiten zu schmieden, scheiterten kläglich. Auf Capitol Hill bestimmten ständig wechselnde Mehrheiten das Geschehen. Ungläubig und machtlos mußten die Reaganauten zusehen, wie ihre Initiativen in einem legislativen Dickicht und politischen »Guerilla-Krieg« konkurrierender Einzelinteressen untergingen.
Hedrick Smith sieht darin eine Folge der Parlamentsreformen aus den 70er Jahren. Die »jungen Reformer« sicherten sich damals Macht, Einfluß und Karrieren, indem sie den traditionellen Ausschüssen eine Vielzahl von »subcommittees« zur Seite stellten. Heutzutage muß eine Gesetzesvorlage Dutzende von Gremien durchlaufen. Endlich im Plenum des Repräsentantenhauses oder des Senats angelangt, kann sie jederzeit von einzelnen Abgeordneten zu Fall gebracht werden. Manche legen die Geschäftsordnung trickreich aus, andere halten stundenlange Redebeiträge (»filibusters«) oder legen das Hohe Haus durch Abwesenheit lahm.
Parteidisziplin wurde in Amerika noch nie großgeschrieben. Aber nie herrschte ein größeres Durcheinander als zu Reagans Zeiten. Bald machte das Wort vom „kompletten Zusammenbruch der Legislative“ die Runde. Die Abgeordneten fühlten sich weniger denn je ihrer Partei verpflichtet, geschweige denn dem Mann im Weißen Haus. Voten wurden vielmehr daran gemessen, ob sie dem Aufbau des eigenen politischen Apparates dienten, wie die Geldgeber dazu standen, welchen Kollegen eine Gefälligkeit zu erweisen war, wie sie im heimatlichen Wahlbezirk zu verkaufen waren. Die legislative Macht ist mittlerweile zersplittert und atomisiert – die Gründungsväter der Republik, die aus Angst vor anti-bourgeoisen Mehrheiten keine Parteien im Parlament sehen wollten, hätten ihre helle Freude daran. Hedrick Smith wählte den plastischen Vergleich mit einem Basketball-Spiel: Die Szenen im Kampf um die Macht wechseln blitzartig, Verteidigung und Angriff gehen fließend ineinander über, jeder kann sich in eine günstige Stellung bringen und punkten, keiner hat einen Stammplatz, und der Ausgang der Partie bleibt bis zum Ende offen.
Im Vergleich zu den 50er und 60er Jahren (von der Vorkriegszeit redet schon niemand mehr) ist das Präsidentenamt daher nicht wiederzuerkennen. Es ist machtloser denn je, nur ein Faktor unter vielen in einem Flickenteppich der Macht. Daher war es Reagan verwehrt, das Rad der Geschichte nach Belieben zurückzudrehen. Unter anderem und nicht zuletzt blieb der radikale Entwurf des »new Federalism« auf der Strecke. Das wichtigste Wohlfahrtsprogramm (Aid to Families with Dependent Children) wurde nicht der willkürlichen Interpretation einzelner Bundesstaaten überlassen, sondern blieb in der Verantwortung Washingtons. Die Bundesregierung muß weiterhin einen Mindestsatz zahlen und zeichnet auch für die Lebensmittelhilfe (Food Stamps) verantwortlich. Seit 1983 rannte das Weiße Haus mehrmals gegen die Einsprüche des Kongresses an; es wurde regelmäßig abgeblockt. So blieb das institutionelle Gefüge der Sozial- und Wohlfahrtspolitik intakt. Zugegeben, ein schwacher Trost für jene, die seit 1981 unter den Kürzungen zu leiden haben. Aber dennoch eine Hoffnung, weil sozialreformerische Politik der Zukunft nicht bei Null anfangen muß.
Wie steht es um das zweite große Ziel der Reaganauten? Gelang die ideologische Wende? Zweifellos erzielten sie in den 80er Jahren wichtige Erfolge. Phasenweise diktierten sie die Themen der politischen Diskussion im Land. Die republikanische Partei konnte ehemalige Bastionen der Demokraten im »Mountain West« (von Arizona bis Wyoming) und im Süden (Texas, Florida) für sich gewinnen. Wichtiger noch, sie faßte mit rassistischen Programmen in der weißen Arbeiterklasse der nördlichen Großstädte Fuß. Millionen von »blue collars« kehrten dort seit den frühen 80er Jahren der Demokratischen Partei den Rücken.
Trotzdem blieben die Konservativen von einer ideologischen oder gar politischen Hegemonie weit entfernt. Thomas Ferguson, Joel Rogers und Thomas Edsall vergleichen die innenpolitische Szene nach acht Jahren Reagan mit einem politischen Stellungs- und Grabenkrieg (»trench warfare«). Jede Seite verschanzt sich auf ihrem Terrain, unfähig, neuen Boden zu gewinnen. In der Wählerschaft gibt es keine eindeutigen Mehrheiten. Das ursprünglich erwartete bzw. befürchtete »conservative realignment« ist nicht eingetreten. Vielmehr sollte von einem »De-Alignment« gesprochen werden: Die Wähler orientieren sich immer weniger an Parteien, sondern stimmen für oder gegen den Kandidaten ab. Augenblicklich geben 15% der erwachsenen Bevölkerung, ca. 25 Millionen, an, keine parteipolitische Präferenz zu haben. Und der Anteil dieser Wählergruppe steigt ständig.
Zuverlässig ist auch der Befund, daß Reagans Popularität seiner Person galt, nicht hingegen dem konservativen Programm. Kein Thema war vor »liberalen Rückschlägen« sicher. 1985 drehte sich auch in der Rüstungsdebatte der Wind. Eine Mehrheit lehnte fortan höhere Militärausgaben ab. Die Reaganauten waren weiter denn je von ihrem Ziel entfernt, den militärischen Interventionismus wieder hoffähig zu machen. Meinungsumfragen und sozialpsychologische Analysen der Jahre 1984-87 zeigen ein deutlich »liberales Profil« der öffentlichen Meinung. Das Erbe der 60er Jahre wirkt in vielen Lebensbereichen unvermindert fort. Nur so ist es zu erklären, daß das Spendenaufkommen für die Konservativen dramatisch zurückging. Konservative »Political Action Committees« konnten 1983/84 19,5 Millionen Dollar eintreiben, 1985/86 waren es nur noch 9,3 Millionen; in den ersten sechs Monaten des Jahres 1987 gar nur 1,1 Millionen. Auch die Kassen der Republikanischen Partei leerten sich in dieser Zeit.
Warum scheiterten die Konservativen?
Warum scheiterten die Konservativen? Noch gibt es keine überzeugenden Studien zu dieser Frage, allenfalls Hinweise. Sicher spielte die Rezession des Jahres 1982, die mitten in die republikanische Aufschwungphase fiel, eine Rolle. Auch die innere Zerrissenheit der konservativen Bewegung wog schwer; zwischen christlichen Fundamentalisten und »Yuppie-Republikanern« ließ und läßt sich eben keine tragfähige politische Brücke bauen. Politisch schwer zu taxieren sind die Konflikte innerhalb des Kapitals. Fest steht, daß die binnenmarktorientierte Ölindustrie in Texas in der Hälfte der 80er Jahre zusammenbrach und die Konservativen in ihr einen wichtigen Sponsor verloren; fest steht auch, daß die beiden größten Kapitalfraktionen des Landes (weltmarktorientiert die eine, auf den amerikanischen Markt fixiert die andere) ihre Koalition nur wenige Monate über Reagans ersten Sieg hinweg retten konnten. Danach lagen sie wieder im üblichen Streit über Handelspolitik und Steuern.
Aber, mag eingewendet werden, gab es nicht zahlreiche, populistische Massenbewegungen – die »Anti-Tax-Movement«, die »Right-To-Live«-Bewegung, die zahlreichen Demonstrationen christlicher Fundamentalisten? Eine Analyse derselben steht noch aus. Doch schon heute kann festgehalten werden: Diese Bewegungen wurden überschätzt. Weder waren sie so mächtig, wie bisweilen in der Presse porträtiert, noch so einflußreich. Eigentlich waren es gar keine genuin sozialen Protestbewegungen, sondern eher Kunstprodukte einer neuen PR-Strategie oder – wie die Amerikaner sagen – „synthetic popular movements“. »Rent-a-grass-roots-movement« könnte die in den 80er Jahren populäre Strategie der professionellen Lobbyisten heißen. Erster Schritt: Eine sozial und weltanschaulich homogene Zielgruppe (beispielsweise »wiedergeborene Christen« in mittelständischen Wohnbezirken) wird ausgewählt. Zweiter Schritt: Werber schwärmen aus und stellen in Einzelgesprächen fest, welches politische Thema diese Gruppe augenblicklich besonders interessiert. Dritter Schritt: Einschlägiges Informations- und Werbematerial wird zusammengestellt und an alle Haushalte der Zielgruppe verschickt. Vierter Schritt: Noch einmal machen Werber die Runde und haken nach, ob auch alle vorgedruckten Briefe oder Postkarten an einen Kongreßabgeordneten oder eine Behörde abgeschickt wurden. So ist es heute keine Seltenheit mehr, wenn in einem Abgeordnetenbüro an einem einzigen Tag Hunderttausende von Briefen eingehen. Die Poststation auf Capitol Hill hat mittlerweile vorgesorgt und Dutzende von Großcontainern angeschafft. Anders ist mit den Folgen der »künstlichen politischen Befruchtung« nicht mehr umzugehen.
Als soziales Protestverhalten können solche Aktionen nicht verbucht werden. Sie beweisen allenfalls, daß eine bestimmte Werbestrategie gut ankommt. Bleiben die Impulse der lobbyistischen Elite aus, regt sich auch an den »grass roots« (wie gehabt) wenig. Ohne professionelle »organizers« vom Schlage eines Paul Weyrich, Howard Phillips oder Richard Viguerie wären z.B. die Evangelisten nicht als »politische Kraft« in Erscheinung getreten. Diese »Kraft« konnte nur wirken, solange handverlesene Aktivisten vom rechten Flügel der republikanischen Partei die Werbetrommel rührten und die »Bewegung« von oben her organisierten. Kein Wunder also, daß die »moral majority« selbst zu ihren Glanzzeiten in den meisten Bundesstaaten eine »letterhead organization« blieb. Ideologische Hegemonie war auf diese Weise nicht zu erringen.
Die „new political underclass“
Einzig in der Steuerpolitik konnte sich Reagan weitgehend behaupten. Wenige Monate nach der Wahl löste er sein Versprechen ein und verfügte einschneidende Steuersenkungen (Economic Recovery Tax Act aus dem Jahr 1981). In einem Zeitraum von fünf Jahren gingen dem Fiskus 747 Milliarden Dollar verloren. Thomas Edsall sieht darin die wohl »dauerhafteste Errungenschaft« dieser Regierung. Berechnungen des Congressional Budget Office bestätigen, daß Reagans Kritiker zu recht gewarnt hatten. Die Reform begünstigte eindeutig die oberen und obersten Einkommensschichten. Die Kluft zwischen reich und arm, aber auch zwischen höchsten und mittelständischen Einkommen wurde in den 80er Jahren ständig größer. Die unteren 40% auf der Einkommensskala müssen seit 1980 mit stagnierenden Nettoeinkommen (»after-tax-income«) leben (8.960 $ pro Jahr waren es 1980, 8.925 $ fünf Jahre später). Die oberen 40% hingegen strichen steuerbegünstigte Gewinne von 7,2% (im Jahr durchschnittlich 2.300 $) ein. Am besten schnitten die oberen 10% der Skala ab: 11,5% Zuwachs bedeutete für sie 5.400 $ jährlich mehr. Gar Alperovitz hat zurecht darauf hingewiesen, daß solche Umverteilungen in der amerikanischen Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts keineswegs ungewöhnlich sind – wir beobachten sie zwischen 1900 - 1914, in den 20er und frühen 30er Jahren, selbst in den 50er Jahren. So gesehen, liegt Reagans Reform im langfristigen historischen Trend. Sie bewirkte nur geringfügige Veränderungen in der Sozialstruktur. Auch der Anteil der Armen blieb, von kurzfristigen Schwankungen abgesehen, relativ konstant.
Und dennoch fielen die 80er Jahre aus dem Rahmen. Anders als in der Vergangenheit zogen sich die Opfer der Umverteilung aus der Politik zurück. Ob Arbeiter mit stagnierendem oder sinkendem Realeinkommmen, »working poor«, Wohlfahrtsempfänger oder Minderheiten – sie gingen auffallend weniger zu Wahl. Mittlerweile liegt die Wahlbeteiligung im unteren Drittel der Einkommensskala um 40% niedriger als im oberen, mittelständisch dominierten Drittel. (Zum Vergleich: In den frühen 60er Jahren betrug die Differenz 25%). In Reagans Amerika entstand eine »new political underclass« – Millionen von Menschen, die keine Möglichkeit sehen, sich gegen die Übergriffe des Kapitals und die staatlich verfügte Beschneidung ihrer Einkommen zu wehren. Die Gewerkschaften bieten ihnen längst keinen Schutz mehr, die Demokratische Partei hat alle sozialliberalen Programme aus Roosevelts Zeiten längst über Bord geworfen. Wozu also zur Wahl gehen? Thomas Edsall schätzt diese »political underclass« auf augenblicklich 30 Millionen Haushalte (!). Ihre politische und moralische Depravierung ist wahrscheinlich das bitterste Erbe der Reagan-Jahre. Andererseits wissen wir noch zu wenig über diese Gruppe, um Prognosen abgeben zu können. Nicht auszuschließen, daß eine Phase eruptiver sozialer Proteste bevorsteht.
Reagans Präsidentschaft – ein Fehlschlag?
Gemessen an der radikalen Rhetorik und den ursprünglichen Absichten, war Reagans Präsidentschaft ein Fehlschlag. Gemessen an historischen Vorbildern aus dem konservativen Lager, war sie normal. Nur verstand es Reagan besser als seine Vorgänger, Niederlagen zu kaschieren. Er suggerierte Machtfülle, auch wenn er machtlos war; er zelebrierte als Erfolg, was eben noch ein Kompromiß geworden war; und über Niederlagen sprach keiner. Nicht umsonst galt dieser Mann als »great communicator«. Vieles spricht dafür, daß mit seinem Abgang die Kraft des »Reaganismus« gebrochen ist. Kaum noch ein Kommentator, der ernsthaft daran zweifelt. Was aber bedeutet diese Feststellung? Was besagt sie über die Zukunft Amerikas? Wenig, besser gesagt: überhaupt nichts. Wer sich nämlich in der politischen Landschaft des heutigen Amerikas zurechtfinden will, darf den »Reaganismus« nicht als Wegweiser wählen. Er führt in die Irre – weil die entscheidenden Veränderungen im innenpolitischen Machtgefüge samt und sonders in den Jahren vor Reagan durchgesetzt wurden. In den 70er Jahren begann der »große Umbruch«, der Abschied vom sozialliberalen Modell des Franklin Delano Roosevelt. Reagan setzte den Schlußstrich; nicht mehr, aber auch nicht weniger. »Alternativen zu Reagan« verdienen nur dann den Namen, wenn es Alternativen zur Reform der 70er Jahre sind. Und von dieser Sorte gibt es augenblicklich wenige. Kein Trost darum, daß mit Reagan auch der »Reaganismus« abgedankt hat.
Literatur:
Edsall, Thomas. The New Politics of Inequality. New York, London: Norton, 1982
Edsall, Thomas. Power and Money. Writing about Politics, 1971 - 1987. New York, London: Norton, 1988
Edsall, Thomas u. Blumenthal, Sidney (Hg.). The Reagan Legacy. New York: Pantheon, 1988
Smith,Hedrick. The Power Game. How Washington Works. New York: Random House, 1988
Harrison, Bennett u. Bluestone, Barry. The Great U-Turn. Corporate Restructuring and the Polarizing of America. New York: Basic Books, 1988
Stern, Philip M. The Best Congress Money Can Buy. New York: Pantheon, 1988
Ferguson, Thomas u. Rogers, Joel. The Hidden Election. Politics and Economics in the 1980 Presidential Election. New York: Pantheon, 1981
Ferguson, Thomas u. Rogers, Joel (Hg.). Right Turn. The Decline of the Democrats and the Future of American Politics. New York: Hill & Wang, 1986
Weiss, Michael J. The Clustering of America. New York: Harper & Row, 1988
Greiner, Bernd. Interview mit Gar Alperovitz, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 2/1989
Rothschild, Emma. The Reagan Economic Legacy. In: The New York Review of Books, 30.6. und 21.7.1988
Dr. Bernd Greiner ist Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung.