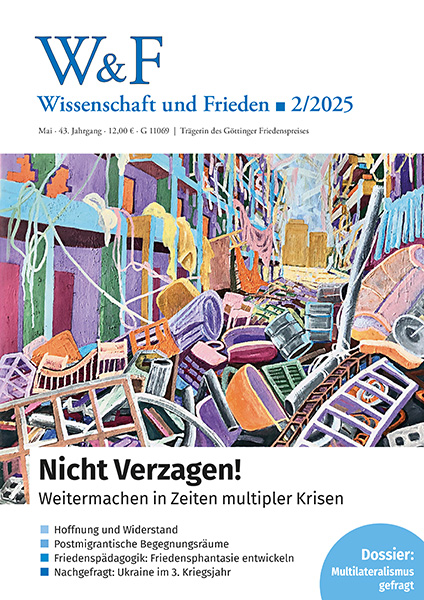Zivilgesellschaftliche Räume für Friedensarbeit weltweit
Tagung »Civic Space«, Plattform Zivile Konfliktbearbeitung und Evangelische Akademie Bad Boll, online, 13.-14. März 2025
Die Relevanz des Themas »Civic Space« – ein Raum freier gesellschaftlicher und politischer Teilhabe – in der Onlinetagung der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung (PZKB) und der Evangelischen Akademie Bad Boll könnte nicht offensichtlicher sein. Weltweit stehen die Rechte auf Meinungsfreiheit und politische Teilhabe unter Druck.
Auch in Deutschland sind die Einschränkung von »Civic Spaces« zunehmend spürbar, wie Dr. Carola Hausotter (Ev. Akademie Bad Boll) und Ginger Schmitz (PZKB) in ihren Eröffnungsstatements hervorhoben. Dabei verwiesen sie auf die Kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag mit dem Titel »Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen« zu 17 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die unmittelbar vor der Bundestagswahl noch auf den Weg gebracht worden war (BTD 20/15035, Antwort der Bundesregierung: BTD 20/15101). Gleichzeitig sahen sie die zahlreichen Pro-Demokratie-Demonstrationen weltweit als positive Zeichen des Engagements für demokratische Werte und Menschenrechte.
Am ersten Tag der Veranstaltung lag der Fokus auf den globalen Herausforderungen für »Civic Spaces«. Mandeep S. Tiwana, Interim Ko-Generalsekretär von CIVICUS, präsentierte Daten, die ein erschreckendes Bild zeichnen: Weltweit sind »Civic Spaces« unter Druck. Friedliche Protestierende, Menschenrechts- und Gewerkschaftsaktivist*innen sowie Journalist*innen werden verfolgt und kriminalisiert. Häufig werden sie als fremde Agent*innen oder Staatsfeinde diffamiert. Die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele wird zunehmend vernachlässigt, während Krieg und Gewalt zunehmen. Großmacht- und Unternehmensinteressen haben oft Vorrang vor internationalen Verträgen, was die globale Ungerechtigkeit weiter verschärft. Für die Zivilgesellschaft bedeutet dies, dass sie zielgerichteter arbeiten, und die lokalen Interessen der von ihr vertretenen Personen gleichberechtigt einbeziehen muss. Außerdem müssen vielfältigere Finanzierungsquellen identifiziert, und sich ein »Movement Mindset« zugelegt werden. Das bedeutet, dass zivilgesellschaftliche Gruppen sich von starren bürokratischen Strukturen lösen und flexibler werden müssen, um Organisationsformen zu entwickeln, die den gewünschten Veränderungen in der Welt entsprechen und für die ihnen dienenden Gemeinschaften sinnvoll sind.
Drei konkrete Länderbeispiele verdeutlichten die Herausforderungen: Julian Villa-Turek von Nodo Alemania (Knotenpunkt Deutschland) berichtete, wie Kolumbianer*innen im Exil den Friedens- und Versöhnungsprozess in Kolumbien unterstützen und sich miteinander vernetzen. Stimmen aus Georgien berichteten über die anhaltenden Proteste in ihrem Land – insbesondere von jungen Menschen – gegen restriktive Gesetze, Polizeigewalt und willkürliche Festnahmen. Cathy Nzimbu Mpanu-Mpanu-Plato, Leiterin des Studienbegleitprogramms für Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa in Stuttgart, thematisierte den Krieg im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Der illegale Rohstoffhandel stellt demnach ein zentrales Problem dar, während die schwachen Regierungsstrukturen, die auf das koloniale Erbe zurückzuführen sind, die Situation weiter verschärfen. In drei »learning corners« wurden die Länderberichte anschließend kommentiert und Gegenstrategien diskutiert. Für Kolumbien wurde die Solidarität mit der Zivilgesellschaft und den Geflüchteten betont. In Georgien könnte die Kirche versuchen, eine Reduzierung der Gewalt zu erreichen und die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Um die Situation in der DR Kongo zu verbessern, sind Lieferkettengesetze sowie politischer und wirtschaftlicher Druck, insbesondere auf das Nachbarland Ruanda, von entscheidender Bedeutung.
Am zweiten Tag der Veranstaltung stand die Situation des »Civic Space« in Deutschland im Mittelpunkt. Ann-Kathrin Seidel von Campact, Jan Wenzel vom Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO) und Sprecher des »Bündnis für Gemeinnützigkeit« sowie Karen Taylor, Leiterin für politische Kommunikation bei »Each One Teach One« und Vertreterin bei der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen waren zu einem Online-Rundtisch eingeladen. Seidel betonte die wachsende Besorgnis über die Einschränkungen der Handlungsfreiheit zivilgesellschaftlicher Organisationen im Inland. Obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt hat, dass politische Äußerungen von gemeinnützigen Organisationen erlaubt sind, auch wenn sie Fördergelder erhalten, stehen viele Organisationen aktuell unter Druck. Zudem zielen Narrative über eine angebliche „Schattenstruktur“ wie in der Kleinen Anfrage der Unionsfraktion darauf ab, zivilgesellschaftliche Akteure zu diskreditieren. Wenzel machte auf den dringenden Bedarf an politischen Antworten aufmerksam. In der neuen Legislaturperiode muss eine Reform der Gemeinnützigkeit und die Stärkung des Programms »Demokratie Leben!« weiterverfolgt werden. Taylor ergänzte, dass Akteur*innen, die sich für die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen, immer stärker Vorurteilen und Misstrauen ausgesetzt sind. Daher müssen Ressourcen gerechter geteilt und eine stärkere Vernetzung innerhalb der Communities gefördert werden.
Im Anschluss bildeten die Inputs von John Preuss (KURVE Wustrow) und Stefan Diefenbach-Trommer (Allianz »Rechtssicherheit für politische Willensbildung«) die Grundlage für zwei vertiefende Arbeitsgruppen. Preuss betonte die zentrale Rolle der Zivilgesellschaft in Konflikten, insbesondere bei der Bereitstellung essenzieller Dienstleistungen in Ländern wie dem Sudan, Myanmar und der Ukraine. Er forderte eine stärkere Unterstützung zivilgesellschaftlicher Strukturen in der internationalen Politik und die Förderung demokratischer Netzwerke. Diefenbach-Trommer kritisierte das Fehlen von Begriffen wie »Menschenrechte« und »Zivilgesellschaft« im Sondierungspapier der angehenden Bundesregierung und betonte die Notwendigkeit, die Zivilgesellschaft proaktiv in politische Prozesse einzubinden. Gerade Akteur*innen in der Zivilen Konfliktbearbeitung sollten stärker als Vorbild für eine gute demokratische Kultur fungieren.
Die vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven der Onlinetagung verdeutlichten, wie essenziell der Schutz und Erhalt von »Civic Spaces« für Frieden und Demokratie ist. Zudem boten sie zahlreiche Anknüpfungspunkte für die zukünftige politische Arbeit der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung und ihrem Netzwerk in diesem Bereich.
Dr. Ute Finckh-Krämer und Jennifer Menninger